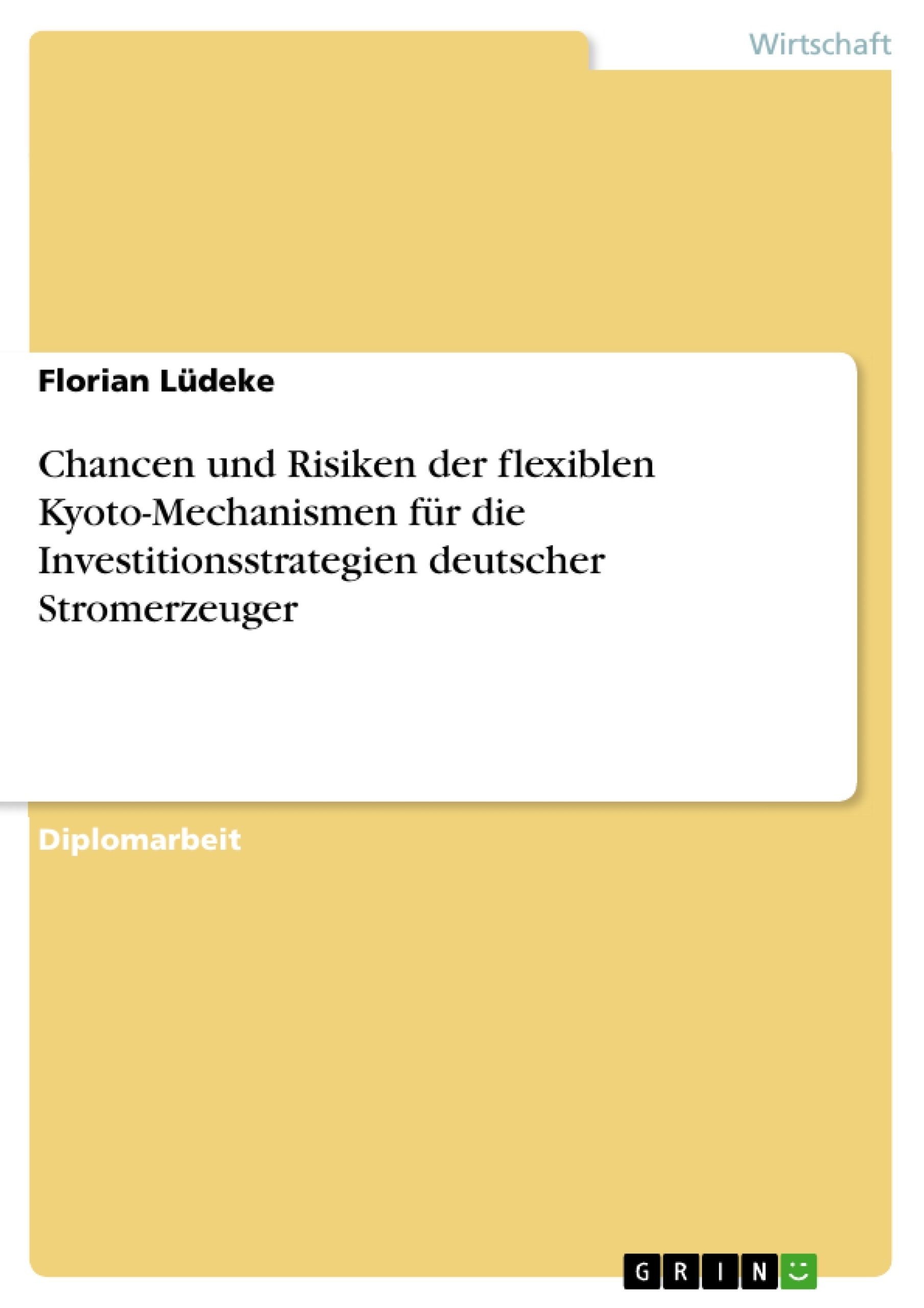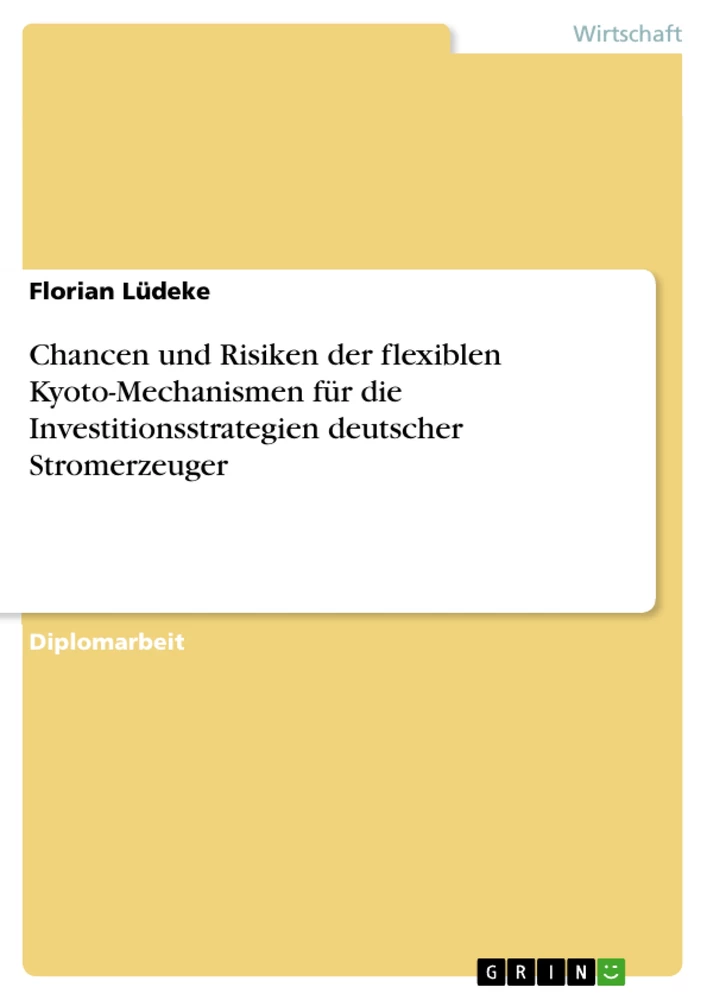
Chancen und Risiken der flexiblen Kyoto-Mechanismen für die Investitionsstrategien deutscher Stromerzeuger
Diplomarbeit, 2005
99 Seiten, Note: 1,7
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Fragestellung
- Abgrenzung und Inhalt
- Aufbau der Arbeit
- Rahmenbedingungen der Klimaschutzpolitik
- Das globale Klimasystem als gefährdetes öffentliches Gut
- Globale Klimaänderung – Anzeichen und Indikatoren
- Negative technologische externe Effekte
- Rechtliche und konzeptionelle Grundlagen und Pflichten
- Klimarahmenkonvention: Klimapolitik auf internationaler Ebene
- Kyoto-Protokoll und Vorgaben auf EU-Ebene
- Nationale Reduktionspflichten im Kontext des Emissionshandels
- Flexible Instrumente in der Klimaschutzpolitik
- Handel mit Emissionszertifikaten. Einführung
- Emissionsberechtigungen
- Erstallokation der Emissionsberechtigungen
- Emissionsminderungsgutschriften
- Ausgewählte Aspekte der Umsetzung auf EU- und deutscher Ebene
- EU-Emissionshandelssystem
- Spezifische Regelungen des deutschen Zuteilungsgesetzes
- Die projektorientierten Mechanismen
- Joint Implementation
- Clean Development Mechanism
- Verknüpfung der projektorientierten Mechanismen mit dem Emissionshandel
- Theoretische Darstellung der statischen und dynamischen Effizienz
- Statische Effizienz
- Dynamische Effizienz
- Strategische Nutzung der flexiblen Mechanismen und des Emissionsmarktes
- Bestimmungsfaktoren
- Institutionelle Faktoren
- Strategische Faktoren
- Strategische Optionen und Klimastrategien
- Strategische Intention: Innovation
- Strategische Intention: Kompensation
- Komplexe Klimastrategien
- Bedeutung möglicher CO2-Kosten für eine konkrete Investitionsentscheidung
- Darstellung an einem konkreten Beispiel: Das Referenzkraftwerk Nordrhein-Westfalen
- Ausgangspunkt: Politische und marktliche Anforderungen
- Energie- und umweltpolitische Anforderungen
- Anforderungen aus Unternehmenssicht
- Vorgehensweise
- Anpassung des Investitionskalküls
- Wirtschaftlichkeitsbetrachtung
- Relative Wirtschaftlichkeit unter Einbezug möglicher CO2-Kosten
- Zusammenführung: CO2-Kostenbelastung und die strategische Nutzung der flexiblen Mechanismen sowie des Emissionsmarktes
- Optionen für den Bezug von Emissionsrechten und -minderungsgutschriften
- Zusammenfassung grundlegender Bezugsquellen
- Kostenlose Zuteilung
- Emissionsminderungsmaßnahmen
- Emissionshandel
- Projektmaßnahmen
- Carbon Fonds
- Nationale Ausgleichsprojekte
- Ergänzende Anmerkungen
- Konkretisierung
- Kostenlose Zuteilung
- Handlungsorientierungen
- Ersatzanlagen gemäß § 10 ZuG
- Neuanlagen gemäß § 11 ZuG
- Projektmaßnahmen
- Beispiel eines JI-Projektes
- Senkung der Grenzvermeidungskosten
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Diplomarbeit befasst sich mit den Chancen und Risiken der flexiblen Kyoto-Mechanismen für die Investitionsstrategien deutscher Stromerzeuger. Sie analysiert die Auswirkungen des Emissionshandels und der projektorientierten Mechanismen auf die Entscheidungsfindung von Unternehmen im Energiesektor.
- Analyse der rechtlichen und konzeptionellen Rahmenbedingungen der Klimaschutzpolitik
- Bewertung der flexiblen Instrumente der Klimaschutzpolitik, insbesondere Emissionshandel und projektorientierte Mechanismen
- Untersuchung der strategischen Nutzungsmöglichkeiten der flexiblen Mechanismen für deutsche Stromerzeuger
- Bewertung der Bedeutung von CO2-Kosten für konkrete Investitionsentscheidungen
- Zusammenführung der Erkenntnisse zu einer umfassenden Analyse der Chancen und Risiken für die Investitionsstrategien deutscher Stromerzeuger
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Dieses Kapitel stellt die Fragestellung der Arbeit vor, grenzt den Inhalt ab und erläutert den Aufbau der Arbeit.
- Rahmenbedingungen der Klimaschutzpolitik: Hier werden die rechtlichen und konzeptionellen Grundlagen der internationalen und nationalen Klimaschutzpolitik dargestellt, insbesondere die Klimarahmenkonvention, das Kyoto-Protokoll und das EU-Emissionshandelssystem.
- Flexible Instrumente in der Klimaschutzpolitik: Dieses Kapitel befasst sich mit den flexiblen Mechanismen des Kyoto-Protokolls, dem Emissionshandel und den projektorientierten Mechanismen (Joint Implementation und Clean Development Mechanism). Es werden die Funktionsweise und die Umsetzung dieser Instrumente auf EU- und deutscher Ebene erläutert.
- Strategische Nutzung der flexiblen Mechanismen und des Emissionsmarktes: In diesem Kapitel werden die strategischen Möglichkeiten der Nutzung der flexiblen Mechanismen für deutsche Stromerzeuger analysiert, wobei institutionelle und strategische Faktoren betrachtet werden.
- Bedeutung möglicher CO2-Kosten für eine konkrete Investitionsentscheidung: Hier wird die Bedeutung von CO2-Kosten für Investitionsentscheidungen am Beispiel eines Referenzkraftwerks untersucht. Es werden die Auswirkungen verschiedener CO2-Kosten auf die Wirtschaftlichkeit verschiedener Kraftwerkstechnologien analysiert.
- Zusammenführung: CO2-Kostenbelastung und die strategische Nutzung der flexiblen Mechanismen sowie des Emissionsmarktes: Dieses Kapitel führt die Erkenntnisse der vorherigen Kapitel zusammen und analysiert die verschiedenen Optionen für den Bezug von Emissionsrechten und -minderungsgutschriften für deutsche Stromerzeuger.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen Klimaschutzpolitik, flexible Mechanismen, Emissionshandel, projektorientierte Mechanismen (Joint Implementation, Clean Development Mechanism), Investitionsstrategien, Stromerzeuger, CO2-Kosten, Wirtschaftlichkeitsanalyse.
Details
- Titel
- Chancen und Risiken der flexiblen Kyoto-Mechanismen für die Investitionsstrategien deutscher Stromerzeuger
- Hochschule
- Leuphana Universität Lüneburg (Centre for Sustainability Management)
- Note
- 1,7
- Autor
- Florian Lüdeke (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2005
- Seiten
- 99
- Katalognummer
- V86105
- ISBN (eBook)
- 9783638063487
- ISBN (Buch)
- 9783640387335
- Dateigröße
- 1639 KB
- Sprache
- Deutsch
- Anmerkungen
- Bemerkung des Prüfers: "Wie die Begrenztheit der verfügbaren Literatur zeigt, ist die Anwendung des theoretischen klimapolitischen Instrumentariums auf den betrieblichen Alltag sehr innovativ. Die besondere Leistung des Prüflings bestand in dem eigenständigen Transfer der grundlegenden Kenntnisse anreizbasierter Instrumente und aktueller Forschungsergebnisse zum strategischen Verhalten von Unternehmen auf betriebliche Investitionsentscheidungen. Mit dem Bezug auf aktuelle Forschungsergebnisse wird die Relevanz der Arbeit unterstrichen."
- Schlagworte
- Kyoto-Mechanismen emission co2 zertifkathandel emissionshandel eex emissionszertifikathandel emissionszertifikatehandel zertifkatehandel kyoto-protokoll cdm clean development mechanism ji joint implementation e.on energie erneuerbare energien strom energiehandel stromhandel ebook download kraftwerk energiepolitik klimawandel klimapolitik klimaschutz emissionsrecht emissionsrechte emissionsrechtehandel kyoto flexible kyoto mechanismen flexible mechanismen umweltpolitik nachhaltig energieversorgung zertifikat early action umweltzertifikat öffentliches gut öffentliche güter klimaneutral externe effekte klimasystem emissionsreduktion allokation zuteilungsgesetz statische effizienz dynamische effizienz referenzkraftwerk nordrhein-westfalen carbon fonds grenzvermeidungskosten ZuG AAU assigned amount unit AIJ activities implemented jointly CER certified emission reduction DEHSt Deutsche Emissionshandelsstelle EEG Erneuerbare Energien Gesetz
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 39,99
- Preis (Book)
- US$ 50,99
- Arbeit zitieren
- Florian Lüdeke (Autor:in), 2005, Chancen und Risiken der flexiblen Kyoto-Mechanismen für die Investitionsstrategien deutscher Stromerzeuger, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/86105
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-