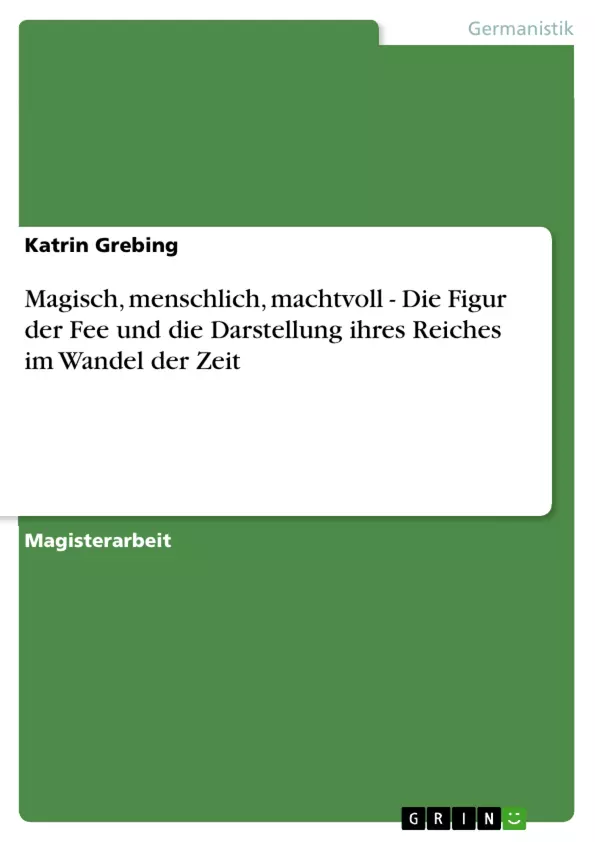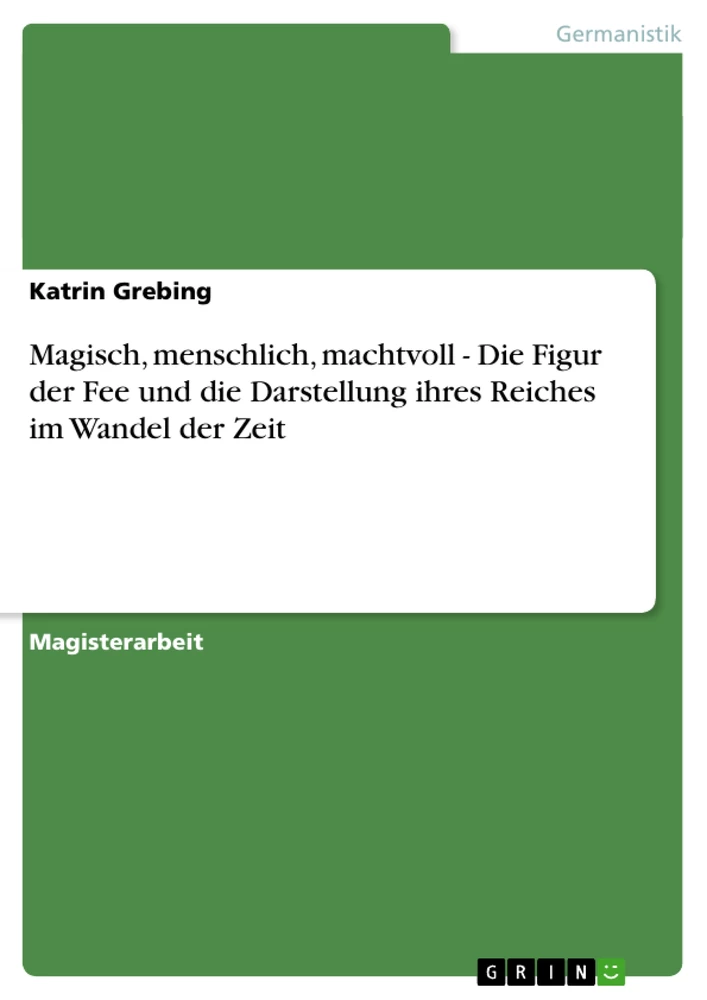
Magisch, menschlich, machtvoll - Die Figur der Fee und die Darstellung ihres Reiches im Wandel der Zeit
Magisterarbeit, 2007
97 Seiten, Note: 1,3
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Figur der Fee
- 2.1 Artusliteratur
- 2.1.1 Keltische Mythen
- 2.1.2 Der Lai Lanval der Marie de France
- 2.1.3 Die Vita Merlini des Geoffrey von Monmouth und ihre Nachfolger
- 2.1.4 Die höfische Fee Florie
- 2.1.5 Joram, der König des Feenlandes
- 2.1.6 Die Feenliebe
- 2.1.7 Die Feenjugend
- 2.2 Vorbilder, Darstellung und Interpretation der Feenfiguren in Oberon
- 2.3 Die Feenfiguren in Drachenfeuer
- 2.3.1 Die Rückkehr zu den keltischen Mythen
- 2.3.2 Die Feenvölker Erinns
- 2.3.2.1 Die mächtigen Sidhe
- 2.3.2.2 Das Volk der Halbelfen, die Tuatha De Danann
- 2.3.2.3 Andere Feenvölker und Phantasiegestalten in Erinn
- 2.3.3 Die „menschlichen“ Feenvölker Erinns
- 2.3.4 Oberon, zwischen Feentitel und Götterfigur
- 2.1 Artusliteratur
- 3. Feenreich ist nicht gleich Feenreich: Darstellung und Vergleich
- 3.1 Der „locus amoenus“
- 3.2 Das Feenreich, ein „hortus conclusus“
- 3.2.1 Die Reise in Jorams Reich
- 3.2.2 Das Betreten von Oberons und Titanias Reichen
- 3.2.3 Die Wege in die Reiche des Romans Drachenfeuer
- 3.3 Die Entrückung
- 3.4 Die Besonderheiten der verschiedenen Feenreiche
- 3.4.1 Jorams höfisiertes, rationalisiertes Feenreich
- 3.4.2 Die stimmungsabhängigen Reiche von Oberon und Titania
- 3.4.3 Die Feenwelt in Drachenfeuer
- 4. Resumé
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Darstellung der Feenfigur und ihrer Reiche in der deutschen Literatur über drei Jahrhunderte hinweg. Ziel ist es, Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Figurenzeichnung und der Gestaltung der Feenreiche herauszuarbeiten und die Entwicklung der Darstellung im Laufe der Zeit zu analysieren. Die Arbeit beleuchtet auch die Frage nach den Ursprüngen der Feendarstellung und den Einflüssen verschiedener Quellen.
- Entwicklung der Feenfigur in der Literatur
- Vergleichende Analyse verschiedener Feenreiche
- Einfluss keltischer Mythen und anderer Quellen
- Unterschiede in der Darstellung der Feen über die Jahrhunderte
- Funktionen der Feenreiche innerhalb der jeweiligen Erzählungen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Feendarstellung in der Literatur ein und skizziert die Forschungsfrage. Sie beschreibt die Vielfalt der Feenfiguren und die Herausforderungen, eine präzise Definition zu finden. Die Arbeit konzentriert sich auf drei ausgewählte Werke aus verschiedenen Jahrhunderten: Wirnt von Grafenbergs "Wigalois", Christoph Martin Wielands "Oberon" und Wolfgang und Heike Hohlbeins "Drachenfeuer". Die Auswahlkriterien sind die Länge der Werke, die Bedeutung der Feenfiguren in der Handlung und die Bekanntheit der Autoren. Die Einleitung betont die Absicht, Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Darstellung der Feen und ihrer Reiche zu untersuchen und die Entwicklung der Darstellung im Laufe der Zeit zu analysieren.
2. Die Figur der Fee: Dieses Kapitel analysiert die Figur der Fee in verschiedenen literarischen Werken, beginnend mit der Artusliteratur und ihren keltischen Wurzeln. Es werden verschiedene Aspekte der Feendarstellung untersucht, wie beispielsweise die Herkunft, Entwicklung und Darstellung der Feenfigur in der Artusliteratur, die Feenliebe, die Feenjugend und die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen den einzelnen Darstellungen in verschiedenen Werken, insbesondere "Wigalois", "Oberon" und "Drachenfeuer". Es wird auf die Darstellung der Feen in "Wigalois", "Oberon" und "Drachenfeuer" eingegangen, wobei die Entwicklung der Figur von der höfischen Fee bis hin zu komplexeren und facettenreicheren Darstellungen in der modernen Fantasy-Literatur untersucht wird. Die Analyse umfasst die Rolle der Feen in den jeweiligen Geschichten und deren Beziehung zu den menschlichen Figuren.
3. Feenreich ist nicht gleich Feenreich: Darstellung und Vergleich: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Vergleich der verschiedenen Feenreiche in den ausgewählten literarischen Werken. Es analysiert die Gestaltung der Feenreiche und deren Funktionen innerhalb der jeweiligen Erzählungen. Dabei werden Begriffe wie "locus amoenus" und "hortus conclusus" verwendet, um die unterschiedlichen Charakteristika der Feenreiche zu beschreiben. Die Kapitel analysieren die Darstellung und den Zugang zu den verschiedenen Reichen und hebt die Unterschiede in den Reichen von Joram, Oberon und Titania sowie dem Feenreich in "Drachenfeuer" hervor. Die Analyse umfasst auch die Rolle der Entrückung und die Besonderheiten der verschiedenen Feenreiche. Der Vergleich verdeutlicht die unterschiedlichen Funktionen der Feenreiche und zeigt, wie die Autoren diese nutzen, um die jeweilige Erzählung zu gestalten.
Schlüsselwörter
Fee, Feenreich, Artusliteratur, keltische Mythen, Oberon, Titania, Drachenfeuer, Fantasy-Literatur, Literaturvergleich, Figurenzeichnung, Entwicklung der Darstellung, "locus amoenus", "hortus conclusus", Entrückung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse der Feendarstellung in der deutschen Literatur
Was ist der Gegenstand dieser wissenschaftlichen Arbeit?
Die Arbeit analysiert die Darstellung von Feen und ihren Reichen in der deutschen Literatur über drei Jahrhunderte. Der Fokus liegt auf Gemeinsamkeiten und Unterschieden in der Figurenzeichnung und Gestaltung der Feenreiche sowie deren Entwicklung im Laufe der Zeit. Untersucht werden die Ursprünge der Feendarstellung und der Einfluss verschiedener Quellen.
Welche Werke werden untersucht?
Die Analyse konzentriert sich auf drei ausgewählte Werke: Wirnt von Grafenbergs "Wigalois", Christoph Martin Wielands "Oberon" und Wolfgang und Heike Hohlbeins "Drachenfeuer". Die Auswahl basiert auf der Länge der Werke, der Bedeutung der Feenfiguren und der Bekanntheit der Autoren.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entwicklung der Feenfigur in der Literatur, einen Vergleich verschiedener Feenreiche, den Einfluss keltischer Mythen und anderer Quellen, Unterschiede in der Feendarstellung über die Jahrhunderte und die Funktionen der Feenreiche innerhalb der jeweiligen Erzählungen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: Einleitung, Die Figur der Fee, Feenreich ist nicht gleich Feenreich: Darstellung und Vergleich, und Resumé. Die Einleitung führt in das Thema ein und beschreibt die Forschungsfrage. Kapitel 2 analysiert die Feenfigur in verschiedenen literarischen Werken, beginnend mit der Artusliteratur. Kapitel 3 vergleicht die verschiedenen Feenreiche und deren Funktionen. Das Resumé fasst die Ergebnisse zusammen.
Welche Aspekte der Feenfigur werden analysiert?
Die Analyse umfasst die Herkunft, Entwicklung und Darstellung der Feenfigur in der Artusliteratur, die Feenliebe, die Feenjugend, die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen den einzelnen Darstellungen in "Wigalois", "Oberon" und "Drachenfeuer", die Rolle der Feen in den jeweiligen Geschichten und deren Beziehung zu den menschlichen Figuren.
Wie werden die verschiedenen Feenreiche verglichen?
Der Vergleich der Feenreiche in den ausgewählten Werken analysiert deren Gestaltung und Funktionen innerhalb der Erzählungen. Es werden Begriffe wie "locus amoenus" und "hortus conclusus" verwendet, um die Charakteristika zu beschreiben. Die Analyse umfasst den Zugang zu den Reichen, die Unterschiede in den Reichen von Joram, Oberon und Titania sowie dem Feenreich in "Drachenfeuer", die Rolle der Entrückung und die Besonderheiten der verschiedenen Feenreiche.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant für die Arbeit?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind Fee, Feenreich, Artusliteratur, keltische Mythen, Oberon, Titania, Drachenfeuer, Fantasy-Literatur, Literaturvergleich, Figurenzeichnung, Entwicklung der Darstellung, "locus amoenus", "hortus conclusus" und Entrückung.
Wo finde ich detailliertere Informationen zu den einzelnen Kapiteln?
Das Inhaltsverzeichnis und die Zusammenfassungen der Kapitel im HTML-Dokument bieten einen detaillierten Überblick über den Inhalt der einzelnen Kapitel.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Figurenzeichnung und Gestaltung der Feenreiche herauszuarbeiten und die Entwicklung der Darstellung im Laufe der Zeit zu analysieren. Sie beleuchtet auch die Frage nach den Ursprüngen der Feendarstellung und den Einflüssen verschiedener Quellen.
Details
- Titel
- Magisch, menschlich, machtvoll - Die Figur der Fee und die Darstellung ihres Reiches im Wandel der Zeit
- Hochschule
- Universität Bielefeld
- Veranstaltung
- Der Ritterroman "Wigalois" von Wirnt von Grafenberg, ein verkannter Klassiker?
- Note
- 1,3
- Autor
- Katrin Grebing (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2007
- Seiten
- 97
- Katalognummer
- V87271
- ISBN (eBook)
- 9783638007528
- ISBN (Buch)
- 9783638913799
- Dateigröße
- 812 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Magisch Figur Darstellung Reiches Wandel Zeit Ritterroman Wigalois Wirnt Grafenberg Klassiker
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 38,99
- Preis (Book)
- US$ 49,99
- Arbeit zitieren
- Katrin Grebing (Autor:in), 2007, Magisch, menschlich, machtvoll - Die Figur der Fee und die Darstellung ihres Reiches im Wandel der Zeit, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/87271
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-