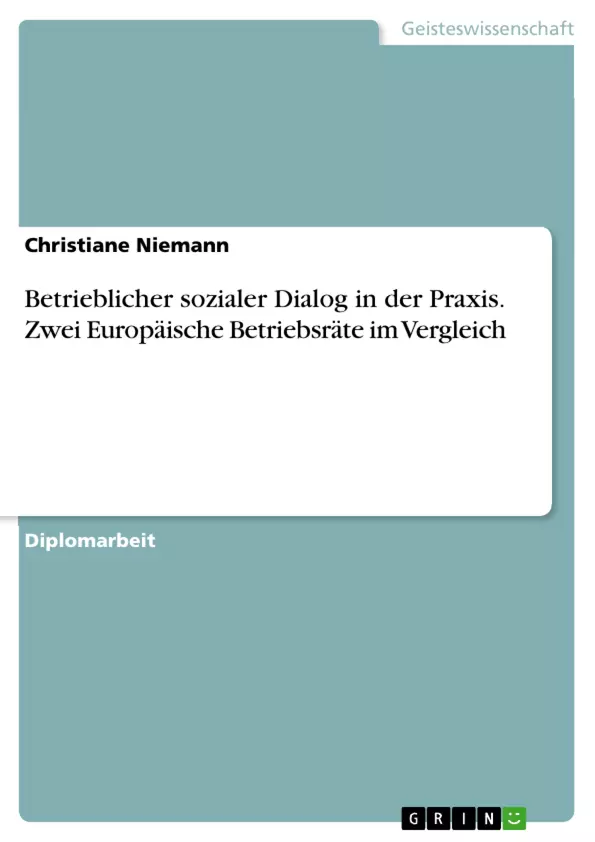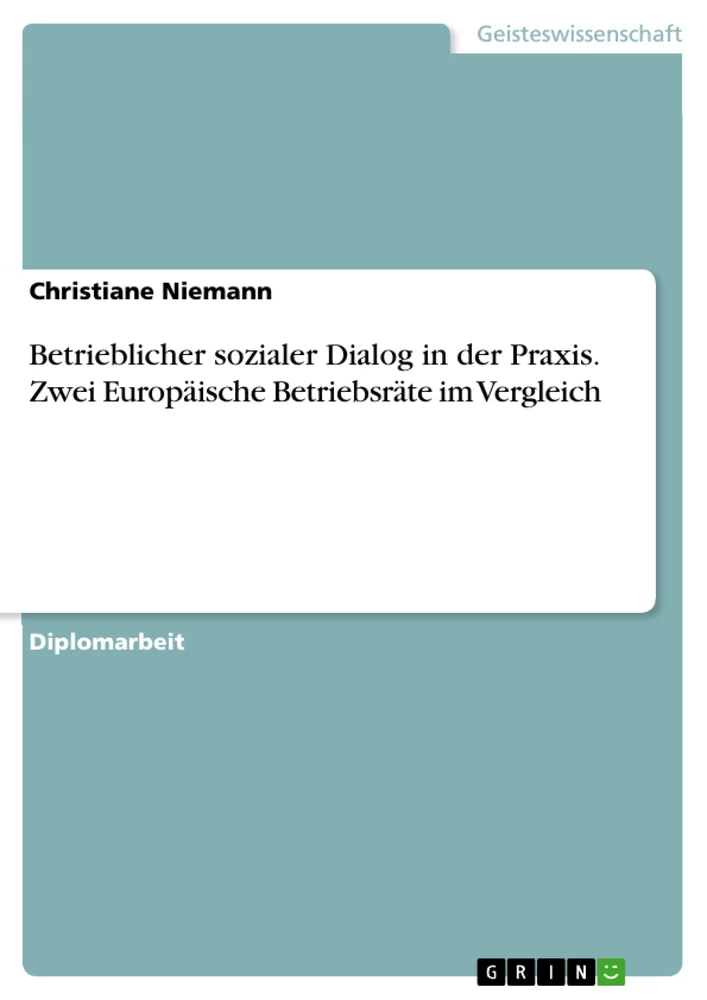
Betrieblicher sozialer Dialog in der Praxis. Zwei Europäische Betriebsräte im Vergleich
Diplomarbeit, 2006
107 Seiten, Note: 1,3
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Rechtlicher Rahmen und Erkenntnisse aus der EBR-Praxis
- 2.1 Die EBR-Richtlinie 94/45/EG des Rates der EU
- 2.1.1 Geltungsbereich der Richtlinie
- 2.1.2 Voraussetzungen für die Einsetzung eines EBR
- 2.2 EBR-Vereinbarungen nach Art. 13 und Art. 6 der EBR-Richtlinie im Vergleich
- 2.3 Information und Konsultation der Europäischen Betriebsräte
- 2.4 Transnationalität – Was bedeutet das für einen EBR?
- 2.5 Engere Ausschüsse
- 2.6 Forderungen der EBR und Gewerkschaften bezüglich der Revision der EBR-Richtlinie
- 3 Der EBR eines britischen Textil-Konzerns
- 3.1 Strukturentwicklung des Textil-Konzerns
- 3.2 Konstituierung und Entwicklung des freiwilligen EBR
- 3.3 Die EBR-Vereinbarung im Vergleich mit der Praxis
- 3.3.1 Zusammensetzung des EBR
- 3.3.2 Das Select Committee
- 3.3.3 Information und Konsultation - Themen und Praxis
- 3.3.4 EBR-Sitzungen
- 3.4 Interaktionsfelder und informelle Informations- und Kommunikationspraktiken
- 3.4.1 Interaktion und Kommunikation mit dem Management
- 3.4.2 EBR-interne Interaktion
- 3.4.3 Austausch mit den jeweils nationalen Arbeitnehmervertretungen und Belegschaften
- 3.4.4 Interaktion mit den Gewerkschaften
- 3.5 Resümee
- 4 Der EBR eines deutschen Kunststoff-Konzerns
- 4.1 Strukturentwicklung des Kunststoff-Konzerns
- 4.2 Konstituierung des Besonderen Verhandlungsgremiums (BVG)
- 4.3 Die EBR-Vereinbarung im Vergleich mit der Praxis
- 4.3.1 Zusammensetzung des EBR
- 4.3.2 Mandatsdauer und Schutz der Mitglieder
- 4.3.3 Der Lenkungsausschuss
- 4.3.4 Unterrichtung und Anhörung
- 4.3.5 EBR-Sitzungen und externe Berater
- 4.4 Interaktionsfelder und informelle Informations- und Kommunikationspraktiken
- 4.4.1 Interaktion mit dem Management
- 4.4.2 EBR-interne Interaktion
- 4.4.3 Austausch mit den jeweils nationalen Arbeitnehmervertretungen und Belegschaften
- 4.4.4 Interaktion mit den Gewerkschaften
- 4.5 Resümee
- 5 Vergleich der zwei untersuchten Europäischen Betriebsräte - Bezug nehmend auf bestimmte Interaktionsfelder und EBR-Typen
- 5.1 Interaktionsfelder des Europäischen Betriebsrats
- 5.2 Vergleich und Zuordnung der zwei EBR-Beispiele zu unterschiedlichen EBR-Typen auf Grundlage von zwei Studien
- 5.2.1 Der „beteiligungsorientierte“ und der „mitgestaltende“ EBR
- 5.2.2 Der „Projektorientierte EBR“
- 5.2.3 Der deutsche EBR-Vorsitzende als „Fürsprecher der Diaspora“ und der „dienstleistende EBR“
- 5.2.4 Der EBR im Leerlauf: der zahnlose Tiger
- 5.2.5 Der EBR als Informationsanalytiker: das Florettfechten
- 5.2.6 Der „symbolische“ bzw. „marginalisierte“ EBR
- 5.3 Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht den betrieblichen sozialen Dialog in der Praxis anhand eines Vergleichs zweier europäischer Betriebsräte (EBR) in unterschiedlichen multinationalen Konzernen. Ziel ist es, die Funktionsweise und die Herausforderungen von EBRs zu analysieren und verschiedene Interaktionsmuster aufzuzeigen.
- Funktionsweise von Europäischen Betriebsräten
- Vergleich verschiedener EBR-Typen und -Modelle
- Analyse von Interaktionsfeldern zwischen EBR, Management und nationalen Arbeitnehmervertretungen
- Einfluss der Unternehmensstruktur auf die EBR-Arbeit
- Bewertung der Effektivität von EBRs im Hinblick auf Information und Konsultation
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik des betrieblichen sozialen Dialogs und der europäischen Betriebsräte ein. Es beschreibt den Hintergrund der Entstehung grenzübergreifender Interessenvertretung in multinationalen Konzernen und legt die Zielsetzung und Methodik der Arbeit dar. Es skizziert den weiteren Aufbau der Arbeit und bereitet den Leser auf die folgenden Kapitel vor, in denen die Fallstudien und deren Analysen detailliert dargestellt werden.
2 Rechtlicher Rahmen und Erkenntnisse aus der EBR-Praxis: Dieses Kapitel analysiert den rechtlichen Rahmen der Europäischen Betriebsräte gemäß der EBR-Richtlinie 94/45/EG. Es beleuchtet den Geltungsbereich, die Voraussetzungen für die Einsetzung eines EBR und den Vergleich verschiedener EBR-Vereinbarungen. Es werden außerdem die Themen Information und Konsultation sowie die Bedeutung der Transnationalität für einen EBR erörtert. Der Kapitel beschließt mit den Forderungen der EBR und Gewerkschaften zur Revision der Richtlinie, wodurch der aktuelle Diskussionsstand um die EBR-Thematik aufgezeigt wird.
3 Der EBR eines britischen Textil-Konzerns: Dieses Kapitel präsentiert eine Fallstudie über den Europäischen Betriebsrat eines britischen Textilkonzerns. Es beschreibt die strukturelle Entwicklung des Konzerns und die Konstituierung des freiwilligen EBR. Die EBR-Vereinbarung wird im Detail analysiert und mit der Praxis verglichen. Ein besonderer Fokus liegt auf der Zusammensetzung des EBR, des Select Committees, der Informations- und Konsultationspraktiken sowie den verschiedenen Interaktionsfeldern des EBR mit dem Management, internen Gremien, nationalen Arbeitnehmervertretungen und Gewerkschaften. Der Abschnitt schließt mit einer zusammenfassenden Betrachtung der Stärken und Schwächen dieses speziellen EBR Modells.
4 Der EBR eines deutschen Kunststoff-Konzerns: Dieses Kapitel stellt eine weitere Fallstudie vor, diesmal über den EBR eines deutschen Kunststoffkonzerns. Die strukturelle Entwicklung des Konzerns und die Konstituierung des Besonderen Verhandlungsgremiums (BVG) werden beschrieben und analysiert. Die EBR-Vereinbarung wird mit der Praxis verglichen, wobei die Zusammensetzung des EBR, die Mandatsdauer der Mitglieder, der Lenkungsausschuss, die Unterrichtung und Anhörung, sowie die EBR-Sitzungen und die Rolle externer Berater im Fokus stehen. Ähnlich wie im vorherigen Kapitel werden die Interaktionsfelder mit dem Management, internen Gremien, nationalen Arbeitnehmervertretungen und Gewerkschaften untersucht und abschließend zusammenfassend bewertet.
5 Vergleich der zwei untersuchten Europäischen Betriebsräte - Bezug nehmend auf bestimmte Interaktionsfelder und EBR-Typen: Dieses Kapitel vergleicht die beiden Fallstudien aus den vorhergehenden Kapiteln anhand bestimmter Interaktionsfelder. Es ordnet die beiden EBR-Beispiele verschiedenen EBR-Typen zu, die in der Literatur beschrieben wurden. Die Kapitel analysiert und beschreibt unterschiedliche EBR-Rollen, wie z.B. den „beteiligungsorientierten“, den „mitgestaltenden“, den „projektorientierten“, den „dienstleistenden“ und den „symbolischen“ EBR. Es wird der Frage nachgegangen, inwieweit die untersuchten EBR-Beispiele diesen Typen zuzuordnen sind und welche Faktoren diese Zuordnung beeinflussen.
Schlüsselwörter
Europäischer Betriebsrat (EBR), betrieblicher sozialer Dialog, transnationaler Interessenvertretung, EBR-Richtlinie 94/45/EG, Information und Konsultation, Interaktionsfelder, EBR-Typen, Fallstudie, Vergleich, multinationaler Konzern, Arbeitnehmervertretung, Gewerkschaften.
Häufig gestellte Fragen zur Diplomarbeit: Europäische Betriebsräte im Vergleich
Was ist der Gegenstand dieser Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit untersucht den betrieblichen sozialen Dialog in multinationalen Konzernen anhand eines Vergleichs zweier europäischer Betriebsräte (EBR). Der Fokus liegt auf der Funktionsweise, den Herausforderungen und den Interaktionsmustern von EBRs in unterschiedlichen Unternehmenskontexten.
Welche Unternehmen wurden untersucht?
Die Arbeit analysiert den EBR eines britischen Textilkonzerns und den EBR eines deutschen Kunststoffkonzerns. Die Fallstudien ermöglichen einen Vergleich der EBR-Praktiken in verschiedenen Branchen und nationalen Kontexten.
Welche Aspekte der EBRs wurden untersucht?
Die Analyse umfasst die rechtlichen Grundlagen (EBR-Richtlinie 94/45/EG), die Struktur und Zusammensetzung der EBRs, die Informations- und Konsultationspraktiken, die Interaktionsfelder zwischen EBR, Management, nationalen Arbeitnehmervertretungen und Gewerkschaften sowie die Effektivität der EBRs.
Wie wurden die EBRs verglichen?
Der Vergleich der beiden EBRs erfolgt anhand bestimmter Interaktionsfelder und durch die Zuordnung zu verschiedenen EBR-Typen aus der Literatur. Es werden verschiedene Rollen von EBRs beschrieben und analysiert, wie z.B. der „beteiligungsorientierte“, der „mitgestaltende“, der „projektorientierte“, der „dienstleistende“ und der „symbolische“ EBR.
Welche EBR-Typen werden in der Arbeit diskutiert?
Die Arbeit diskutiert verschiedene EBR-Typen, darunter der „beteiligungsorientierte“, der „mitgestaltende“, der „projektorientierte“, der „dienstleistende“, der „symbolische“ bzw. „marginalisierte“ EBR, sowie der EBR als „Informationsanalytiker“ und der „zahnlose Tiger“.
Welche Rolle spielt die Unternehmensstruktur?
Die Arbeit untersucht den Einfluss der Unternehmensstruktur auf die EBR-Arbeit. Der Vergleich der beiden Fallstudien zeigt auf, wie unterschiedliche Organisationsstrukturen die Funktionsweise und Effektivität des EBR beeinflussen können.
Welche Rolle spielen Gewerkschaften und nationale Arbeitnehmervertretungen?
Die Interaktion der EBRs mit Gewerkschaften und nationalen Arbeitnehmervertretungen wird analysiert. Die Arbeit beleuchtet die Bedeutung dieser Beziehungen für die Informationsbeschaffung, die Konsultation und die Durchsetzung der Interessen der Arbeitnehmer.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit zieht Schlussfolgerungen über die Funktionsweise und Herausforderungen von EBRs und liefert Einblicke in verschiedene Interaktionsmuster. Sie trägt zum Verständnis der Rolle von EBRs im betrieblichen sozialen Dialog bei und diskutiert die verschiedenen EBR-Typen und deren Effektivität.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Europäischer Betriebsrat (EBR), betrieblicher sozialer Dialog, transnationaler Interessenvertretung, EBR-Richtlinie 94/45/EG, Information und Konsultation, Interaktionsfelder, EBR-Typen, Fallstudie, Vergleich, multinationaler Konzern, Arbeitnehmervertretung, Gewerkschaften.
Wo finde ich den vollständigen Inhalt der Diplomarbeit?
Der vollständige Inhalt der Diplomarbeit ist nicht in diesem FAQ enthalten. Dieses Dokument bietet nur eine Zusammenfassung der wichtigsten Punkte.
Details
- Titel
- Betrieblicher sozialer Dialog in der Praxis. Zwei Europäische Betriebsräte im Vergleich
- Hochschule
- Carl von Ossietzky Universität Oldenburg
- Note
- 1,3
- Autor
- Christiane Niemann (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2006
- Seiten
- 107
- Katalognummer
- V88839
- ISBN (eBook)
- 9783668327917
- Dateigröße
- 1033 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Betrieblicher Dialog Praxis Zwei Europäische Betriebsräte Vergleich
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 38,99
- Arbeit zitieren
- Christiane Niemann (Autor:in), 2006, Betrieblicher sozialer Dialog in der Praxis. Zwei Europäische Betriebsräte im Vergleich, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/88839
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-