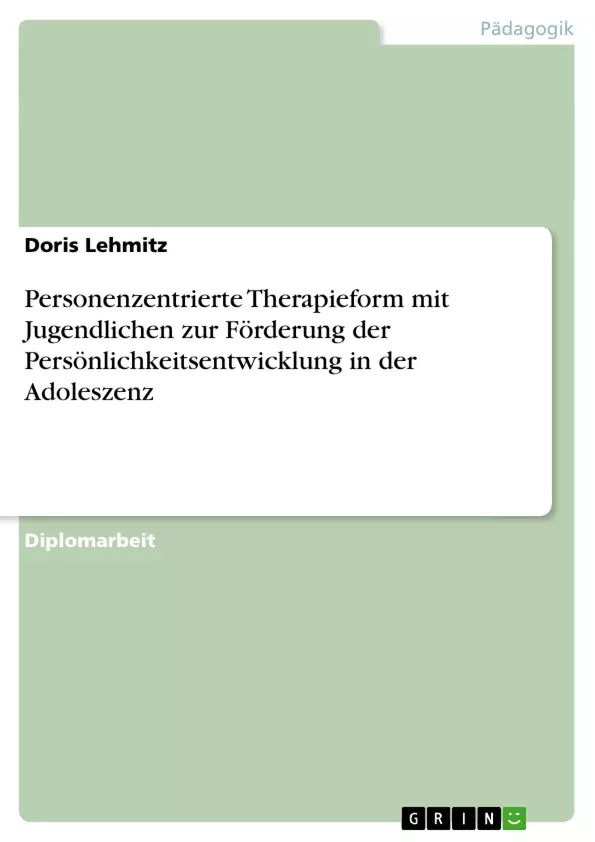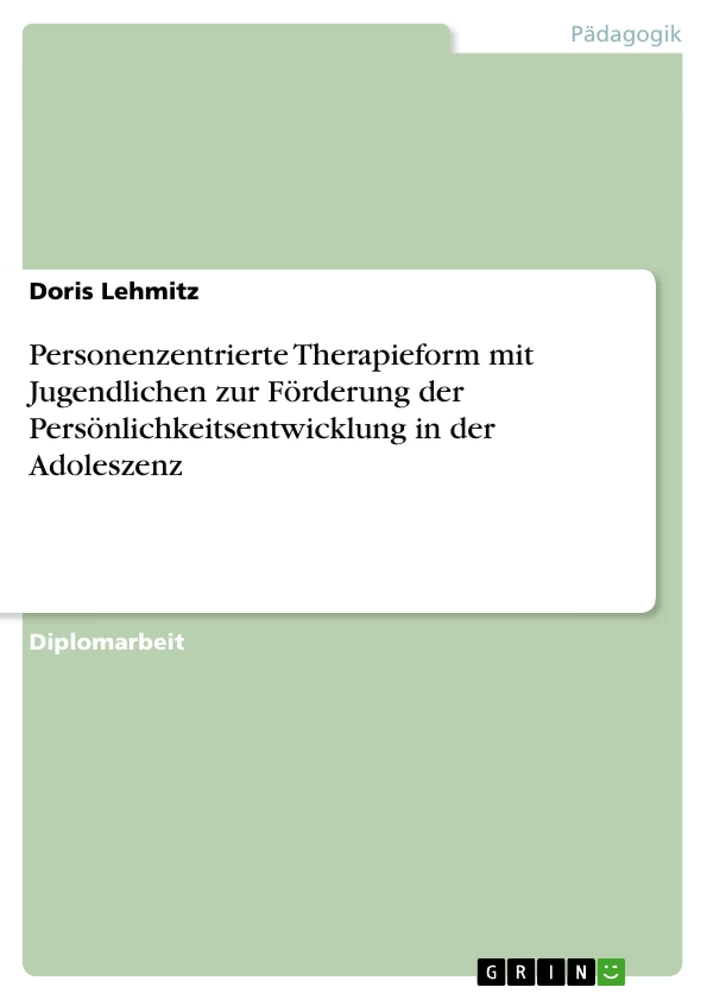
Personenzentrierte Therapieform mit Jugendlichen zur Förderung der Persönlichkeitsentwicklung in der Adoleszenz
Diplomarbeit, 2007
135 Seiten, Note: 2,6
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der personenzentrierte Therapieansatz
- Historische Entwicklung
- Personenzentrierter Therapieansatz im Bezugsrahmen der Humanistischen Psychologie
- Die Persönlichkeitstheorie von Carl R. Rogers
- Das Konzept der Störung im personenzentrierten Therapieansatz
- Therapietheoretische Aspekte des personenzentrierten Ansatzes
- Entwicklung im Jugendalter
- Entwicklungsaufgaben im Jugendalter
- Pubertäre Entwicklung und ihre Folgen
- Kognitive Entwicklung und ihre Folgen
- Lebenssituation Jugendlicher im sozialen Kontext
- Entwicklung der Identität und des Selbstkonzepts im Jugendalter
- Bedürfnisse Jugendlicher
- Persönlichkeitsentwicklung in der Adoleszenz
- Bewältigungsstrategien im Jugendalter
- Psychopathologische Erscheinungsbilder im Jugendalter
- Personenzentrierte Therapie mit Jugendlichen
- Abgrenzung zur Kinder- und Erwachsenentherapie
- Kennzeichen personenzentrierter Jugendlichenpsychotherapie
- Probleme in der Therapie mit Jugendlichen
- Personenzentrierte Arbeitsweise in der Therapie mit Jugendlichen
- Ziele personenzentrierter Therapie mit Jugendlichen
- Indikationskriterien personenzentrierter Therapie mit Jugendlichen
- Verlauf personenzentrierter Therapie mit Jugendlichen
- Bedürfnisse Jugendlicher im Bezugsrahmen des personenzentrierten Therapieansatzes
- Exemplarische Betrachtung: Depression im Jugendalter und Behandlungsmöglichkeiten nach dem personenzentrierten Therapieansatz
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Personenzentrierte Therapieform als Ansatz zur Förderung der Persönlichkeitsentwicklung in der Adoleszenz. Sie befasst sich mit den theoretischen Grundlagen des personenzentrierten Ansatzes, den Besonderheiten der Entwicklung im Jugendalter und den spezifischen Herausforderungen und Möglichkeiten der Anwendung dieser Therapieform bei Jugendlichen.
- Entwicklung des personenzentrierten Therapieansatzes und seine Relevanz für die Adoleszenz
- Psychologische und soziale Aspekte der Persönlichkeitsentwicklung im Jugendalter
- Anwendungen und Herausforderungen des personenzentrierten Therapieansatzes bei Jugendlichen
- Der Einfluss des Therapieprozesses auf die Entwicklung des Selbstkonzepts und der Identität von Jugendlichen
- Spezifische Aspekte der Behandlung psychopathologischer Erscheinungsbilder im Jugendalter, insbesondere der Depression, im Rahmen des personenzentrierten Therapieansatzes
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung stellt das Thema der Arbeit vor und erläutert die Relevanz der Personenzentrierten Therapie für die Adoleszenz.
- Kapitel 1 behandelt den personenzentrierten Therapieansatz in seiner historischen Entwicklung, seinen theoretischen Grundlagen und seinen zentralen Konzepten wie Inkongruenz und Selbstaktualisierung.
- Kapitel 2 widmet sich der Entwicklung im Jugendalter, den Herausforderungen und Chancen dieser Phase, und beleuchtet die Bedeutsamkeit der Identitätsstiftung und der Entwicklung des Selbstkonzepts.
- Kapitel 3 untersucht die spezifischen Aspekte der personenzentrierten Therapie mit Jugendlichen, ihre Ziele, Methoden und Herausforderungen, sowie ihre Anwendung im Kontext von psychopathologischen Erscheinungsbildern wie Depression.
Schlüsselwörter
Personenzentrierte Therapie, Adoleszenz, Persönlichkeitsentwicklung, Selbstkonzept, Identität, Inkongruenz, Selbstaktualisierung, Entwicklungsaufgaben, Pubertät, Psychopathologie, Depression.
Details
- Titel
- Personenzentrierte Therapieform mit Jugendlichen zur Förderung der Persönlichkeitsentwicklung in der Adoleszenz
- Hochschule
- Johannes Gutenberg-Universität Mainz (Pädagogisches Institut)
- Note
- 2,6
- Autor
- Doris Lehmitz (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2007
- Seiten
- 135
- Katalognummer
- V89750
- ISBN (eBook)
- 9783638036474
- ISBN (Buch)
- 9783638935272
- Dateigröße
- 877 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Personenzentrierte Therapieform Jugendlichen Förderung Persönlichkeitsentwicklung Adoleszenz
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 39,99
- Preis (Book)
- US$ 50,99
- Arbeit zitieren
- Doris Lehmitz (Autor:in), 2007, Personenzentrierte Therapieform mit Jugendlichen zur Förderung der Persönlichkeitsentwicklung in der Adoleszenz, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/89750
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-