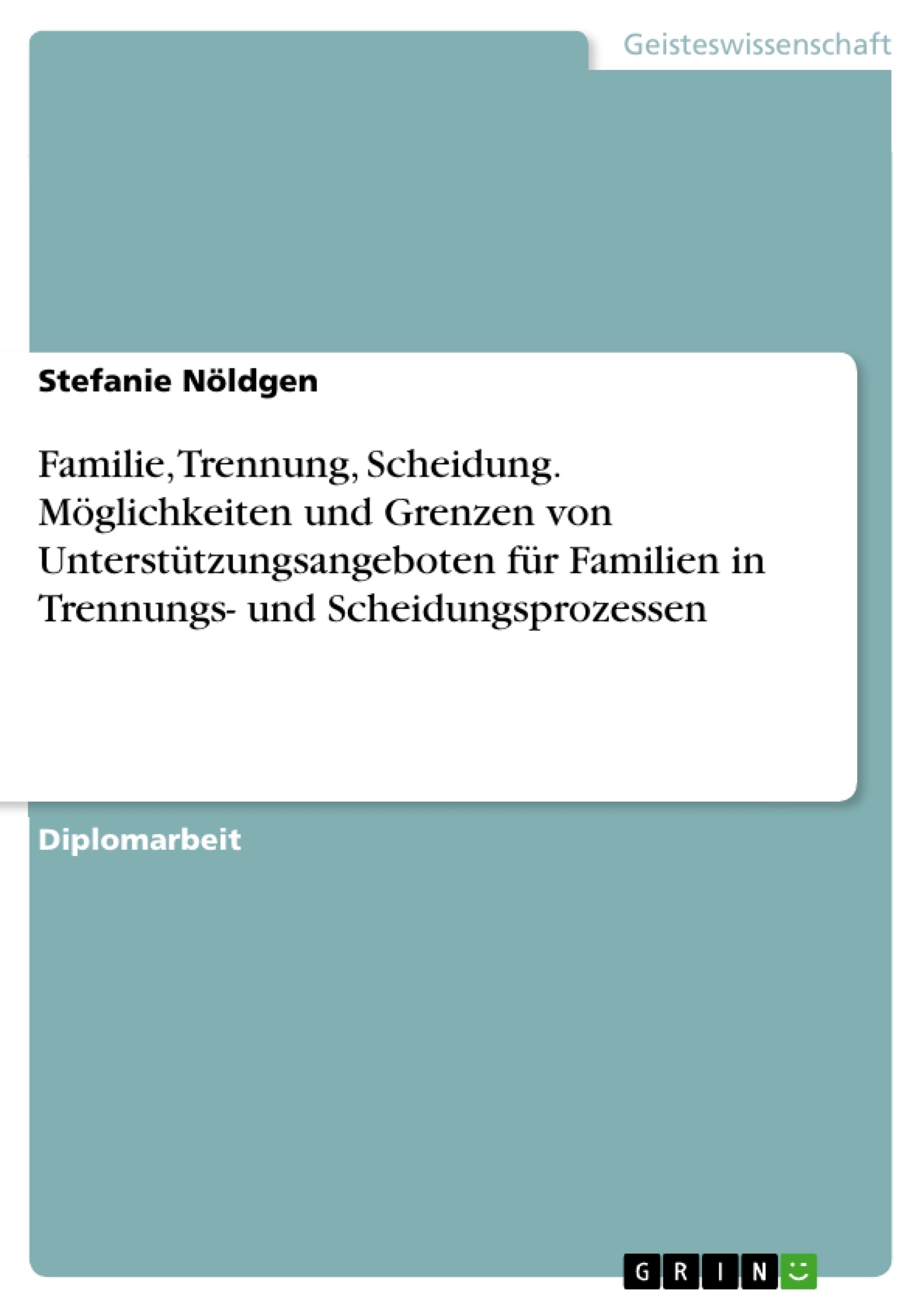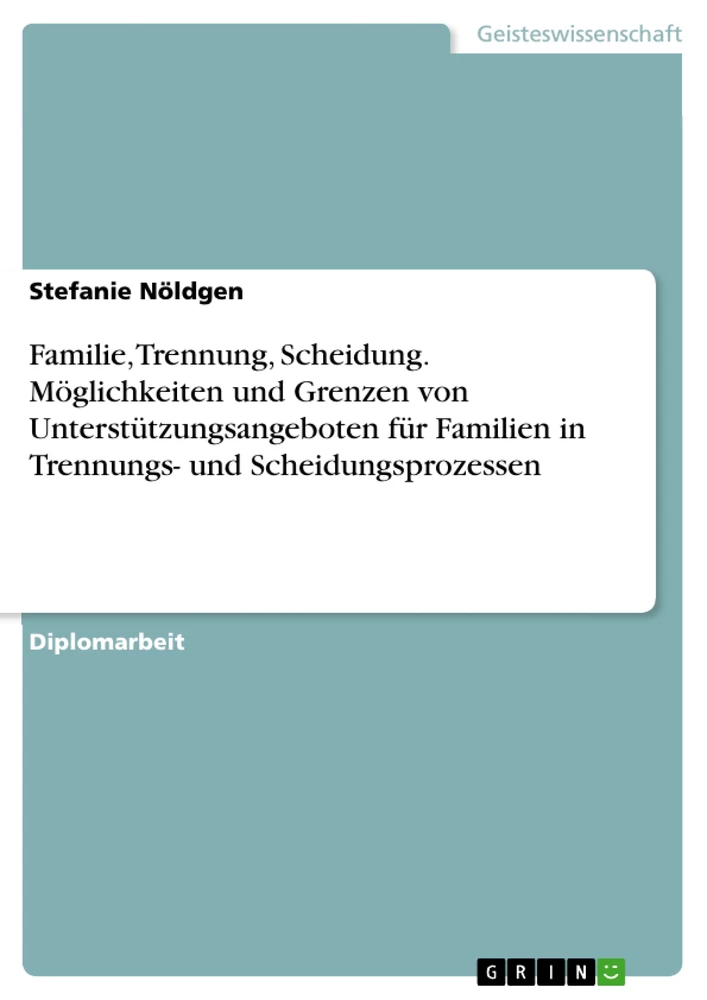
Familie, Trennung, Scheidung. Möglichkeiten und Grenzen von Unterstützungsangeboten für Familien in Trennungs- und Scheidungsprozessen
Diplomarbeit, 2006
288 Seiten, Note: 1,0
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- I FAMILIE
- 1 Annäherung an den Begriff „Familie“
- 1.1 Familienbegriffe
- 1.2 Annäherung an den in dieser Arbeit verwendeten Familienbegriff
- 2 Familie und Ehe im Wandel
- 3 Kennzeichen des aktuellen Wandels
- 3.1 Wandel der Einstellung zur Ehe
- 3.1.1 Gesellschaftliche Veränderungen zeigen Einstellungswandel an
- 3.1.2 Bedeutungswandel der Institution Ehe
- 3.2 Veränderte Erwartungen an Familie
- 3.3 Steigende Pluralität der Familienformen und Individualisierung
- 3.4 Zeitliche Veränderungen der Lebens- und Familienzyklen
- 3.5 Veränderung der Rollen von Vater und Mutter
- 3.6 Kindheit und Rolle des Kindes im Wandel
- 4 Familie und Gewalt
- 4.1 Annäherung an den Begriff „Gewalt“
- 4.2 Physische Gewalt
- 4.3 Weitere Gewaltformen
- II TRENNUNG UND SCHEIDUNG
- 1 Veränderte Sichtweise auf Trennung und Scheidung
- 2 Trennungs- und Scheidungsursachen
- 2.1 Wertwandel in der Sinnzuschreibung an Ehe und Partnerschaft
- 2.2 Abnahme traditioneller Rollenvorgaben
- 2.3 Veränderung der Partnerbeziehung nach Übergang zur Elternschaft
- 3 Trennungs- und Scheidungszyklus
- 3.1 Vorscheidungsphase
- 3.1.1 Verschlechterung der Partnerbeziehung
- 3.1.2 Entscheidungskonflikte
- 3.1.3 Entscheidung zur Trennung ist revidierbar
- 3.2 Scheidungsphase
- 3.2.1 Situation und Reaktionen der Erwachsenen allgemein
- 3.2.2 Situation und Reaktionen der Erwachsenen nach Alter und Geschlecht
- 3.2.3 Beziehung zwischen den getrennt lebenden Partnern in der Scheidungsphase
- 3.2.4 Neue Partnerbeziehungen
- 3.2.5 Situation und Reaktionen der Kinder allgemein
- 3.2.6 Situation und Reaktionen der Kinder nach Alter und Geschlecht
- 3.2.7 Geschwisterbeziehungen
- 3.2.8 Eltern-Kind-Beziehungen in der Scheidungsphase
- 3.2.9 Zeitraum der gerichtlichen Scheidung
- 3.3 Nachscheidungsphase
- 3.3.1 Psychische Scheidung
- 3.3.2 Beziehung zwischen den getrennt lebenden Partnern in der Nachscheidungsphase
- 3.3.3 Eltern-Kind-Beziehungen in der Nachscheidungsphase
- 3.3.4 Ablösung der Partner- von der Elternrolle und Reorganisation
- 3.3.5 Patchworkfamilien
- 4 Günstige und ungünstige Trennungs- und Scheidungsverläufe
- 4.1 Schutz- und Risikofaktoren für die Kinder
- 4.2 Was Kinder sich von ihren getrennten Eltern wünschen
- 4.3 Schutz- und Risikofaktoren für die Erwachsenen
- 4.4 Zusammenspiel von Schutz- und Risikofaktoren
- III UNTERSTÜTZUNGSANGEBOTE BEI TRENNUNG UND SCHEIDUNG
- 1 Unterstützung durch soziale Netzwerke
- 1.1 Unterstützung durch verwandtschaftliche Netzwerke
- 1.2 Unterstützung durch Selbsthilfegruppen
- 2 Unterstützung durch professionelle Angebote
- 2.1 Beratungsangebote allgemein
- 2.2 Scheidungsberatung
- 2.3 Mediation
- 2.4 Gruppenintervention für Kinder aus Trennungs- und Scheidungsfamilien
- 3 Möglichkeiten und Grenzen von Unterstützungsangeboten
- IV EMPIRISCHER TEIL: INTERVIEWS MIT BETROFFENEN
- 1 Vorüberlegungen und methodisches Vorgehen
- 2 Auswertung der Interviews
- 2.1 Beginn der Beziehung bzw. Familiengründung
- 2.2 Vorscheidungsphase
- 2.2.1 Verschlechterung der Partnerbeziehung
- 2.2.2 Entscheidungskonflikte
- 2.2.3 Entscheidung zur Trennung ist revidierbar
- 2.3 Scheidungsphase
- 2.3.1 Trennung
- 2.3.2 Situation und Reaktionen der Erwachsenen
- 2.3.3 Situation und Reaktionen der Kinder
- 2.3.4 Zeit der gerichtlichen Scheidung
- 2.4 Nachscheidungsphase / heute
- 2.4.1 Beziehung zwischen den ehemaligen Partnern
- 2.4.2 Eltern-Kind-Beziehungen
- 2.4.3 Beziehungen in Patchworkfamilien
- 2.4.4 Neue Partnerbeziehungen
- 2.5 Möglichkeiten und Grenzen von Unterstützungsangeboten
- 3 Ausblick
- Wandel des Familien- und Eheverständnisses
- Trennungs- und Scheidungsprozesse: Ursachen und Auswirkungen auf Erwachsene und Kinder
- Analyse verschiedener Unterstützungsangebote
- Bewertung der Wirksamkeit von Unterstützungsmaßnahmen
- Perspektiven für zukünftige Hilfestellungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Möglichkeiten und Grenzen von Unterstützungsangeboten für Familien in Trennungs- und Scheidungsprozessen. Sie beleuchtet den Wandel von Familie und Ehe und analysiert die Herausforderungen, denen Betroffene in diesen Phasen begegnen. Die Arbeit basiert auf einer empirischen Untersuchung mittels Interviews.
Zusammenfassung der Kapitel
I FAMILIE: Dieses Kapitel liefert eine umfassende Einführung in den Familienbegriff und seine Entwicklung. Es werden verschiedene Familienmodelle diskutiert und der in der Arbeit verwendete Familienbegriff definiert. Der Fokus liegt auf dem Wandel von Familie und Ehe, den veränderten Erwartungen an Familienstrukturen und der zunehmenden Pluralität von Familienformen. Die Bedeutung von gesellschaftlichen Veränderungen, der Individualisierung und des Wandels in den Rollen von Vater und Mutter werden eingehend betrachtet. Schließlich wird das Thema Gewalt in Familien beleuchtet, mit einer Definition verschiedener Gewaltformen und deren Auswirkungen.
II TRENNUNG UND SCHEIDUNG: Kapitel II analysiert die veränderte gesellschaftliche Sichtweise auf Trennung und Scheidung. Es werden die Ursachen von Trennungen und Scheidungen erörtert, insbesondere der Wertwandel in der Sinnzuschreibung an Ehe und Partnerschaft, die Abnahme traditioneller Rollenvorgaben und Veränderungen in der Partnerbeziehung nach der Geburt von Kindern. Der Trennungs- und Scheidungszyklus wird in seine Phasen (Vorscheidung, Scheidung, Nachscheidung) unterteilt und jeweils im Hinblick auf die Auswirkungen auf Erwachsene und Kinder detailliert untersucht. Besondere Aufmerksamkeit wird den Beziehungen zwischen den getrennt lebenden Partnern, den Eltern-Kind-Beziehungen und der Entstehung von Patchworkfamilien gewidmet. Schließlich werden günstige und ungünstige Verläufe von Trennungen und Scheidungen im Hinblick auf Schutz- und Risikofaktoren für Erwachsene und Kinder beleuchtet.
III UNTERSTÜTZUNGSANGEBOTE BEI TRENNUNG UND SCHEIDUNG: Das dritte Kapitel befasst sich mit den Möglichkeiten der Unterstützung für Familien in Trennungssituationen. Es werden sowohl informelle Unterstützungsnetzwerke (Verwandte, Selbsthilfegruppen) als auch professionelle Angebote (Beratung, Mediation, Gruppeninterventionen) vorgestellt und hinsichtlich ihrer Wirksamkeit und Grenzen analysiert. Der Fokus liegt auf der Frage, welche Unterstützung in welchen Phasen des Trennungs- und Scheidungsprozesses hilfreich sein kann und welche Faktoren die Akzeptanz und den Erfolg von Unterstützungsmaßnahmen beeinflussen.
Schlüsselwörter
Familie, Ehe, Trennung, Scheidung, Wandel, Individualisierung, Gewalt, Unterstützungsangebote, Beratung, Mediation, Kinder, Erwachsene, Patchworkfamilien, Schutzfaktoren, Risikofaktoren, empirische Untersuchung, Interviews.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse von Trennungs- und Scheidungsprozessen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Möglichkeiten und Grenzen von Unterstützungsangeboten für Familien in Trennungs- und Scheidungsprozessen. Sie beleuchtet den Wandel von Familie und Ehe und analysiert die Herausforderungen für Betroffene in diesen Phasen anhand einer empirischen Untersuchung mittels Interviews.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit behandelt den Wandel des Familien- und Eheverständnisses, Trennungs- und Scheidungsprozesse (Ursachen und Auswirkungen auf Erwachsene und Kinder), verschiedene Unterstützungsangebote, die Bewertung deren Wirksamkeit und Perspektiven für zukünftige Hilfestellungen. Es werden verschiedene Familienmodelle diskutiert, der Begriff "Gewalt in der Familie" definiert und der Trennungs- und Scheidungszyklus in seine Phasen (Vorscheidung, Scheidung, Nachscheidung) unterteilt und detailliert untersucht.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in vier Kapitel gegliedert: Kapitel I behandelt den Familienbegriff und seinen Wandel, Kapitel II analysiert Trennungs- und Scheidungsprozesse, Kapitel III befasst sich mit Unterstützungsangeboten und Kapitel IV präsentiert die Ergebnisse einer empirischen Untersuchung mittels Interviews mit Betroffenen. Jedes Kapitel ist in Unterkapitel mit detaillierten Unterpunkten unterteilt, wie im Inhaltsverzeichnis ersichtlich.
Welche Methoden wurden verwendet?
Die Arbeit basiert auf einer empirischen Untersuchung. Die Datenerhebung erfolgte mittels Interviews mit Betroffenen von Trennungs- und Scheidungsprozessen. Die Auswertung der Interviews konzentriert sich auf die verschiedenen Phasen des Trennungs- und Scheidungsprozesses und die Erfahrungen der Beteiligten mit Unterstützungsangeboten.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Kapitel IV präsentiert die Auswertung der Interviews mit Betroffenen, die sich auf die verschiedenen Phasen des Trennungs- und Scheidungsprozesses (Beginn der Beziehung, Vorscheidungsphase, Scheidungsphase, Nachscheidungsphase) und die Erfahrungen mit Unterstützungsangeboten konzentriert. Die Ergebnisse werden im Detail in den Unterkapiteln zu den jeweiligen Phasen beschrieben.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Arbeit kommt zu Schlussfolgerungen über die Wirksamkeit und die Grenzen der verschiedenen Unterstützungsangebote für Familien in Trennungs- und Scheidungsprozessen. Es werden Perspektiven für zukünftige Hilfestellungen aufgezeigt und die Bedeutung von Schutz- und Risikofaktoren für Erwachsene und Kinder hervorgehoben.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Familie, Ehe, Trennung, Scheidung, Wandel, Individualisierung, Gewalt, Unterstützungsangebote, Beratung, Mediation, Kinder, Erwachsene, Patchworkfamilien, Schutzfaktoren, Risikofaktoren, empirische Untersuchung, Interviews.
Details
- Titel
- Familie, Trennung, Scheidung. Möglichkeiten und Grenzen von Unterstützungsangeboten für Familien in Trennungs- und Scheidungsprozessen
- Hochschule
- Technische Hochschule Köln, ehem. Fachhochschule Köln
- Note
- 1,0
- Autor
- Stefanie Nöldgen (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2006
- Seiten
- 288
- Katalognummer
- V90356
- ISBN (eBook)
- 9783638042666
- ISBN (Buch)
- 9783640435715
- Dateigröße
- 2856 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Familie Trennung Scheidung Möglichkeiten Grenzen Unterstützungsangeboten Patchworkfamilie Partnerbeziehung Familienzyklus Rollenvorgaben Wertwandel der Familie Reorganisation Schutzfaktoren Risikofaktoren Anforderungen an Familie Erwartungen an Familie moderne Familie Trennungsprozess Scheidungsprozess psychische Scheidung Familienbegriff Pluralität Individualisierung Familienformen gesellschaftliche Veränderungen Institution Ehe Trennungsursachen Scheidungsursachen Vaterrolle Mutterrolle Rolle des Kindes Familie und Gewalt Kindheit Wertwandel in der Sinnzuschreibung an Ehe und Partnerschaft Trennungszyklus Scheidungszyklus traditionelle Rollenvorgaben Verschlechterung der Partnerbeziehung Eltern-Kind-Beziehung gerichtliche Scheidung soziale Netzwerke Vorscheidungsphase Scheidungsphase Nachscheidungsphase Beratung Mediation Gruppenintervention Scheidungsberatung verwandtschaftliche Netzwerke Selbsthilfegruppen Ablösung der Partner- von der Elternrolle und Reorganisation Netzwerke soziale Gemeinschaft Familie als Schutzraum Familie als Entwicklungsraum Familie als Regenerationsraum Idealbild der Familie traditionelle Familie Kernfamilie Trennungsverlauf Scheidungsverlauf Ehemodell Deinstitutionalisierung Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 41,99
- Preis (Book)
- US$ 54,99
- Arbeit zitieren
- Stefanie Nöldgen (Autor:in), 2006, Familie, Trennung, Scheidung. Möglichkeiten und Grenzen von Unterstützungsangeboten für Familien in Trennungs- und Scheidungsprozessen, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/90356
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-