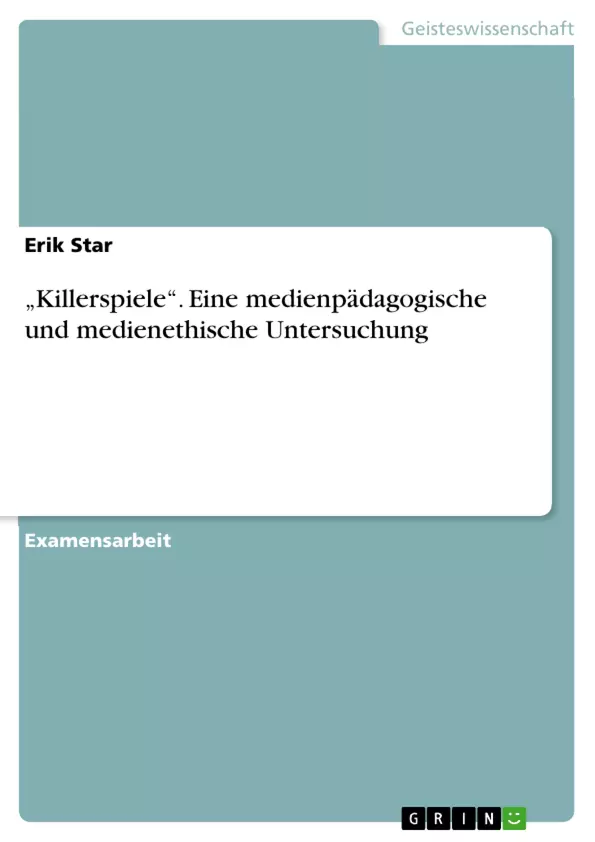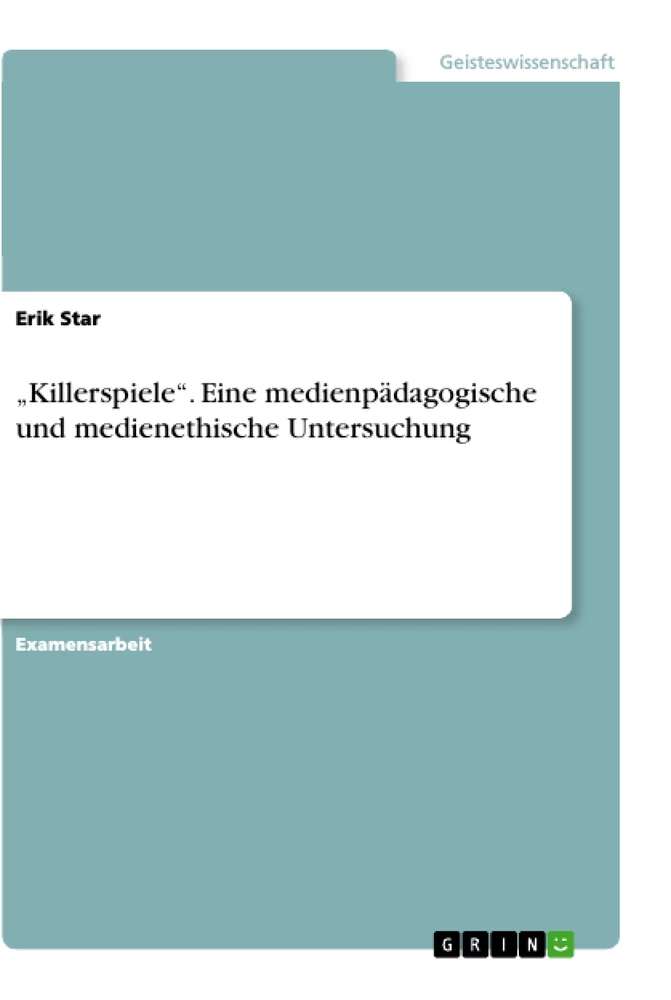
„Killerspiele“. Eine medienpädagogische und medienethische Untersuchung
Examensarbeit, 2020
91 Seiten, Note: 1,0
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- 1. Die vermeintliche Gefahr: das Killerspiel
- 2. Darstellung
- 2.1. Historischer Verlauf der Debatte
- 2.2. Terminologie und Elemente des digitalen Spiels
- 2.2.1. Begriffe
- 2.2.1.1. Das Spiel
- 2.2.1.2. Das Spiel als Medium
- 2.2.1.3. Das digitale Spiel
- 2.2.1.4. Das „Killerspiel“
- 2.2.2. Erklärung grundlegender Elemente von digitalen Spielen
- 2.2.2.1. Genres
- 2.2.2.2. Wichtige Elemente des digitalen Spiels
- 2.3. Relevanz des digitalen Spiels
- 2.3.1. Studienlage: Beliebtheit von digitalen Spielen
- 2.3.2. Auswahl populärer violenter digitaler Spiele der Gegenwart
- 3. Medienpädagogische Betrachtung
- 3.1. Grundlegende Erklärungen zum Aufgabenfeld der Medienpädagogik
- 3.2. Sozialwissenschaftlicher Blick auf die Auswirkungen von violenten digitalen Spielen
- 3.2.1. Nutzungsmotive und Wirkungstheorien
- 3.2.2. Studienlage und Probleme der empirischen Forschung an digitalen Spielen
- 3.3. Zusammenfassung
- 4. Medienethische Betrachtung
- 4.1. Grundlegende Erklärungen zur philosophischen Ethik
- 4.1.1. Drei Denkrichtungen der normativen Ethik
- 4.1.1.1. Deontologie
- 4.1.1.2. Utilitarismus
- 4.1.1.3. Tugendethik
- 4.1.2. Angewandte Ethik
- 4.1.3. Medienethik
- 4.2. Moralische Aspekte des violenten digitalen Spielens
- 4.3. Moralische Aspekte im violenten digitalen Spiel
- 4.3.1. Unterscheidung zwischen Player und Gamer
- 4.3.2. Spezifizierung: Einzelspieler
- 4.3.3. Spezifizierung: Mehrspieler
- 5. Konsequenzen der vorherigen Betrachtungen
- 6. Die eigentliche Gefahr: Ahnungslosigkeit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die medienpädagogischen und -ethischen Aspekte von "Killerspielen", insbesondere im Hinblick auf die öffentliche Debatte und deren wissenschaftliche Fundierung. Die Arbeit analysiert den historischen Verlauf der Debatte, definiert relevante Begriffe und beleuchtet die gesellschaftliche Relevanz digitaler Spiele.
- Historischer Diskurs um "Killerspiele" in Deutschland
- Definition und Kontextualisierung von Begriffen wie "Spiel", "Medium", und "digitales Spiel"
- Medienpädagogische Analyse der Wirkung von gewaltdarstellenden Spielen
- Medienethische Betrachtung unter verschiedenen ethischen Perspektiven
- Konsequenzen für die Medienpädagogik und den Umgang mit gewaltdarstellenden Spielen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Die vermeintliche Gefahr: das Killerspiel: Die Einleitung stellt die kontroverse Debatte um "Killerspiele" vor, ausgelöst durch reale Gewalttaten und den vermeintlichen Zusammenhang mit dem Konsum gewaltdarstellender Videospiele. Der Autor, selbst erfahrener Spieler, kündigt seine wissenschaftliche Untersuchung an, die den medienpädagogischen und -ethischen Aspekt beleuchtet. Die Arbeit gliedert sich in eine Darstellung der Debatte, eine Klärung wichtiger Begriffe, eine medienpädagogische und eine medienethische Analyse, sowie Schlussfolgerungen.
2. Darstellung: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über den Diskurs rund um "Killerspiele". Es skizziert den historischen Verlauf der Debatte in Deutschland, zeigt die zunehmende Intensität und den häufig unsachlichen Ton der Diskussion auf, beleuchtet die fehlende Expertise vieler Beteiligter und die unterschiedlichen Meinungen der Spielcommunity. Die Kapitel legen den Fokus auf Begriffsklärungen, um ein Verständnis für das folgende Kapitel zu schaffen.
2.1 Historischer Verlauf der Debatte: Dieser Abschnitt liefert einen detaillierten chronologischen Überblick über die "Killerspiel"-Debatte in Deutschland, beginnend mit frühen Beispielen wie "Death Race" und der Eskalation nach dem Amoklauf an der Columbine High School. Es werden verschiedene Amokläufe in Deutschland genannt und die darauf folgenden Reaktionen von Politikern und Wissenschaftlern analysiert, wobei auf die teilweise unsachlichen und emotionalen Argumente hingewiesen wird. Es wird zudem deutlich, dass die Kritik an gewaltdarstellenden Medien nicht neu ist und auch Filme oder Comics betroffen waren.
2.2 Terminologie und Elemente des digitalen Spiels: Dieses Kapitel definiert zentrale Begriffe und erklärt grundlegende Elemente des digitalen Spiels für ein nicht-spielerisches Publikum. Es behandelt die Definition des Spiels an sich (Regelhaftigkeit, Andersartigkeit, Abgeschlossenheit, Wiederholbarkeit etc.), das Spiel als Medium, das digitale Spiel (technische Aspekte, audiovisuelle Erfahrung, Immersion), und schließlich den umstrittenen Begriff "Killerspiel".
2.3 Relevanz des digitalen Spiels: Dieser Teil belegt die gesellschaftliche Relevanz von digitalen Spielen mit Daten aus JIM- und KIM-Studien, die den Spielkonsum von Kindern und Jugendlichen in Deutschland aufzeigen. Es werden Unterschiede in der Spielhäufigkeit und den Spielpräferenzen zwischen Geschlechtern und Altersgruppen hervorgehoben. Abschließend werden drei populäre gewaltdarstellende Spiele ("Fortnite", "Counter-Strike", "Grand Theft Auto V") vorgestellt und deren Bedeutung erläutert.
3. Medienpädagogische Betrachtung: In diesem Kapitel wird der Einfluss gewaltdarstellender Videospiele auf Kinder und Jugendliche aus medienpädagogischer Sicht untersucht. Zunächst wird das Aufgabenfeld der Medienpädagogik erklärt, mit einem Fokus auf Bewahrungs- und Bildungspädagogik. Im Anschluss werden relevante Nutzungsmotive und Wirkungstheorien (Katharsisthese, Wirkungslosigkeit, Suggestionsthese, Habitualisierungsthese, etc.) vorgestellt, gefolgt von einer kritischen Diskussion der Studienlage und den methodischen Problemen der empirischen Forschung.
4. Medienethische Betrachtung: Dieses Kapitel untersucht die ethischen Fragen im Umgang mit gewaltdarstellenden Videospielen. Zunächst werden grundlegende Begriffe der philosophischen Ethik (Ethik, Moral, deskriptive, normative und meta-ethische Perspektive) erläutert, sowie drei wichtige Strömungen der normativen Ethik (Deontologie, Utilitarismus, Tugendethik). Die angewandte Ethik und die Medienethik werden definiert. Anschließend werden die moralischen Aspekte des Spielens gewaltdarstellender Spiele und die moralische Beurteilbarkeit von Spielhandlungen diskutiert.
5. Konsequenzen der vorherigen Betrachtungen: Dieses Kapitel zieht Schlussfolgerungen aus den vorherigen Analysen und argumentiert, dass die negative öffentliche Meinung über "Killerspiele" überzogen ist. Es fordert eine Verbesserung der Forschungsmethoden, eine umfassendere Betrachtung der positiven Effekte von Videospielen und die Förderung von Medienkompetenz bei Kindern und Jugendlichen.
Schlüsselwörter
Killerspiele, Medienpädagogik, Medienethik, Digitale Spiele, Gewalt, Aggression, Immersion, Gamer, Player, Moral, Ethik, Deontologie, Utilitarismus, Tugendethik, JIM-Studie, KIM-Studie, Medienkompetenz, Kausalität, Korrelation, Habitualisierung, Flow-Erlebnis, Gewaltforschung, Spieltheorie, Verantwortung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Die vermeintliche Gefahr: das Killerspiel"
Was ist der Gegenstand der vorliegenden Arbeit?
Die Arbeit untersucht die medienpädagogischen und -ethischen Aspekte von sogenannten "Killerspielen". Sie analysiert die öffentliche Debatte um diese Spiele, beleuchtet deren wissenschaftliche Fundierung und befasst sich mit dem historischen Verlauf dieser Diskussion. Ein Schwerpunkt liegt auf der Definition relevanter Begriffe und der gesellschaftlichen Relevanz von digitalen Spielen.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt den historischen Diskurs um "Killerspiele" in Deutschland, definiert und kontextualisiert Begriffe wie "Spiel", "Medium" und "digitales Spiel", analysiert medienpädagogisch die Wirkung gewaltdarstellender Spiele, betrachtet diese Spiele aus medienethischer Sicht unter verschiedenen ethischen Perspektiven und zieht abschließend Konsequenzen für die Medienpädagogik und den Umgang mit gewaltdarstellenden Spielen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in mehrere Kapitel: Einleitung (Die vermeintliche Gefahr: das Killerspiel), Darstellung (mit Unterkapiteln zum historischen Verlauf der Debatte, zur Terminologie und den Elementen digitaler Spiele sowie zur Relevanz digitaler Spiele), medienpädagogische Betrachtung, medienethische Betrachtung, Konsequenzen der vorherigen Betrachtungen und Schlussfolgerung (Die eigentliche Gefahr: Ahnungslosigkeit). Jedes Kapitel behandelt spezifische Aspekte der Debatte und liefert detaillierte Analysen.
Welche Begriffe werden definiert und erklärt?
Die Arbeit definiert und erklärt zentrale Begriffe wie "Spiel", "Medium", "digitales Spiel", und "Killerspiel". Sie differenziert zwischen "Player" und "Gamer" und erläutert grundlegende Elemente digitaler Spiele wie Genres und wichtige Spieleeigenschaften. Zusätzlich werden medienpädagogische und medienethische Konzepte wie verschiedene Wirkungstheorien (Katharsisthese, Wirkungslosigkeit, Suggestionsthese, Habitualisierungsthese) und ethische Denkrichtungen (Deontologie, Utilitarismus, Tugendethik) erläutert.
Welche Studien und Daten werden verwendet?
Die Arbeit bezieht sich auf Daten aus JIM- und KIM-Studien, um die gesellschaftliche Relevanz und die Verbreitung von digitalen Spielen bei Kindern und Jugendlichen in Deutschland aufzuzeigen. Sie diskutiert zudem die Studienlage zur Wirkung gewaltdarstellender Spiele und die methodischen Herausforderungen der empirischen Forschung in diesem Bereich.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit argumentiert, dass die negative öffentliche Meinung über "Killerspiele" oft überzogen ist und plädiert für eine Verbesserung der Forschungsmethoden, eine umfassendere Betrachtung der positiven Effekte von Videospielen und die Förderung von Medienkompetenz bei Kindern und Jugendlichen. Sie betont die Notwendigkeit eines differenzierten und sachlichen Umgangs mit dem Thema.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter, die die Arbeit prägnant beschreiben, sind: Killerspiele, Medienpädagogik, Medienethik, Digitale Spiele, Gewalt, Aggression, Immersion, Gamer, Player, Moral, Ethik, Deontologie, Utilitarismus, Tugendethik, JIM-Studie, KIM-Studie, Medienkompetenz, Kausalität, Korrelation, Habitualisierung, Flow-Erlebnis, Gewaltforschung, Spieltheorie, Verantwortung.
Details
- Titel
- „Killerspiele“. Eine medienpädagogische und medienethische Untersuchung
- Hochschule
- Universität Rostock
- Note
- 1,0
- Autor
- Erik Star (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2020
- Seiten
- 91
- Katalognummer
- V904077
- ISBN (eBook)
- 9783346198334
- ISBN (Buch)
- 9783346198341
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Killerspiel Killerspiele Medienpädagogik Medienethik Ethik Amok Amoklauf Videospiele Fortnite Counter-Strike Computerspiel Videospiel Computerspiele Philosophie Aggression GTA Battle Royal Töten Kant Mill Utilitarismus Pflichtethik Tugendethik Bentham Aristoteles Ferguson
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 38,99
- Preis (Book)
- US$ 49,99
- Arbeit zitieren
- Erik Star (Autor:in), 2020, „Killerspiele“. Eine medienpädagogische und medienethische Untersuchung, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/904077
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-