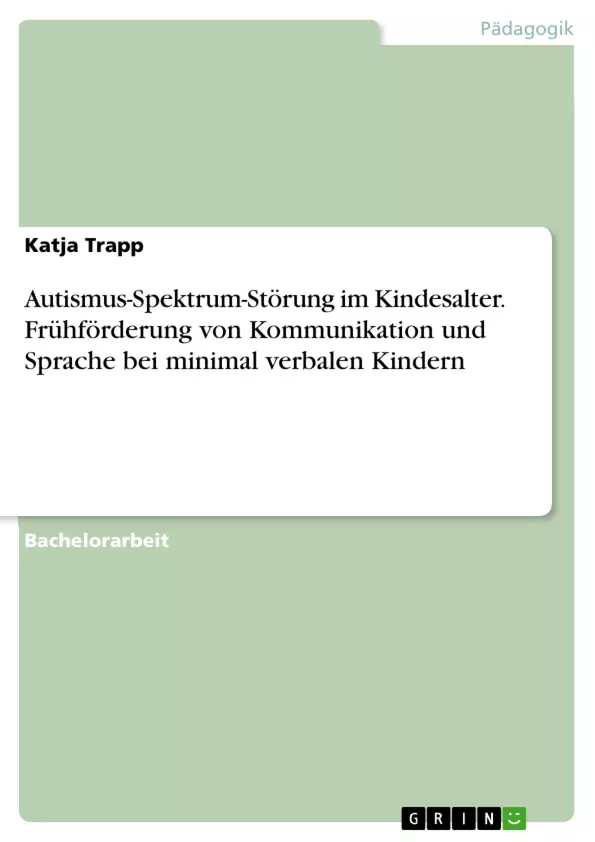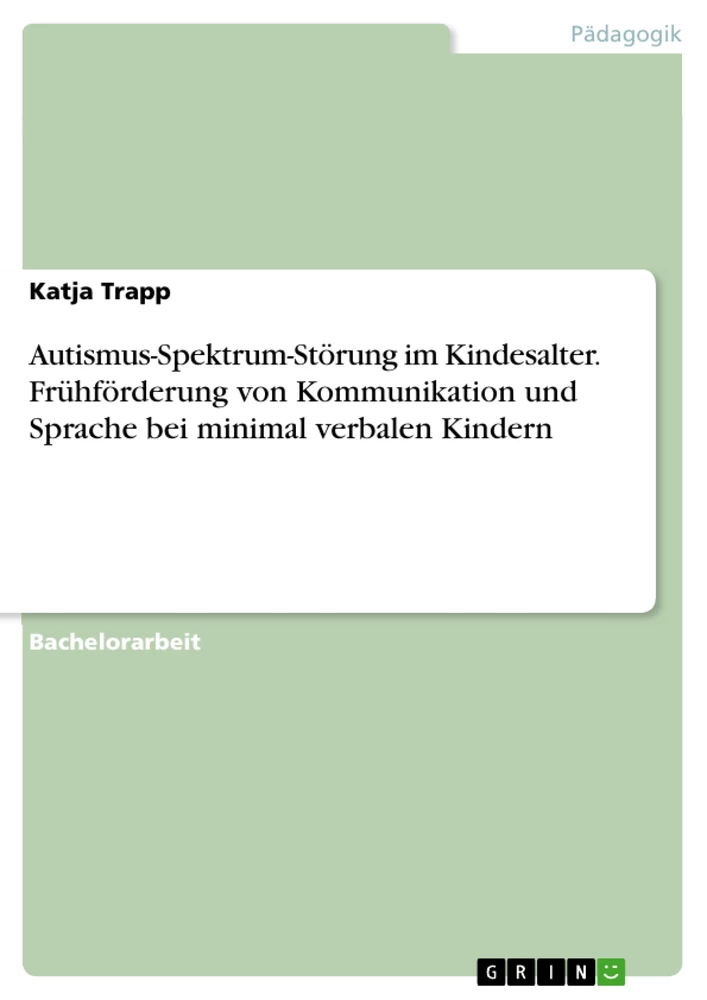
Autismus-Spektrum-Störung im Kindesalter. Frühförderung von Kommunikation und Sprache bei minimal verbalen Kindern
Bachelorarbeit, 2019
51 Seiten, Note: 2,0
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Definitionen und Klassifikation
- 2.1. Die autistische Störung als tiefgreifende Entwicklungsstörung
- 2.2. Historische Betrachtung der Autismusforschung
- 2.3. Frühkindlicher Autismus
- 2.4. Atypischer Autismus
- 2.5. Epidemiologie
- 3. Auffälligkeiten im Sprachverständnis und Sprachgebrauch
- 3.1. Sprache und Kommunikation
- 3.2. Spezifische Sprachentwicklungsstörung
- 3.3. Sprachdiagnostik bei Kindern mit ASS
- 3.4. Sprachliche Besonderheiten der Störung
- 3.4.1. Phoneme
- 3.4.2. Echolalie
- 3.4.3. Prosodie
- 3.4.4. Pragmatik
- 3.4.5. Mutismus
- 4. Ansätze zur sprachlichen Förderung
- 4.1. Früherkennung und Frühförderung
- 4.2. Individuelle Sprachtherapien
- 4.3. Der TEACCH-Ansatz
- 4.4. Aufmerksamkeits-Interaktions-Therapie (AIT)
- 4.5. Förderprogramme
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit zielt darauf ab, ein umfassendes Verständnis für die Autismus-Spektrum-Störung (ASS) im Kindesalter zu vermitteln, mit besonderem Fokus auf die Förderung von Kommunikation und Sprache bei minimal verbalen Kindern.
- Definition und Klassifikation der Autismus-Spektrum-Störung
- Auffälligkeiten im Sprachverständnis und Sprachgebrauch bei Kindern mit ASS
- Ansätze zur sprachlichen Förderung von Kindern mit ASS
- Bedeutung der frühen Intervention für die sprachliche Entwicklung von Kindern mit ASS
- Vorstellung verschiedener Therapie- und Förderprogramme zur Verbesserung der kommunikativen Fähigkeiten
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Die Einleitung stellt die Thematik der Arbeit und die Relevanz des Themas "Autismus-Spektrum-Störung im Kindesalter" vor. Außerdem wird der Fokus auf die Förderung von Kommunikation und Sprache bei minimal verbalen Kindern gelegt.
- Kapitel 2: Dieses Kapitel befasst sich mit Definitionen und Klassifikation der Autismus-Spektrum-Störung, inklusive einer historischen Betrachtung der Autismusforschung sowie der verschiedenen Formen des „Infantilen Autismus“ und des „Atypischen Autismus“.
- Kapitel 3: In diesem Kapitel werden Auffälligkeiten im Sprachverständnis und Sprachgebrauch bei Kindern mit ASS im Detail beleuchtet. Es werden die Themen Sprache und Kommunikation, spezifische Sprachentwicklungsstörungen, Sprachdiagnostik und sprachliche Besonderheiten der Störung behandelt.
- Kapitel 4: Das vierte Kapitel widmet sich verschiedenen Ansätzen zur sprachlichen Förderung von Kindern mit ASS. Es werden Früherkennung und Frühförderung, individuelle Sprachtherapien, der TEACCH-Ansatz, die Aufmerksamkeits-Interaktions-Therapie (AIT) und weitere Förderprogramme vorgestellt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt die Themen Autismus-Spektrum-Störung, Frühförderung, Kommunikation, Sprache, Sprachentwicklung, Sprachdiagnostik, Sprachtherapie, TEACCH-Ansatz, Aufmerksamkeits-Interaktions-Therapie (AIT), Förderprogramme und minimal verbale Kinder.
Details
- Titel
- Autismus-Spektrum-Störung im Kindesalter. Frühförderung von Kommunikation und Sprache bei minimal verbalen Kindern
- Hochschule
- Philipps-Universität Marburg
- Note
- 2,0
- Autor
- Katja Trapp (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2019
- Seiten
- 51
- Katalognummer
- V921476
- ISBN (eBook)
- 9783346247957
- ISBN (Buch)
- 9783346247964
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- autismus-spektrum-störung kindesalter frühförderung kommunikation sprache kindern
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 20,99
- Preis (Book)
- US$ 29,99
- Arbeit zitieren
- Katja Trapp (Autor:in), 2019, Autismus-Spektrum-Störung im Kindesalter. Frühförderung von Kommunikation und Sprache bei minimal verbalen Kindern, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/921476
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-