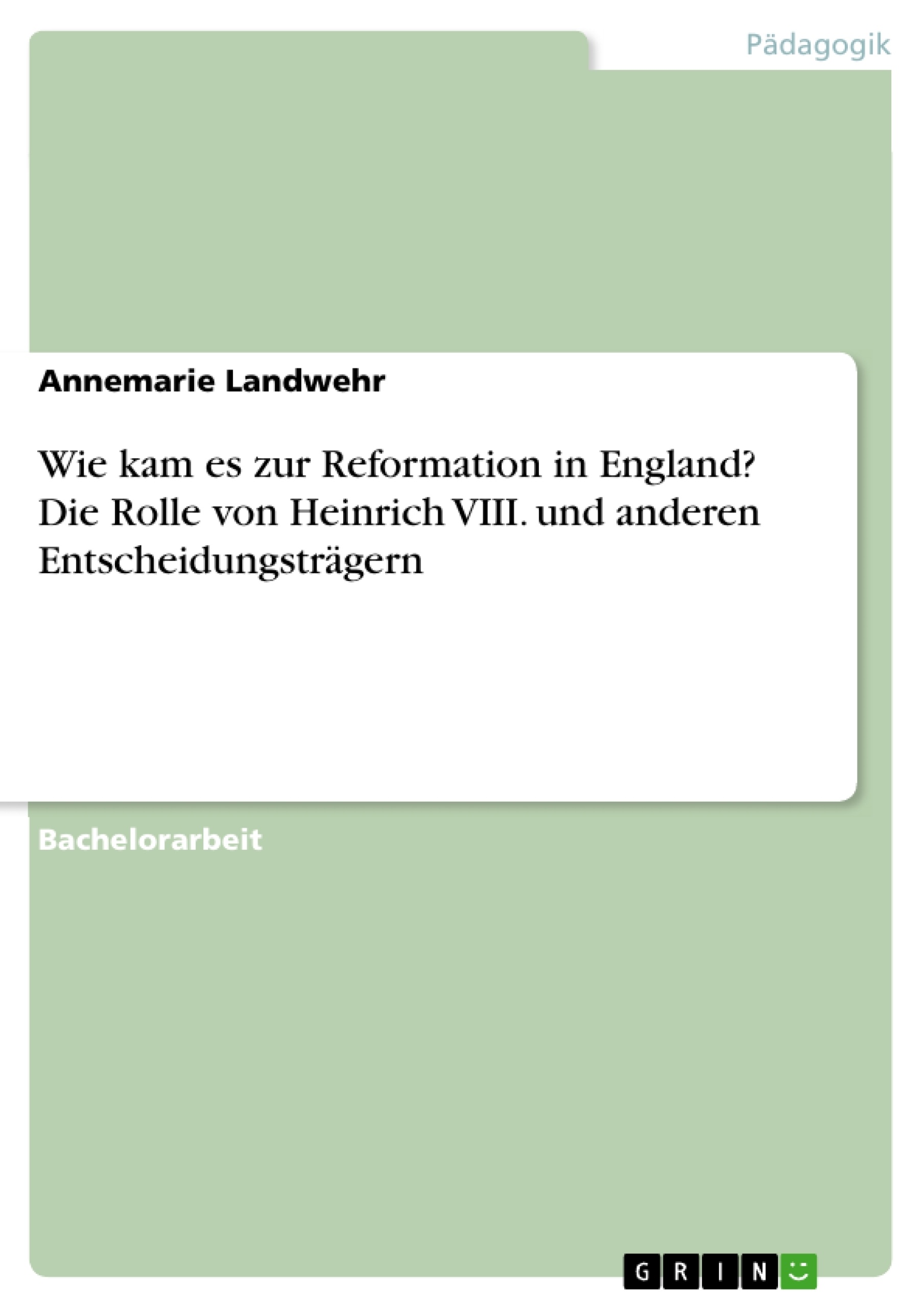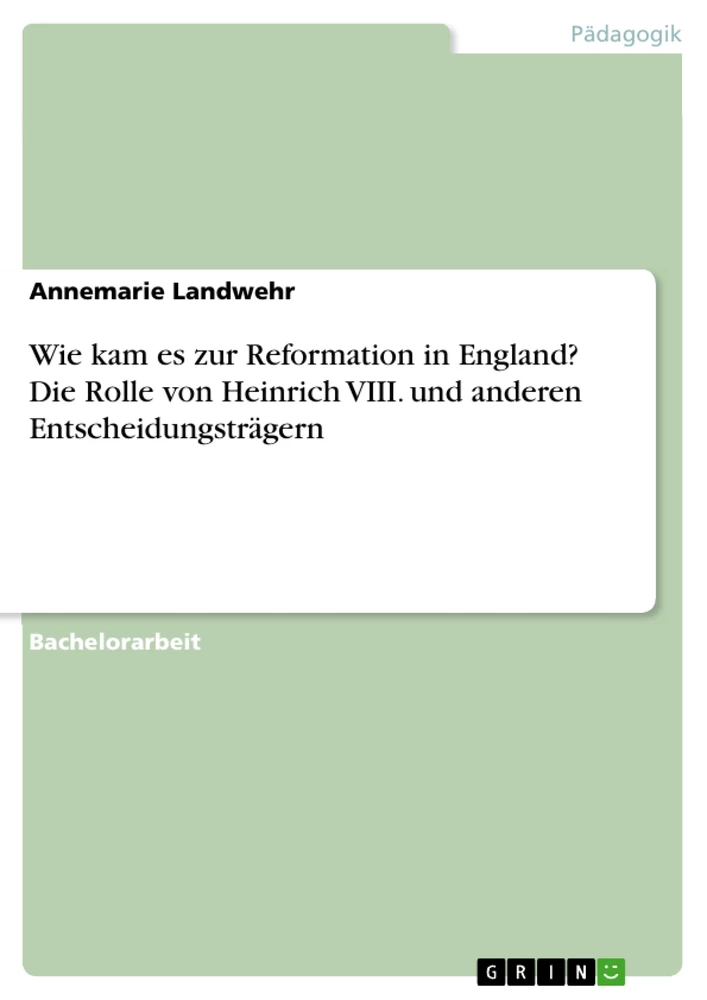
Wie kam es zur Reformation in England? Die Rolle von Heinrich VIII. und anderen Entscheidungsträgern
Bachelorarbeit, 2020
50 Seiten
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die englische Dynastie der Tudors - Eine Vorgeschichte
- Heinrich VIII. - Ausgewählte Aspekte seiner Biografie
- Kindheit und Jugend
- Heinrichs erste Jahre als König
- Defensor Fidei - Verteidiger des Glaubens
- Heinrich VIII. und der Konflikt mit Rom
- Die Scheidung von Katharina von Aragon
- Der Sturz von Thomas Wolsey und seine Folgen
- Das Reformationsparlament
- Thomas More
- Anne Boleyn - die neue Königin
- Thomas Cromwell
- Thomas Cranmer
- Der Bruch mit Rom
- Die Loslösung von Rom
- Gesetze zur Errichtung der Anglikanischen Staatskirche
- Act for the Submission of the Clergy 1532
- First Act in Restraint of Annates 1532
- Act in Retraint of Appeals to Rome 1533
- Act of First Fruits an Tenths 1533
- Second Act in Restraint of Annates 1534
- Act of Succession and Treason Act 1534
- Act of Supremacy 1534
- Reformatorische Maßnahmen
- Verlauf der Reformation nach dem Tod von Heinrich VIII.
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Ursachen und den Verlauf der Reformation in England unter besonderer Berücksichtigung der Rolle Heinrichs VIII. und anderer Entscheidungsträger. Sie analysiert die politische und religiöse Situation Englands vor und während der Reformation, beleuchtet die wichtigsten Ereignisse und Akteure sowie die Gesetze, die zur Gründung der Anglikanischen Kirche führten. Ziel ist es, die komplexen Prozesse der Reformation in England zu verstehen und aufzuzeigen, inwieweit Heinrich VIII. als treibende Kraft oder als Werkzeug in den Händen anderer agierte.
- Die politische Situation Englands während der Herrschaft der Tudors
- Heinrich VIII. als Monarch und seine Rolle in der Reformation
- Die Konflikte mit Rom und der Bruch mit der katholischen Kirche
- Die Entstehung der Anglikanischen Staatskirche und ihre wichtigsten Gesetze
- Die Bedeutung anderer Entscheidungsträger wie Thomas Wolsey, Thomas More, Anne Boleyn, Thomas Cromwell und Thomas Cranmer.
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Einleitung stellt die Forschungsfrage nach den Ursachen der Reformation in England dar und skizziert die Thematik der Arbeit. Sie hebt die Rolle Heinrichs VIII. und anderer Entscheidungsträger hervor und erläutert den Fokus auf den Beginn der Reformation.
- Die englische Dynastie der Tudors - Eine Vorgeschichte: Dieses Kapitel beleuchtet die politische und gesellschaftliche Situation Englands unter der Herrschaft der Tudors und liefert einen Kontext für die Reformation.
- Heinrich VIII. - Ausgewählte Aspekte seiner Biografie: Dieses Kapitel beleuchtet wichtige Aspekte der Biografie Heinrichs VIII., darunter seine Kindheit, seine ersten Jahre als König und seine Rolle als "Verteidiger des Glaubens".
- Heinrich VIII. und der Konflikt mit Rom: Dieses Kapitel analysiert den Konflikt zwischen Heinrich VIII. und der katholischen Kirche. Es behandelt die Scheidung von Katharina von Aragon, den Sturz von Thomas Wolsey und die Rolle des Reformationsparlaments.
- Der Bruch mit Rom: Dieses Kapitel beleuchtet die Prozesse, die zur Loslösung von Rom führten. Es analysiert die wichtigsten Gesetze, die die Gründung der Anglikanischen Kirche ermöglichten, darunter der Act of Supremacy.
- Verlauf der Reformation nach dem Tod von Heinrich VIII.: Dieses Kapitel untersucht die Entwicklung der Reformation in England nach dem Tod Heinrichs VIII.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den zentralen Begriffen der englischen Reformation, darunter Heinrich VIII., die Anglikanische Kirche, der Bruch mit Rom, das Reformationsparlament, Thomas Wolsey, Thomas More, Anne Boleyn, Thomas Cromwell und Thomas Cranmer. Die Arbeit fokussiert sich auf die politischen und religiösen Prozesse, die zur Trennung Englands von der katholischen Kirche führten und die Entstehung der Anglikanischen Staatskirche ermöglichten.
Häufig gestellte Fragen
Warum brach Heinrich VIII. mit der katholischen Kirche?
Hauptgrund war der Konflikt um die Annullierung seiner Ehe mit Katharina von Aragon, die der Papst verweigerte.
Was ist der „Act of Supremacy“ von 1534?
Dieses Gesetz erklärte den König zum obersten Haupt der Kirche von England und besiegelte den Bruch mit Rom.
Welche Rolle spielte Thomas Cromwell bei der Reformation?
Cromwell war ein entscheidender Stratege, der die gesetzliche Loslösung von Rom und die Auflösung der Klöster vorantrieb.
War Heinrich VIII. ursprünglich ein Gegner der Reformation?
Ja, er erhielt vom Papst sogar den Titel „Defensor Fidei“ (Verteidiger des Glaubens) für seine Schrift gegen Luther.
Wer war Thomas Cranmer?
Cranmer war der erste Erzbischof von Canterbury nach dem Bruch mit Rom und prägte die anglikanische Liturgie entscheidend.
Details
- Titel
- Wie kam es zur Reformation in England? Die Rolle von Heinrich VIII. und anderen Entscheidungsträgern
- Hochschule
- Universität Paderborn
- Autor
- Annemarie Landwehr (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2020
- Seiten
- 50
- Katalognummer
- V922590
- ISBN (eBook)
- 9783346325594
- ISBN (Buch)
- 9783346325600
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- reformation england rolle heinrich viii entscheidungsträgern
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 20,99
- Preis (Book)
- US$ 29,99
- Arbeit zitieren
- Annemarie Landwehr (Autor:in), 2020, Wie kam es zur Reformation in England? Die Rolle von Heinrich VIII. und anderen Entscheidungsträgern, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/922590
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-