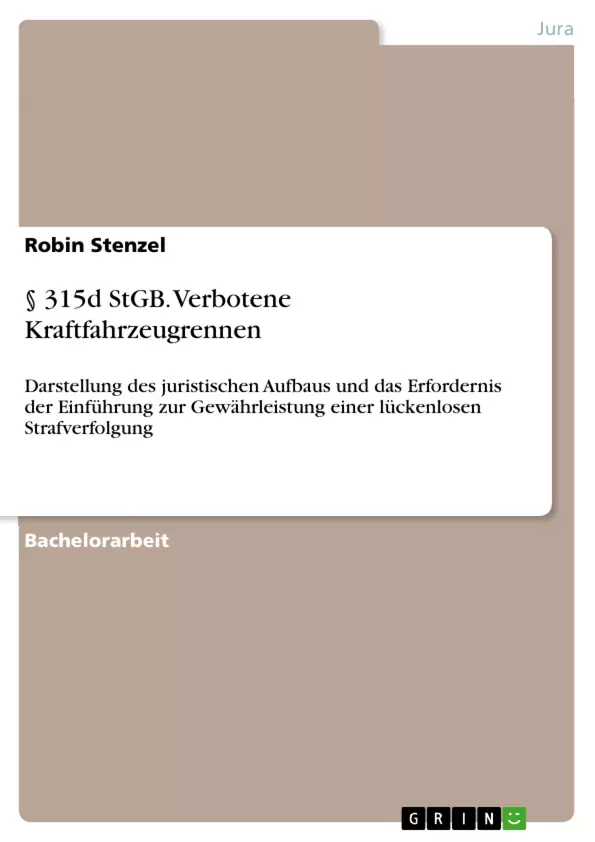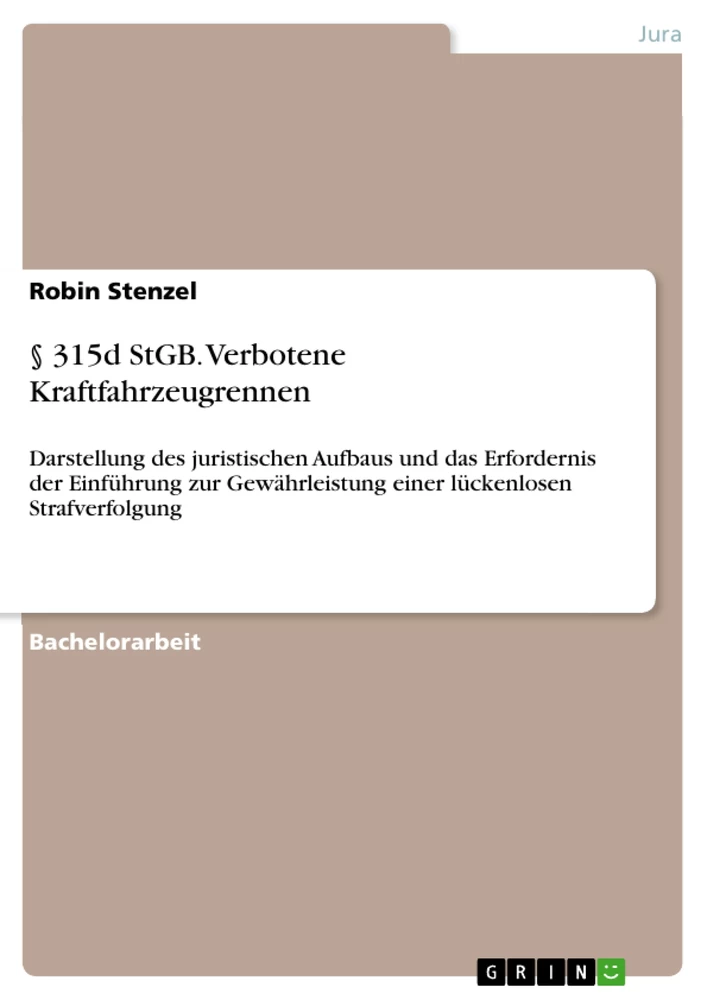
§ 315d StGB. Verbotene Kraftfahrzeugrennen
Bachelorarbeit, 2018
41 Seiten, Note: 1,7
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung
- 2. Allgemeines
- 2.1 Schutzgüter
- 3. Gesetzgebungsgeschichte & Kriminalpolitische Bedeutung
- 4. Tatbestand des Abs. 1 Nr. 1
- 4.1 Objektiver Tatbestand
- 4.2 Subjektiver Tatbestand
- 4.3 „Nicht erlaubt“ i.R.d. Rechtswidrigkeit
- 5. Tatbestand des Abs. 1 Nr. 2
- 5.1 Objektiver Tatbestand
- 5.2 Subjektiver Tatbestand
- 5.3 „Nicht erlaubt“ i.R.d. Rechtswidrigkeit
- 6. Tatbestand des Abs. 1 Nr. 3
- 6.1 Objektiver Tatbestand
- 6.2 Subjektiver Tatbestand
- 7. Qualifikationen und Fahrlässigkeit
- 7.1 Abs. 2
- 7.2 Abs. 4
- 7.3 Abs. 5
- 8. Maßnahmen zur Beweissicherung
- 8.1 Einziehung
- 8.2 Einziehung der Fahrerlaubnis
- 8.3 Exkurs: Bildaufzeichnungen von Dash-Cams als Beweismittel
- 9. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert den § 315d StGB, der verbotene Kraftfahrzeugrennen unter Strafe stellt. Ziel ist es, den juristischen Aufbau dieses Paragraphen darzustellen und die Notwendigkeit seiner Einführung zur Gewährleistung einer lückenlosen Strafverfolgung zu belegen. Die Arbeit betrachtet sowohl die politischen Hintergründe und die Gesetzgebungsgeschichte als auch die für die polizeiliche Ermittlungsarbeit relevanten juristischen Aspekte.
- Gesetzgebungsgeschichte und kriminalpolitische Bedeutung des § 315d StGB
- Juristische Analyse der Tatbestände des § 315d Abs. 1 Nr. 1, Nr. 2 und Nr. 3
- Untersuchung der Qualifikationstatbestände und der Fahrlässigkeit im Zusammenhang mit verbotenen Kraftfahrzeugrennen
- Relevante Maßnahmen der Beweissicherung durch die Polizei
- Bewertung der Notwendigkeit des § 315d StGB für eine effektive Strafverfolgung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einführung: Die Einführung beschreibt die hohe Anzahl an ermittelten Fällen illegaler Autorennen in Nordrhein-Westfalen im Jahr 2017 und verdeutlicht die Notwendigkeit des § 315d StGB anhand eines tragischen Beispiels aus Köln, bei dem eine Person durch ein illegales Autorennen ums Leben kam. Der Fall unterstreicht das Problem unzureichender Strafverfolgung und den daraus resultierenden Vertrauensverlust in die Justiz. Die Arbeit wird als Reaktion auf diese Problematik vorgestellt und skizziert ihren Aufbau.
2. Allgemeines: Dieses Kapitel erläutert die Einführung des § 315d StGB im Rahmen des Sechsundfünfzigsten Strafänderungsgesetzes und definiert ihn als abstraktes Gefährdungsdelikt, das auch als Tätigkeitsdelikt ausgelegt werden kann. Es wird der Unterschied zwischen abstrakten Gefährdungsdelikten und Erfolgsdelikten erklärt und die Bedeutung der abstrakten Gefährdung für die Strafbarkeit hervorgehoben. Der Fokus liegt auf der potenziellen Gefahr, die von verbotenen Kraftfahrzeugrennen ausgeht, unabhängig von einem konkreten Schaden.
3. Gesetzgebungsgeschichte & Kriminalpolitische Bedeutung: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Entstehungsprozess des § 315d StGB, seinen politischen Beweggründen und seiner Bedeutung für die Kriminalpolitik. Es analysiert die gesellschaftlichen und politischen Faktoren, die zur Einführung dieses Paragraphen geführt haben, und bewertet seine Bedeutung für die Bekämpfung von illegalen Kraftfahrzeugrennen.
4. Tatbestand des Abs. 1 Nr. 1: Hier wird der Tatbestand des § 315d Abs. 1 Nr. 1 im Detail untersucht, unterteilt in objektiven und subjektiven Tatbestand. Der Schwerpunkt liegt auf der Definition des objektiven Tatbestandes (z.B. das Führen eines Kraftfahrzeugs im Rahmen eines nicht erlaubten Rennens) und des subjektiven Tatbestandes (z.B. die Absicht, an einem solchen Rennen teilzunehmen). Das Tatbestandsmerkmal „nicht erlaubt“ wird ebenfalls eingehend erläutert.
5. Tatbestand des Abs. 1 Nr. 2: Ähnlich wie Kapitel 4 wird hier der Tatbestand des § 315d Abs. 1 Nr. 2 analysiert, wobei die spezifischen Unterschiede zu Nr. 1 herausgearbeitet werden. Die Kapitelstruktur ähnelt dem Aufbau von Kapitel 4, mit einer differenzierten Betrachtung des objektiven und subjektiven Tatbestands und einer detaillierten Analyse des Merkmals „nicht erlaubt“ im Kontext von Nr. 2.
6. Tatbestand des Abs. 1 Nr. 3: Dieses Kapitel widmet sich dem Tatbestand des § 315d Abs. 1 Nr. 3, wiederum mit einer detaillierten Untersuchung des objektiven und subjektiven Tatbestands. Die Analyse wird im Detail die spezifischen Merkmale und den Unterschied zu den vorherigen Tatbeständen aufzeigen.
7. Qualifikationen und Fahrlässigkeit: Dieser Abschnitt befasst sich mit den qualifizierten Tatbeständen des § 315d StGB (Abs. 2, 4, 5) und der Frage der Fahrlässigkeit. Es wird untersucht, unter welchen Umständen die Strafe verschärft wird und wie Fahrlässigkeit im Zusammenhang mit verbotenen Kraftfahrzeugrennen strafrechtlich relevant ist.
8. Maßnahmen zur Beweissicherung: Kapitel acht konzentriert sich auf wichtige Maßnahmen der Polizei zur Beweissicherung bei verbotenen Kraftfahrzeugrennen. Es werden die Verfahren der Einziehung von Fahrzeugen und Fahrerlaubnissen erläutert, sowie der Einsatz von Dashcam-Aufnahmen als Beweismittel diskutiert.
Häufig gestellte Fragen zu: Analyse des § 315d StGB - Verbotene Kraftfahrzeugrennen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert den § 315d StGB, der verbotene Kraftfahrzeugrennen unter Strafe stellt. Sie untersucht den juristischen Aufbau dieses Paragraphen und belegt die Notwendigkeit seiner Einführung zur Gewährleistung einer lückenlosen Strafverfolgung.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Gesetzgebungsgeschichte und kriminalpolitische Bedeutung des § 315d StGB, eine juristische Analyse der Tatbestände des § 315d Abs. 1 Nr. 1, Nr. 2 und Nr. 3, die Untersuchung der Qualifikationstatbestände und der Fahrlässigkeit, relevante Maßnahmen der Beweissicherung durch die Polizei und eine Bewertung der Notwendigkeit des § 315d StGB für eine effektive Strafverfolgung.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in verschiedene Kapitel gegliedert, beginnend mit einer Einführung, die die Problematik illegaler Autorennen und die Notwendigkeit des § 315d StGB verdeutlicht. Es folgen Kapitel zu allgemeinen Aspekten, der Gesetzgebungsgeschichte, der detaillierten Analyse der Tatbestände des § 315d Abs. 1 (Nr. 1, 2 und 3), den Qualifikationen und der Fahrlässigkeit, Maßnahmen zur Beweissicherung (inkl. Dashcam-Aufnahmen) und abschließend einem Fazit.
Was wird unter den Tatbeständen des § 315d Abs. 1 Nr. 1, Nr. 2 und Nr. 3 untersucht?
Für jeden der drei Tatbestände (Nr. 1, 2 und 3) wird der objektive und subjektive Tatbestand detailliert untersucht. Es wird insbesondere auf die Definition der Tatbestandsmerkmale und den Unterschied zwischen den einzelnen Nummern eingegangen. Der Begriff „nicht erlaubt“ wird in jedem Kontext eingehend erläutert.
Welche Rolle spielen Qualifikationen und Fahrlässigkeit im § 315d StGB?
Das Kapitel zu Qualifikationen und Fahrlässigkeit untersucht die verschärften Strafen gemäß § 315d Abs. 2, 4 und 5. Es wird analysiert, unter welchen Umständen die Strafe verschärft wird und welche Bedeutung Fahrlässigkeit im Zusammenhang mit verbotenen Kraftfahrzeugrennen hat.
Welche Maßnahmen zur Beweissicherung werden behandelt?
Die Arbeit beschreibt wichtige Maßnahmen der Polizei zur Beweissicherung, wie die Einziehung von Fahrzeugen und Fahrerlaubnissen. Ein besonderer Fokus liegt auf der Verwendung von Bildaufzeichnungen von Dashcams als Beweismittel.
Welche Schlussfolgerung zieht die Arbeit?
Die Arbeit bewertet die Notwendigkeit des § 315d StGB für eine effektive Strafverfolgung von verbotenen Kraftfahrzeugrennen. (Der genaue Inhalt des Fazits ist im gegebenen Text nicht vollständig zusammengefasst.)
Welche Beispiele werden verwendet?
Ein tragischer Fall aus Köln, bei dem eine Person durch ein illegales Autorennen ums Leben kam, wird als Beispiel für die Notwendigkeit des § 315d StGB und die Problematik unzureichender Strafverfolgung angeführt. Die hohe Anzahl an ermittelten Fällen illegaler Autorennen in Nordrhein-Westfalen im Jahr 2017 wird ebenfalls erwähnt.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Juristen, Studierende der Rechtswissenschaften, Polizeibeamte und alle, die sich mit dem Thema verbotene Kraftfahrzeugrennen und deren strafrechtliche Verfolgung auseinandersetzen.
Details
- Titel
- § 315d StGB. Verbotene Kraftfahrzeugrennen
- Untertitel
- Darstellung des juristischen Aufbaus und das Erfordernis der Einführung zur Gewährleistung einer lückenlosen Strafverfolgung
- Hochschule
- Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen; Münster
- Note
- 1,7
- Autor
- Robin Stenzel (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2018
- Seiten
- 41
- Katalognummer
- V922994
- ISBN (eBook)
- 9783346246400
- ISBN (Buch)
- 9783346246417
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Kraftfahrzeugrennen
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 19,99
- Preis (Book)
- US$ 28,99
- Arbeit zitieren
- Robin Stenzel (Autor:in), 2018, § 315d StGB. Verbotene Kraftfahrzeugrennen, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/922994
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-