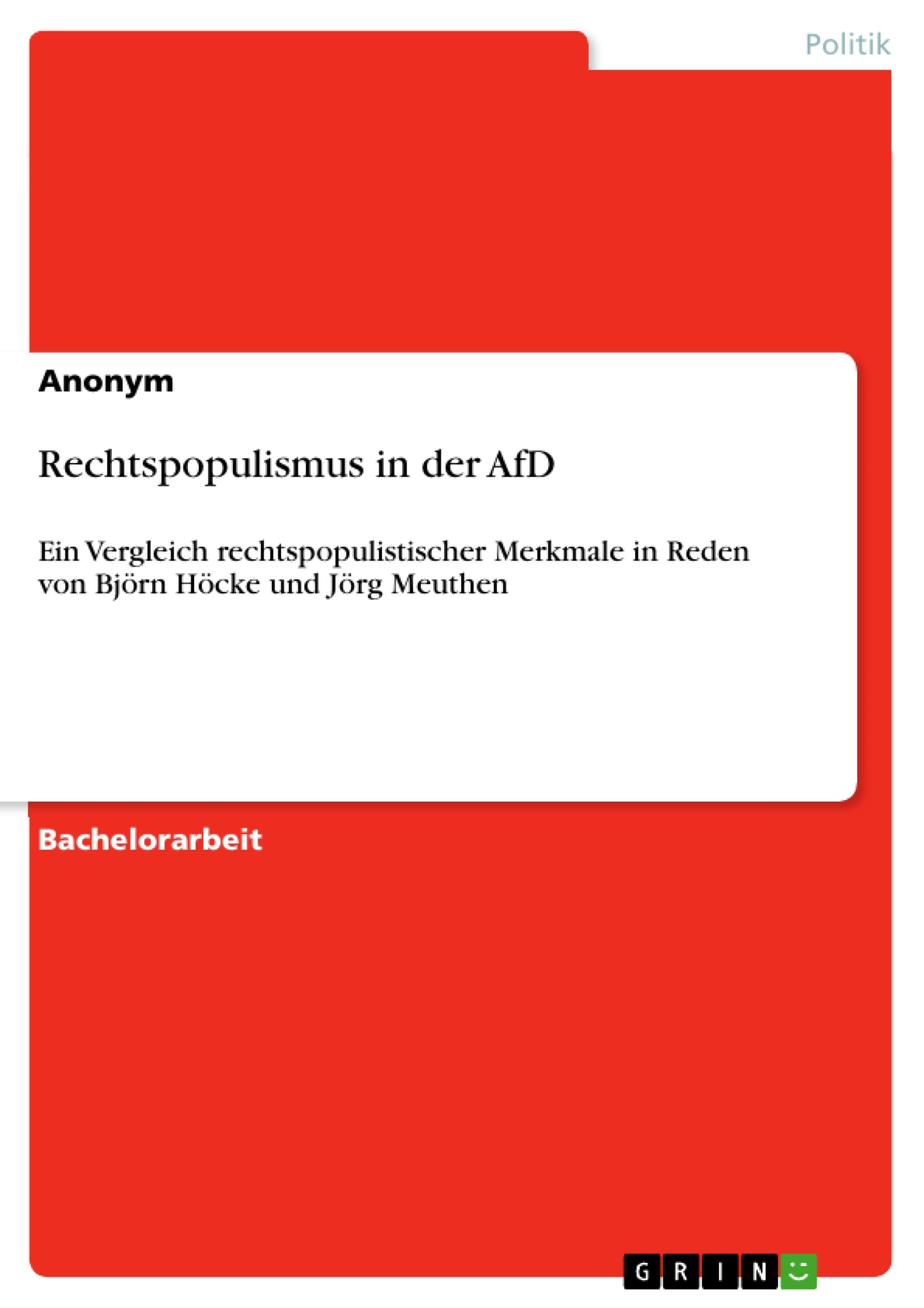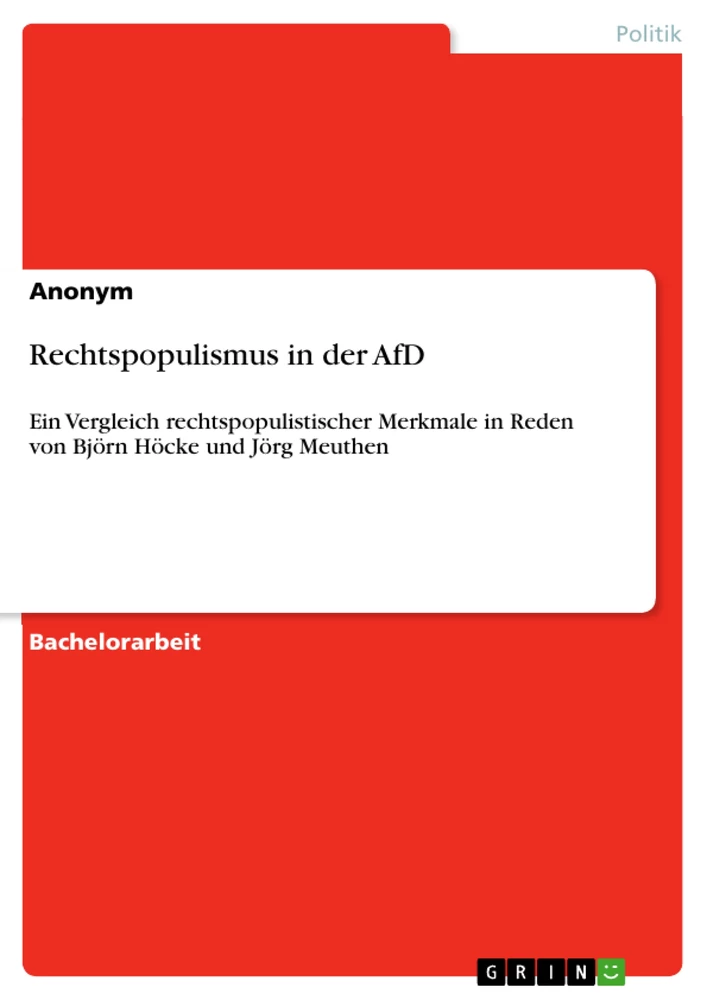
Rechtspopulismus in der AfD
Bachelorarbeit, 2020
58 Seiten, Note: 1,7
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theoretischer Rahmen
- 2.1 Debatte um den Populismusbegriff
- 2.2 Konzeptualisierung von Rechtspopulismus
- 2.2.1 Populistische Ideologie
- 2.2.2 Rechte Ideologie
- 3. Ideologische Entwicklung der AfD
- 4. Daten und Methodik
- 4.1 Auswahl des Untersuchungsgegenstandes
- 4.2 Messung von Rechtspopulismus
- 4.3 Kategoriensystem
- 4.3.1 Populismus
- 4.3.2 Rechte Orientierung
- 5. Ergebnisse
- 5.1 Grad des Populismus
- 5.2 Grad der rechten Orientierung
- 5.3 Höcke und Meuthen im Vergleich
- 5.4 Grad des Rechtspopulismus
- 5.5 Zusammenfassung der Ergebnisse
- 6. Diskussion
- 7. Fazit
- 8. Quellen
- 9. Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Frage, wie sich die zunehmende Bedeutung rechter Elemente auf den Populismus in der AfD auswirkt. Dazu wird der Begriff Rechtspopulismus analysiert und die ideologische Entwicklung der AfD in den letzten Jahren betrachtet. Die Arbeit untersucht, ob die Zunahme von rechter Orientierung mit einem Verlust an populistischer Orientierung einhergeht.
- Konzeptualisierung von Rechtspopulismus
- Ideologische Entwicklung der AfD
- Messung von Rechtspopulismus in Reden von Björn Höcke und Jörg Meuthen
- Vergleich von rechten und populistischen Elementen in den Reden
- Analyse der Entwicklung des Rechtspopulismus in der AfD im zeitlichen Vergleich
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Relevanz des Themas Rechtspopulismus in Bezug auf die AfD erläutert. Anschließend wird im Kapitel "Theoretischer Rahmen" der Begriff Rechtspopulismus definiert und seine Bestandteile beleuchtet. Die ideologische Entwicklung der AfD wird im dritten Kapitel dargestellt, um den Kontext für die Analyse von Reden von Björn Höcke und Jörg Meuthen zu schaffen.
In Kapitel 4 werden die Daten und die Methodik der Arbeit erläutert. Hier wird die qualitative Inhaltsanalyse vorgestellt, die auf Reden von Höcke und Meuthen angewendet wird. Kapitel 5 präsentiert die Ergebnisse der Analyse und stellt den Grad des Populismus und der rechten Orientierung in den Reden dar. Höcke und Meuthen werden im zeitlichen Vergleich von 2016 und 2018 gegenübergestellt.
Die Diskussion in Kapitel 6 beschäftigt sich mit den Ergebnissen der Analyse und der Frage, inwiefern die Bezeichnung Rechtspopulismus angesichts der Ergebnisse noch angemessen ist.
Schlüsselwörter
Rechtspopulismus, AfD, Björn Höcke, Jörg Meuthen, Populismus, Rechte Ideologie, Qualitative Inhaltsanalyse, Radikalisierung, Rechtsextremismus.
Häufig gestellte Fragen
Wie hat sich die Ideologie der AfD in den letzten Jahren entwickelt?
Die Arbeit untersucht den Einschlag der Partei in das rechte Spektrum und ob eine Radikalisierung nach rechts zu einem Verlust an populistischer Orientierung führt.
Worin unterscheiden sich Björn Höcke und Jörg Meuthen in ihren Reden?
Die Analyse vergleicht Reden beim Kyffhäusertreffen (2016/2018), um Höcke als Vertreter des rechten Flügels und Meuthen als Vertreter des damals gemäßigteren Flügels gegenüberzustellen.
Was ist die zentrale Hypothese dieser Untersuchung?
Die Hypothese lautet, dass mit zunehmender ideologischer Radikalisierung nach rechts die Verbreitung rein populistischer Inhalte paradoxerweise abnimmt.
Wie wird Rechtspopulismus in der Arbeit definiert?
Die Konzeptionalisierung basiert auf einer Kombination aus populistischer Ideologie (Volk vs. Elite) und rechter Ideologie (Exklusion/Nationalismus).
Ist die AfD auf dem Weg zu einer rechtsextremen Partei?
Die Arbeit diskutiert das Spannungsfeld zwischen Rechtspopulismus und Rechtsextremismus und ob Teile der Partei (der „Flügel“) diese Grenze überschreiten.
Details
- Titel
- Rechtspopulismus in der AfD
- Untertitel
- Ein Vergleich rechtspopulistischer Merkmale in Reden von Björn Höcke und Jörg Meuthen
- Hochschule
- Universität Münster
- Note
- 1,7
- Autor
- Anonym (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2020
- Seiten
- 58
- Katalognummer
- V931444
- ISBN (eBook)
- 9783346257079
- ISBN (Buch)
- 9783346257086
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Rechtspopulismus Rechtsextremismus AfD Höcke Meuthen Inhaltsanalyse
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 20,99
- Preis (Book)
- US$ 29,99
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2020, Rechtspopulismus in der AfD, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/931444
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-