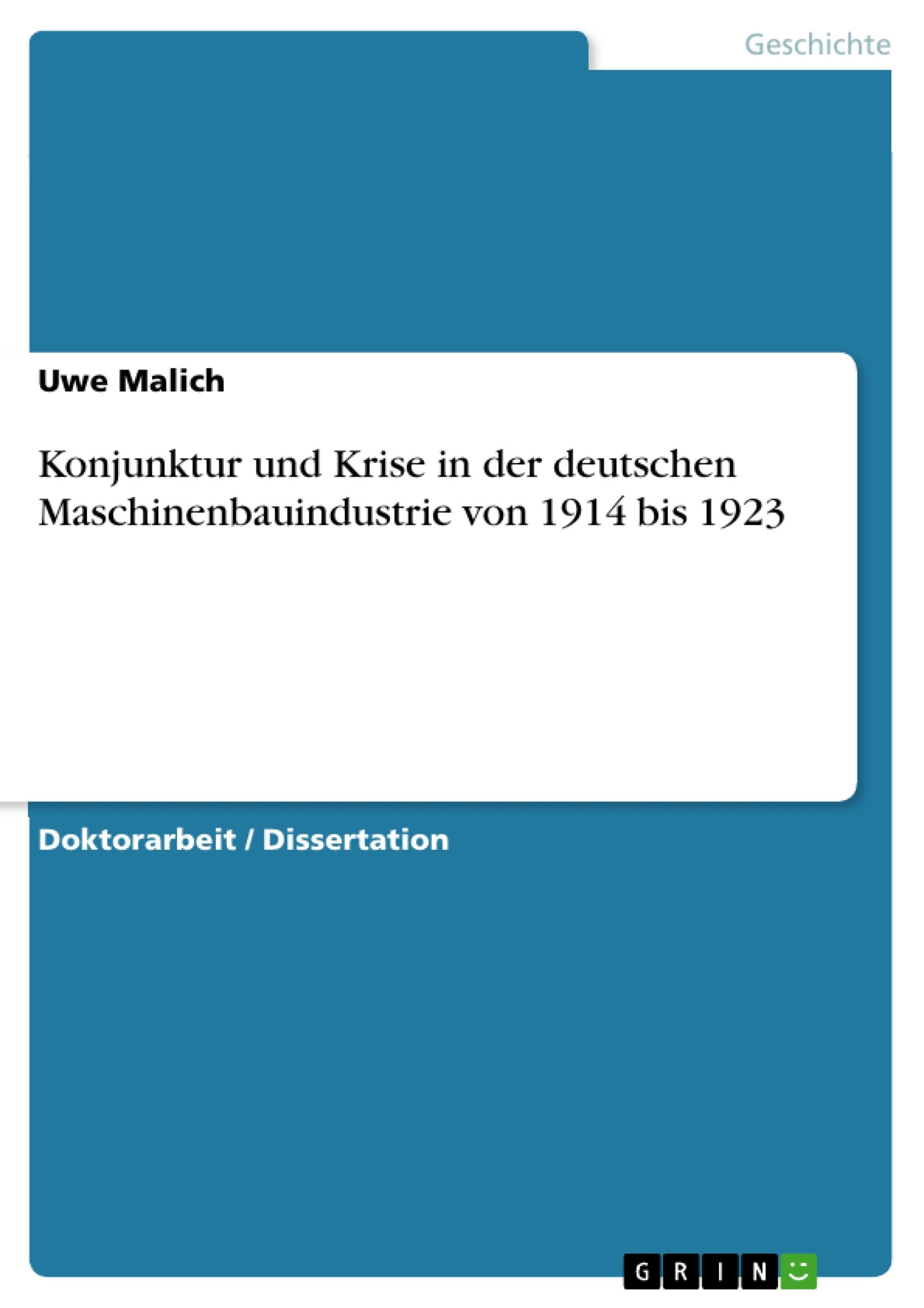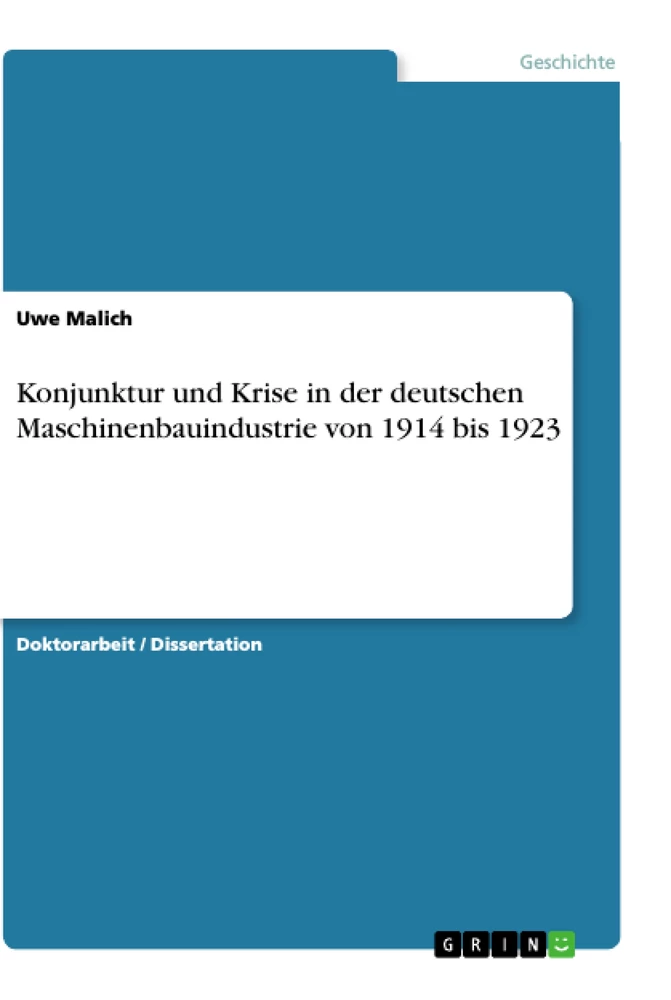
Konjunktur und Krise in der deutschen Maschinenbauindustrie von 1914 bis 1923
Doktorarbeit / Dissertation, 1981
218 Seiten, Note: 0,5
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Kriegskonjunktur in der deutschen Maschinenbauindustrie von 1914 bis 1918
- Die Nachfrage auf dem Markt der Maschinenbauindustrie
- Die Produktion der Maschinenbauindustrie
- Der Export der Maschinenbauindustrie
- Die Preise auf den Märkten der Maschinenbauindustrie
- Die Profite der Maschinenbauindustrie
- Die Lage der Arbeiter der Maschinenbauindustrie
- Die Inflationskonjunktur der deutschen Maschinenbauindustrie von 1919 bis 1923
- Die Nachfrage auf den Märkten der Maschinenbauindustrie
- Die Produktion der Maschinenbauindustrie
- Der Export der Maschinenbauindustrie
- Die Preise auf den Märkten der Maschinenbauindustrie
- Die Profite der Maschinenbauindustrie
- Die Lage der Arbeiter der Maschinenbauindustrie
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Dissertation untersucht die Entwicklung der deutschen Maschinenbauindustrie während der Jahre 1914 bis 1923, einem Zeitraum geprägt von Krieg und anschliessender Hyperinflation. Ziel ist es, die Auswirkungen dieser aussergewöhnlichen wirtschaftlichen und politischen Umstände auf die Branche zu analysieren.
- Die Auswirkungen des Ersten Weltkriegs auf die Nachfrage, Produktion, den Export und die Profitabilität der Maschinenbauindustrie.
- Die Anpassungsfähigkeit der Maschinenbauindustrie an die veränderten Marktbedingungen während des Krieges.
- Die Rolle der Maschinenbauindustrie in der Kriegswirtschaft.
- Die Auswirkungen der Hyperinflation auf die deutsche Maschinenbauindustrie.
- Die soziale Lage der Arbeiter in der Maschinenbauindustrie während dieser Zeit.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und beschreibt den Zeitraum und die Bedeutung der Untersuchung der deutschen Maschinenbauindustrie während der Jahre 1914-1923. Es werden die zentralen Fragestellungen und die methodische Vorgehensweise der Arbeit skizziert.
Die Kriegskonjunktur in der deutschen Maschinenbauindustrie von 1914 bis 1918: Dieses Kapitel analysiert die Auswirkungen des Ersten Weltkriegs auf die deutsche Maschinenbauindustrie. Es untersucht die Kriegsnachfrage nach Maschinen und Rüstungsgütern, die Anpassung der Produktion an die neuen Anforderungen, die Entwicklung des Exports, die Preisentwicklung und die Gewinnmargen der Unternehmen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der sozialen Lage der Arbeiter und ihrer Arbeitsbedingungen unter Kriegsbedingungen. Die Analyse zeigt die Herausforderungen und die bemerkenswerte Anpassungsfähigkeit der Industrie auf.
Die Inflationskonjunktur der deutschen Maschinenbauindustrie von 1919 bis 1923: Dieses Kapitel befasst sich mit den Folgen der Hyperinflation für die deutsche Maschinenbauindustrie. Es werden die Auswirkungen der Geldentwertung auf die Nachfrage, die Produktion, den Export und die Preise untersucht. Der Fokus liegt auf der Fähigkeit der Industrie, die Inflation für ihre Zwecke zu nutzen und die damit verbundenen ökonomischen und sozialen Konsequenzen. Die Analyse beleuchtet die unterschiedlichen Strategien der Unternehmen und die wirtschaftlichen Herausforderungen dieser Zeit.
Schlüsselwörter
Deutsche Maschinenbauindustrie, Erster Weltkrieg, Hyperinflation, Kriegskonjunktur, Inflationskonjunktur, Nachfrage, Produktion, Export, Preise, Profite, Arbeiter, Wirtschaftsgeschichte Deutschlands, 1914-1923.
FAQ: Entwicklung der deutschen Maschinenbauindustrie 1914-1923
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Dissertation untersucht die Entwicklung der deutschen Maschinenbauindustrie während des Ersten Weltkriegs und der darauf folgenden Hyperinflation (1914-1923). Analysiert werden die Auswirkungen dieser außergewöhnlichen wirtschaftlichen und politischen Umstände auf die Branche.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Auswirkungen des Ersten Weltkriegs auf Nachfrage, Produktion, Export und Profitabilität der Maschinenbauindustrie. Es wird die Anpassungsfähigkeit der Industrie an die veränderten Marktbedingungen, ihre Rolle in der Kriegswirtschaft, die Folgen der Hyperinflation und die soziale Lage der Arbeiter untersucht.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Kriegskonjunktur (1914-1918), ein Kapitel zur Inflationskonjunktur (1919-1923) und einen Schluss. Jedes Kapitel analysiert die Nachfrage, Produktion, den Export, die Preise, die Profite und die Lage der Arbeiter in der Maschinenbauindustrie während der jeweiligen Periode.
Wie wird die Kriegskonjunktur analysiert?
Das Kapitel zur Kriegskonjunktur analysiert die Kriegsnachfrage nach Maschinen und Rüstungsgütern, die Anpassung der Produktion, die Entwicklung des Exports, die Preisentwicklung und die Gewinnmargen. Ein Schwerpunkt liegt auf der sozialen Lage der Arbeiter unter Kriegsbedingungen.
Wie wird die Inflationskonjunktur analysiert?
Das Kapitel zur Inflationskonjunktur untersucht die Auswirkungen der Hyperinflation auf Nachfrage, Produktion, Export und Preise. Es beleuchtet die Strategien der Unternehmen zur Bewältigung der Inflation und die damit verbundenen ökonomischen und sozialen Konsequenzen.
Welche methodische Vorgehensweise wird angewendet?
Die methodische Vorgehensweise wird in der Einleitung skizziert. Die Arbeit basiert auf einer detaillierten Analyse der wirtschaftlichen Entwicklung der Maschinenbauindustrie anhand verschiedener statistischer Daten und Quellen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Deutsche Maschinenbauindustrie, Erster Weltkrieg, Hyperinflation, Kriegskonjunktur, Inflationskonjunktur, Nachfrage, Produktion, Export, Preise, Profite, Arbeiter, Wirtschaftsgeschichte Deutschlands, 1914-1923.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Ziel der Arbeit ist es, die Auswirkungen des Ersten Weltkriegs und der Hyperinflation auf die deutsche Maschinenbauindustrie zu analysieren und die Anpassungsfähigkeit sowie die Herausforderungen dieser Branche während dieser Zeit zu beleuchten.
Wer ist die Zielgruppe dieser Arbeit?
Die Arbeit richtet sich an Wissenschaftler, Studierende und alle Interessierten, die sich mit der Wirtschaftsgeschichte Deutschlands und der Entwicklung der Maschinenbauindustrie beschäftigen.
Details
- Titel
- Konjunktur und Krise in der deutschen Maschinenbauindustrie von 1914 bis 1923
- Note
- 0,5
- Autor
- Uwe Malich (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 1981
- Seiten
- 218
- Katalognummer
- V931541
- ISBN (eBook)
- 9783346243874
- ISBN (Buch)
- 9783346243881
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- konjunktur krise maschinenbauindustrie Erster Weltkrieg Inflation Verelendung der Arbeiter
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 41,99
- Preis (Book)
- US$ 54,99
- Arbeit zitieren
- Uwe Malich (Autor:in), 1981, Konjunktur und Krise in der deutschen Maschinenbauindustrie von 1914 bis 1923, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/931541
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-