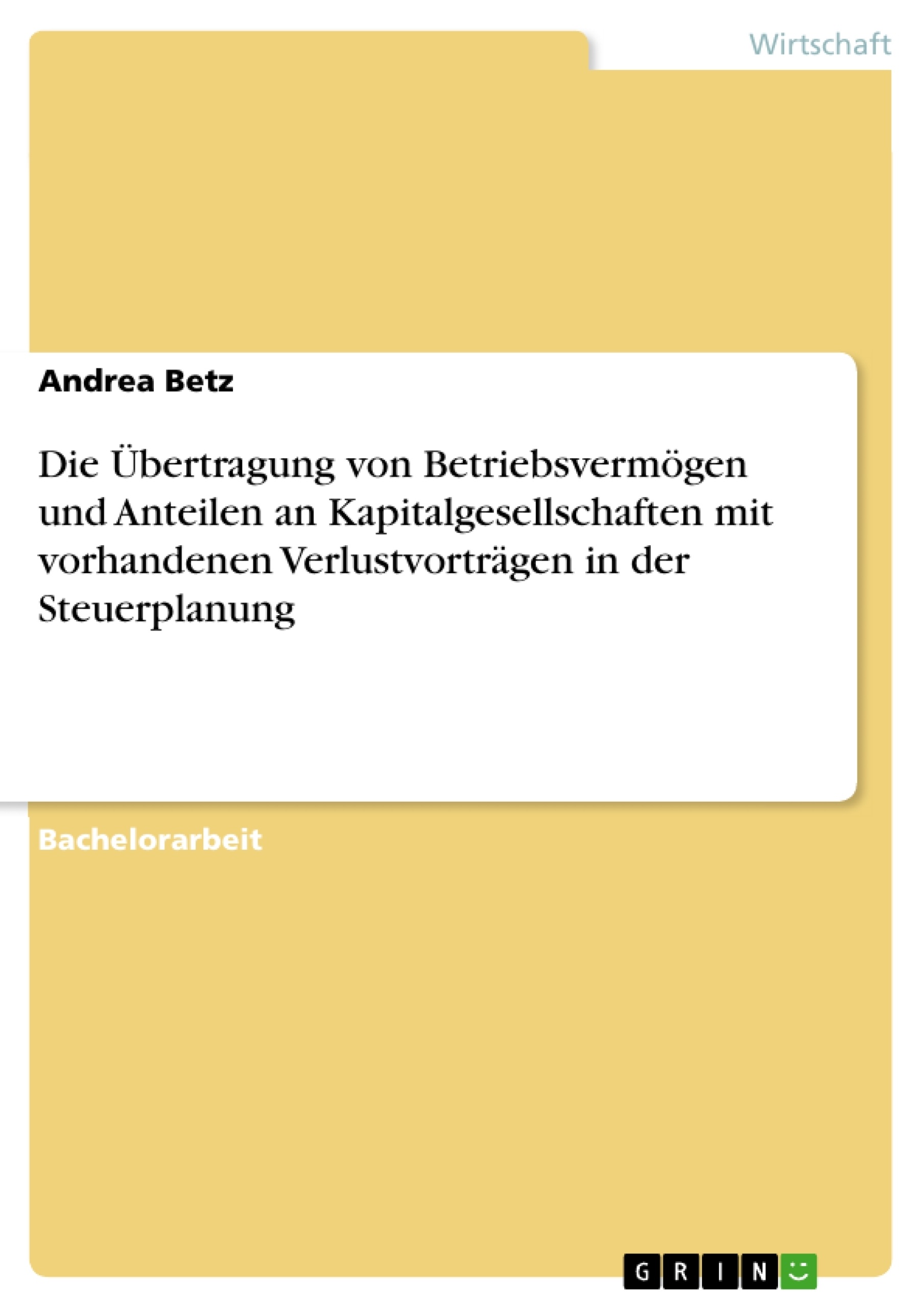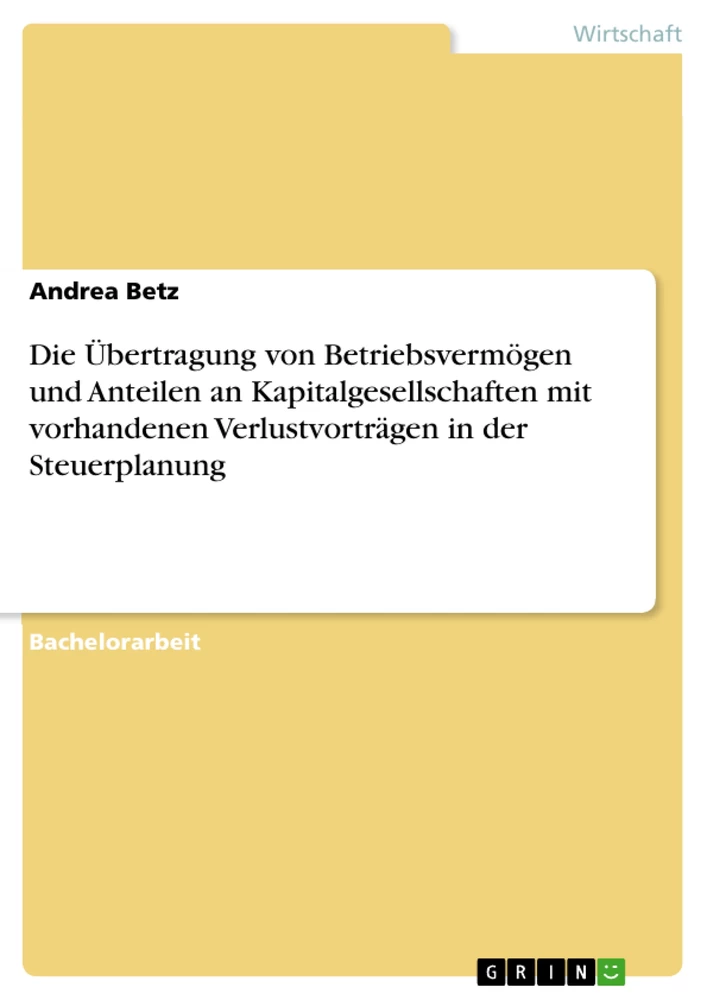
Die Übertragung von Betriebsvermögen und Anteilen an Kapitalgesellschaften mit vorhandenen Verlustvorträgen in der Steuerplanung
Bachelorarbeit, 2018
58 Seiten, Note: 1,3
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Grundlagen
- Methodische und betriebswirtschaftliche Grundlagen der betrieblichen Steuerpolitik
- Rechtliche Grundlagen des Verlustabzugs
- Gestaltungen zur Verlustnutzung
- Gewinnrealisation und -nivellierung im Verlustunternehmen
- Umwandlung zur Aufdeckung stiller Reserven
- Zivil- und steuerrechtliche Grundlagen der Umwandlung
- Rechtsformwahl und Vorteil der Umwandlung
- Wertansatzwahlrecht und Vorteilhaftigkeitsanalyse
- Erhaltung des Verlustabzugs
- Gesonderte Verrechnungskreise
- Vorteilhaftigkeit der Kapitalgesellschaft
- Vorteilsvergleich zwischen dem § 8c KStG und dem § 8d KStG
- „Vererbung“ von Verlustvorträgen
- Zusammenfassung der Ergebnisse
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der steuerlichen Planung bei der Übertragung von Betriebsvermögen und Anteilen an Kapitalgesellschaften, insbesondere im Kontext vorhandener Verlustvorträge. Die Arbeit beleuchtet die Möglichkeiten, diese Verlustvorträge sinnvoll zu nutzen und gleichzeitig die steuerliche Belastung zu minimieren.
- Rechtliche Grundlagen des Verlustabzugs
- Gestaltungsmöglichkeiten zur Nutzung von Verlustvorträgen
- Umwandlung von Unternehmen zur Aufdeckung stiller Reserven
- Erhaltung des Verlustabzugs bei Unternehmensübertragungen
- „Vererbung“ von Verlustvorträgen
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1: Die Einleitung führt in die Thematik der Steuerplanung bei Unternehmensübertragungen ein und beleuchtet die Relevanz des Verlustabzugs in diesem Zusammenhang.
Kapitel 2: Hier werden die methodischen und betriebswirtschaftlichen Grundlagen der betrieblichen Steuerpolitik sowie die rechtlichen Grundlagen des Verlustabzugs erläutert.
Kapitel 3: Dieses Kapitel befasst sich mit verschiedenen Gestaltungsmöglichkeiten zur Nutzung von Verlustvorträgen, wie z.B. der Gewinnrealisation und -nivellierung im Verlustunternehmen, der Umwandlung zur Aufdeckung stiller Reserven und der Erhaltung des Verlustabzugs.
Schlüsselwörter
Steuerplanung, Unternehmensübertragung, Verlustabzug, Verlustvorträge, Betriebsvermögen, Kapitalgesellschaften, Umwandlung, stille Reserven, § 8c KStG, § 8d KStG, Gewinnrealisation, Gewinnnivellierung, Rechtsformwahl.
Häufig gestellte Fragen
Wie können Verlustvorträge bei einer Unternehmensnachfolge gesichert werden?
Durch steuerplanerische Maßnahmen wie Gewinnrealisation, Umwandlungen zur Aufdeckung stiller Reserven oder die Nutzung von Regelungen wie § 8d KStG.
Was regeln die Paragrafen 8c und 8d KStG?
§ 8c KStG regelt den Verlustuntergang bei Anteilsübertragungen, während § 8d KStG unter bestimmten Voraussetzungen den Erhalt des verlustvortrags ermöglicht (fortführungsgebundener Verlustvortrag).
Können Verlustvorträge vererbt werden?
Die Arbeit untersucht die rechtlichen Möglichkeiten und Grenzen der „Vererbung“ von Verlusten im Rahmen der Unternehmensnachfolge.
Welche Rolle spielt die Umwandlung zur Aufdeckung stiller Reserven?
Eine Umwandlung kann genutzt werden, um stille Reserven zu heben, gegen die vorhandene Verluste verrechnet werden können, bevor diese verfallen.
Was ist das Ziel der betrieblichen Steuerpolitik in diesem Kontext?
Ziel ist die Minimierung der Steuerlast durch die optimale Nutzung steuerlicher Aktionsparameter und die Vermeidung des Untergangs von Verlustverrechnungspotenzial.
Details
- Titel
- Die Übertragung von Betriebsvermögen und Anteilen an Kapitalgesellschaften mit vorhandenen Verlustvorträgen in der Steuerplanung
- Hochschule
- FernUniversität Hagen
- Note
- 1,3
- Autor
- Andrea Betz (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2018
- Seiten
- 58
- Katalognummer
- V937244
- ISBN (eBook)
- 9783346263810
- ISBN (Buch)
- 9783346263827
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Steuern Steuerplanung Verluste Übertragung Unternehmensnachfolge Umwandlung Spaltung Stille Reserven Unternhemensverkauf
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 20,99
- Preis (Book)
- US$ 31,99
- Arbeit zitieren
- Andrea Betz (Autor:in), 2018, Die Übertragung von Betriebsvermögen und Anteilen an Kapitalgesellschaften mit vorhandenen Verlustvorträgen in der Steuerplanung, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/937244
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-