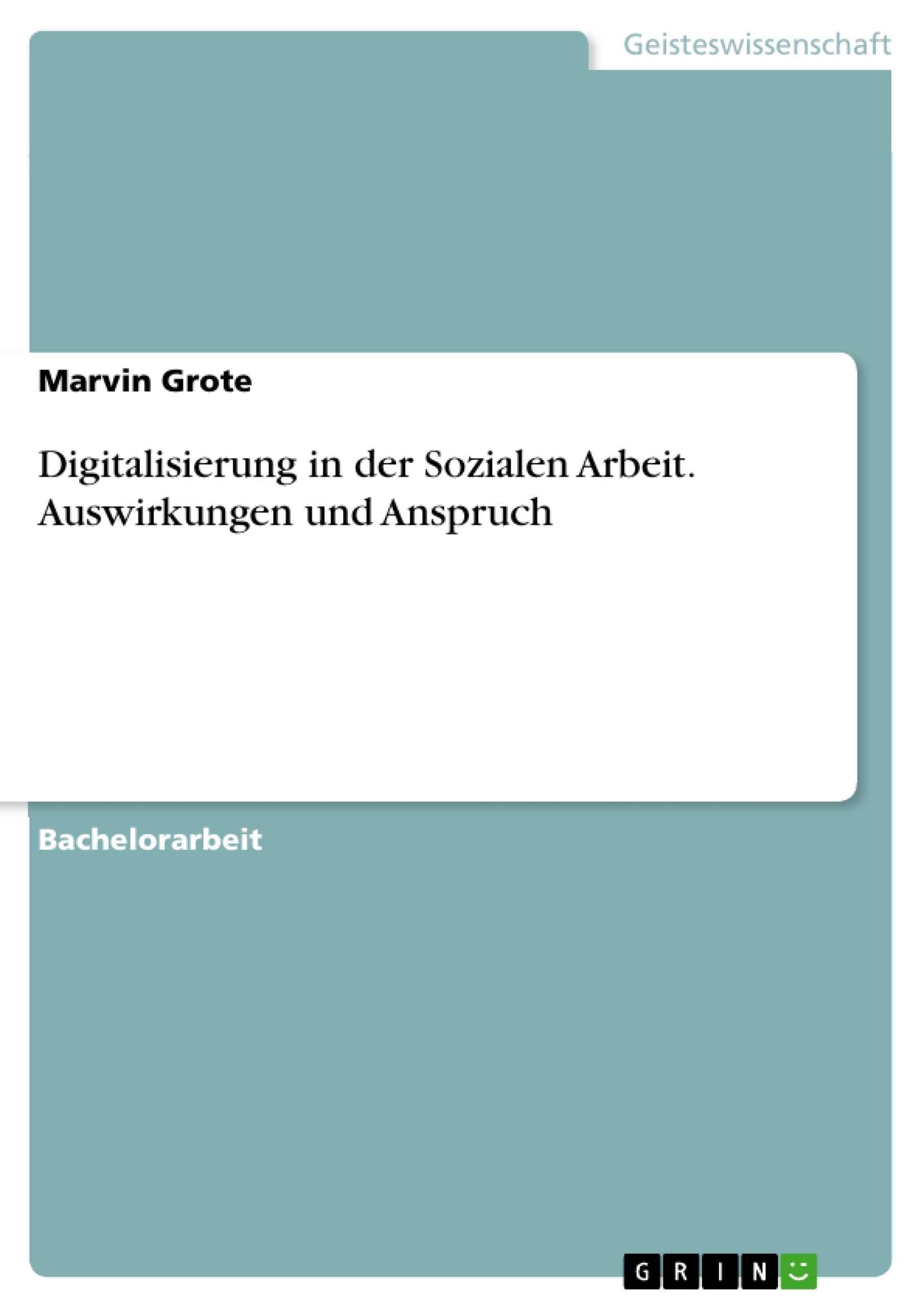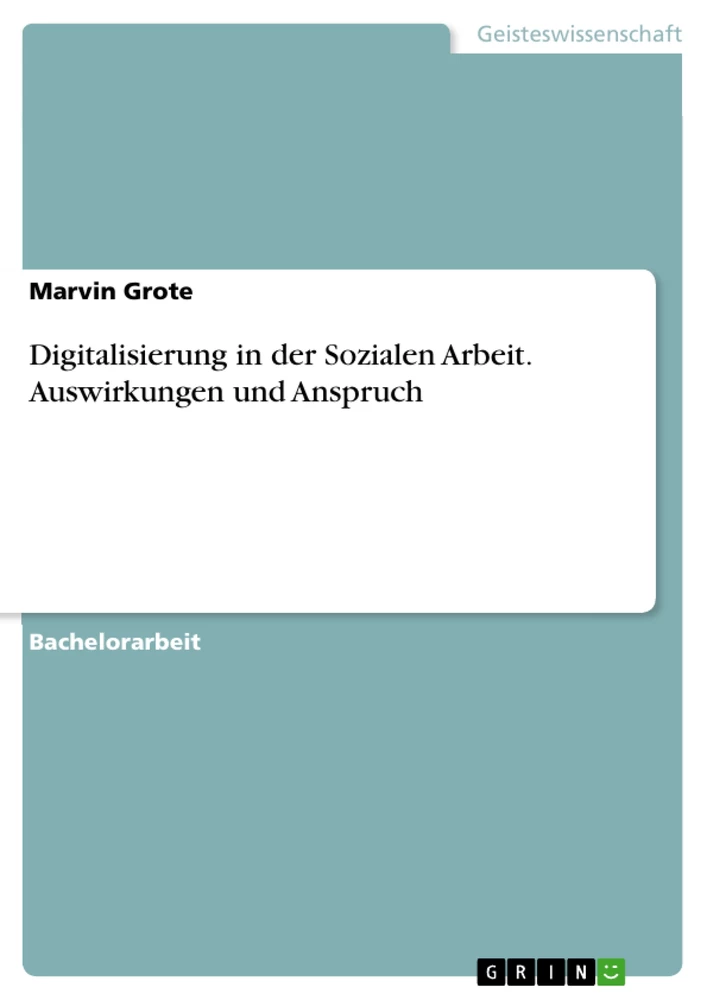
Digitalisierung in der Sozialen Arbeit. Auswirkungen und Anspruch
Bachelorarbeit, 2020
36 Seiten, Note: 2,5
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Stand der Forschung
- 3 Fragestellung der Bachelorarbeit
- 4 Methode und Vorgehensweise der Arbeit
- 5 Was ist unter dem Begriff Digitalisierung zu verstehen?
- 6 Neue Medien und Technologien
- 6.1 Was ist unter den „neuen Medien“ zu verstehen?
- 6.2 Medienkompetenz
- 6.3 Medienpädagogik
- 6.4 Technologischer Fortschritt
- 7 Auswirkung auf die Methoden der Sozialen Arbeit
- 7.1 Beratung
- 7.2 Lebensweltorientierung
- 7.3 Empowerment
- 8 Auswirkung auf den Bereich der Sozialen Arbeit
- 8.1 Digitalisierung und Dienstleistung in der Sozialen Arbeit
- 8.2 Professionalität
- 8.3 Veränderung in der Arbeitswelt
- 8.4 Auswirkung auf die Lebenswelt der Klienten
- 8.5 Auswirkung auf die Bedürfnisse der Klienten
- 8.6 Anspruch der Sozialen Arbeit an die Digitalisierung
- 8.7 Ethik und Moral
- 9 Diskussion
- 10 Fazit
- 11 Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die Auswirkungen neuer Medien und Technologien, die durch die Digitalisierung entstanden sind, auf die Soziale Arbeit. Es wird analysiert, inwiefern diese Veränderungen Chancen oder Risiken für die Soziale Arbeit und ihre Methoden darstellen und wie sich die Bedürfnisse der Klienten im Zuge der Digitalisierung verändern. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Frage, ob die Prinzipien der Sozialen Arbeit mit den Anforderungen der Digitalisierung vereinbar sind und wie eine professionelle und qualitative Arbeit unter diesen neuen Bedingungen sichergestellt werden kann.
- Auswirkungen der Digitalisierung auf die Methoden der Sozialen Arbeit
- Veränderungen in der Arbeitswelt der Sozialen Arbeit durch die Digitalisierung
- Anpassung der Sozialen Arbeit an die Bedürfnisse der Klienten im digitalen Kontext
- Ethische und moralische Herausforderungen der Digitalisierung in der Sozialen Arbeit
- Chancen und Risiken der Digitalisierung für die Soziale Arbeit
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Digitalisierung in der Sozialen Arbeit ein und beschreibt den zunehmenden Einfluss neuer Medien und Technologien auf diesen Bereich. Sie skizziert die zentralen Fragen der Arbeit, nämlich die Auswirkungen der Digitalisierung auf Methoden und Arbeitsweisen der Sozialen Arbeit sowie die damit verbundenen Chancen und Risiken. Die Einleitung stellt die Notwendigkeit der Anpassung der Sozialen Arbeit an den digitalen Wandel heraus und verweist auf bestehende Diskussionsansätze in diesem Kontext, wobei sowohl positive als auch negative Aspekte der Digitalisierung beleuchtet werden.
2 Stand der Forschung: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über den aktuellen Forschungsstand zum Thema Digitalisierung in der Sozialen Arbeit. Es werden verschiedene Beiträge und Initiativen erwähnt, die sich mit der Integration neuer Technologien in der Sozialen Arbeit beschäftigen, einschließlich des Einsatzes von Servicerobotern und medienpädagogischer Fortbildungen. Der Fokus liegt auf der Bedeutung der digitalen Teilhabe für Klienten und der Notwendigkeit, die Mitarbeiter und Klienten in den Gestaltungsprozess der digitalen Transformation einzubeziehen. Das Kapitel betont die Herausforderungen, aber auch das Potential der digitalen Welt für die Soziale Arbeit.
3 Fragestellung der Bachelorarbeit: In diesem Kapitel wird die zentrale Forschungsfrage der Arbeit präzisiert: Wie wirken sich neue Medien und Technologien auf die Soziale Arbeit und ihre Methoden aus? Die Arbeit soll untersuchen, ob die Prinzipien der Sozialen Arbeit mit der Digitalisierung vereinbar sind und ob der digitale Wandel eher eine Chance oder eine Gefahr darstellt. Der Fokus liegt dabei auf den Auswirkungen auf die Klienten und die Aufrechterhaltung einer professionellen und qualitativen Arbeit im digitalen Kontext. Das Kapitel beschreibt den Umfang und das Ziel der Bachelorarbeit als Übersichtsarbeit zu aktuellen und zukünftigen Fragen der Digitalisierung in der Sozialen Arbeit.
Schlüsselwörter
Digitalisierung, Soziale Arbeit, neue Medien, Technologien, Methoden der Sozialen Arbeit, Klienten, Professionalität, digitale Teilhabe, ethische Herausforderungen, Chancen und Risiken.
Häufig gestellte Fragen zur Bachelorarbeit: Auswirkungen der Digitalisierung auf die Soziale Arbeit
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Die Bachelorarbeit untersucht die Auswirkungen neuer Medien und Technologien, die durch die Digitalisierung entstanden sind, auf die Soziale Arbeit. Es wird analysiert, inwiefern diese Veränderungen Chancen oder Risiken für die Soziale Arbeit und ihre Methoden darstellen und wie sich die Bedürfnisse der Klienten im Zuge der Digitalisierung verändern.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf die Auswirkungen der Digitalisierung auf die Methoden der Sozialen Arbeit, Veränderungen in der Arbeitswelt, die Anpassung an die Bedürfnisse der Klienten im digitalen Kontext, ethische und moralische Herausforderungen sowie die Chancen und Risiken der Digitalisierung für die Soziale Arbeit.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, einen Überblick über den Stand der Forschung, die Formulierung der Forschungsfrage, ein Kapitel zu Methodik und Vorgehensweise, Kapitel über Digitalisierung, neue Medien und Technologien sowie deren Auswirkungen auf die Methoden und den Bereich der Sozialen Arbeit (Beratung, Lebensweltorientierung, Empowerment, Dienstleistungen, Professionalität, Veränderungen in der Arbeitswelt, Auswirkungen auf die Lebenswelt und Bedürfnisse der Klienten, ethische Aspekte), eine Diskussion, ein Fazit und ein Literaturverzeichnis.
Welche Forschungsfrage steht im Mittelpunkt?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Wie wirken sich neue Medien und Technologien auf die Soziale Arbeit und ihre Methoden aus? Es wird untersucht, ob die Prinzipien der Sozialen Arbeit mit der Digitalisierung vereinbar sind und ob der digitale Wandel eher eine Chance oder eine Gefahr darstellt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Digitalisierung, Soziale Arbeit, neue Medien, Technologien, Methoden der Sozialen Arbeit, Klienten, Professionalität, digitale Teilhabe, ethische Herausforderungen, Chancen und Risiken.
Welche Aspekte der Digitalisierung werden im Detail betrachtet?
Die Arbeit beleuchtet den Einfluss der Digitalisierung auf verschiedene Methoden der Sozialen Arbeit (z.B. Beratung, Empowerment), die Veränderungen in der Arbeitswelt der Sozialen Arbeit, die Anpassung an die Bedürfnisse der Klienten im digitalen Kontext und die damit verbundenen ethischen und moralischen Herausforderungen. Es werden sowohl Chancen als auch Risiken der Digitalisierung für die Soziale Arbeit diskutiert.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, ein umfassendes Bild der Auswirkungen der Digitalisierung auf die Soziale Arbeit zu zeichnen und zu analysieren, wie eine professionelle und qualitative Arbeit unter den neuen Bedingungen sichergestellt werden kann. Es soll untersucht werden, inwieweit die Prinzipien der Sozialen Arbeit mit den Anforderungen der Digitalisierung vereinbar sind.
Wie wird der aktuelle Forschungsstand berücksichtigt?
Die Arbeit bietet einen Überblick über den aktuellen Forschungsstand zum Thema Digitalisierung in der Sozialen Arbeit und bezieht verschiedene Beiträge und Initiativen, die sich mit der Integration neuer Technologien in der Sozialen Arbeit beschäftigen, mit ein.
Details
- Titel
- Digitalisierung in der Sozialen Arbeit. Auswirkungen und Anspruch
- Hochschule
- MSB Medical School Berlin - Hochschule für Gesundheit und Medizin
- Note
- 2,5
- Autor
- Marvin Grote (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2020
- Seiten
- 36
- Katalognummer
- V937720
- ISBN (eBook)
- 9783346266569
- ISBN (Buch)
- 9783346266576
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- digitalisierung sozialen arbeit auswirkungen anspruch
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 16,99
- Preis (Book)
- US$ 18,99
- Arbeit zitieren
- Marvin Grote (Autor:in), 2020, Digitalisierung in der Sozialen Arbeit. Auswirkungen und Anspruch, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/937720
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-