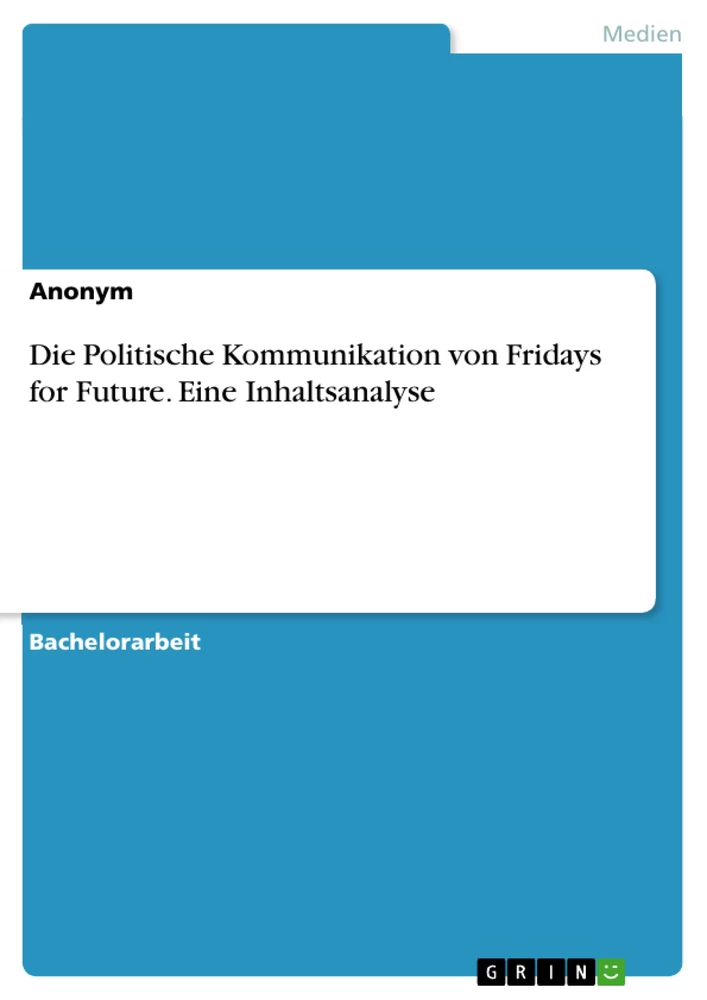
Die Politische Kommunikation von Fridays for Future. Eine Inhaltsanalyse
Bachelorarbeit, 2020
49 Seiten, Note: 2,0
Medien / Kommunikation - Medien und Politik, Pol. Kommunikation
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretischer Hintergrund
- Soziale Bewegungen
- Politische Kommunikation
- Außenkommunikation
- Binnenkommunikation
- Nachrichtenwerttheorie
- Empirischer Forschungsstand
- Hypothesen und Variablenmodell
- Hypothesen
- Entwicklung der Verwendung von Nachrichtenfaktoren
- Häufige Nachrichtenfaktoren
- Seltene Nachrichtenfaktoren
- Variablenmodell
- Hypothesen
- Methodisches Vorgehen
- Design
- Quantitative Inhaltsanalyse
- Codierung
- Indexbildung Nachrichtenwert
- Datenerhebung
- Besonderheiten bei der Inhaltsanalyse von Online-Inhalten
- Sample und Analyseschritte
- Zuverlässigkeit und Gültigkeit der Messung
- Reliabilität
- Validität
- Design
- Ergebnisse
- Darstellung
- Überprüfung der Hypothesen
- Sonstige Auffälligkeiten und Interpretation
- Kriteriums- und Inferenzvalidität
- Fazit
- Zusammenfassung
- Methodenkritik und Einschränkungen
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Bachelorarbeit untersucht die politische Kommunikation der Fridays for Future-Bewegung. Ziel ist es, die Strategien und Methoden der Bewegung im Hinblick auf die Vermittlung ihrer Botschaften an die Öffentlichkeit zu analysieren. Dabei werden sowohl die Außenkommunikation als auch die Binnenkommunikation der Bewegung betrachtet.
- Politische Kommunikation von sozialen Bewegungen
- Nachrichtenwerttheorie und deren Anwendung auf FFF
- Quantitative Inhaltsanalyse von Online-Inhalten
- Reliabilität und Validität der Messung
- Interpretation der Ergebnisse im Hinblick auf die politischen Botschaften von FFF
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Fridays for Future-Bewegung als ein Beispiel für die politische Aktivität junger Menschen in der heutigen Zeit vor und beleuchtet die Bedeutung von politischer Kommunikation für soziale Bewegungen.
- Theoretischer Hintergrund: Dieses Kapitel präsentiert die relevanten theoretischen Grundlagen für die Analyse der politischen Kommunikation von FFF. Dazu gehören die Konzepte der sozialen Bewegung, der politischen Kommunikation, insbesondere Außen- und Binnenkommunikation, und der Nachrichtenwerttheorie.
- Empirischer Forschungsstand: Hier wird der aktuelle Forschungsstand zu den Themen politischer Kommunikation von sozialen Bewegungen und der Nachrichtenwerttheorie in Bezug auf die Fridays for Future-Bewegung zusammengefasst.
- Hypothesen und Variablenmodell: Dieses Kapitel entwickelt Hypothesen über die Verwendung von Nachrichtenfaktoren in der Berichterstattung über FFF und definiert das Variablenmodell für die quantitative Inhaltsanalyse.
- Methodisches Vorgehen: Das methodische Vorgehen der Arbeit wird detailliert beschrieben, darunter die quantitative Inhaltsanalyse als Forschungsdesign, die Codierung von Daten, die Indexbildung des Nachrichtenwerts und die Datenerhebung.
- Ergebnisse: Die Ergebnisse der Inhaltsanalyse werden dargestellt und auf die Hypothesen bezogen. Es werden Auffälligkeiten in der Kommunikation von FFF analysiert und interpretiert.
Schlüsselwörter
Fridays for Future, politische Kommunikation, soziale Bewegungen, Nachrichtenwerttheorie, quantitative Inhaltsanalyse, Online-Inhalte, Nachrichtenfaktoren, Reliabilität, Validität
Häufig gestellte Fragen
Was untersucht die Bachelorarbeit zur Kommunikation von Fridays for Future (FFF)?
Die Arbeit analysiert die politische Online-Kommunikation von FFF in sozialen Netzwerken, insbesondere die Nutzung von Nachrichtenfaktoren zur Erzielung von Medienresonanz.
Welche Rolle spielt die Nachrichtenwerttheorie in dieser Untersuchung?
Die Theorie wird genutzt, um zu prüfen, welche Merkmale (Nachrichtenfaktoren) die Beiträge von FFF haben müssen, um von Medien und Öffentlichkeit als relevant wahrgenommen zu werden.
Welche Plattform wurde für die empirische Analyse ausgewählt?
Die Untersuchung konzentriert sich primär auf die Analyse von Twitter-Beiträgen der Bewegung.
Was ist der Unterschied zwischen Außen- und Binnenkommunikation bei sozialen Bewegungen?
Außenkommunikation richtet sich an die Öffentlichkeit und Medien, während Binnenkommunikation der internen Mobilisierung und Organisation der Mitglieder dient.
Welche Methode wurde zur Datenauswertung verwendet?
Es wurde eine quantitative Inhaltsanalyse durchgeführt, um die Häufigkeit und Entwicklung bestimmter Nachrichtenfaktoren statistisch zu erfassen.
Warum sind die Ergebnisse für zukünftige Interessengruppen relevant?
Andere Bewegungen können aus den Strategien von FFF lernen, wie man durch gezielte Kommunikation langanhaltende Aufmerksamkeit für politische Ziele generiert.
Details
- Titel
- Die Politische Kommunikation von Fridays for Future. Eine Inhaltsanalyse
- Hochschule
- Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf
- Note
- 2,0
- Autor
- Anonym (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2020
- Seiten
- 49
- Katalognummer
- V944270
- ISBN (eBook)
- 9783346278418
- ISBN (Buch)
- 9783346278425
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Politische Kommunikation Fridays for Future Inhaltsanalyse Nachrichtenwerttheorie Nachrichtenfaktoren FFF Soziale Bewegungen Protest Online-Kommunikation Außenkommunikation Quantitative Inhaltsanalyse Twitter-Beiträge Online-Inhalte
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 19,99
- Preis (Book)
- US$ 29,99
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2020, Die Politische Kommunikation von Fridays for Future. Eine Inhaltsanalyse, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/944270
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-









