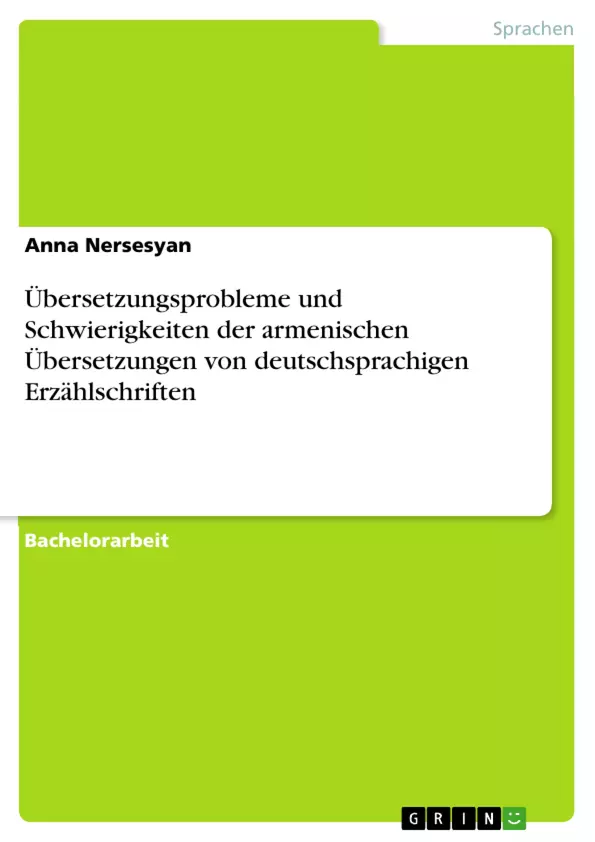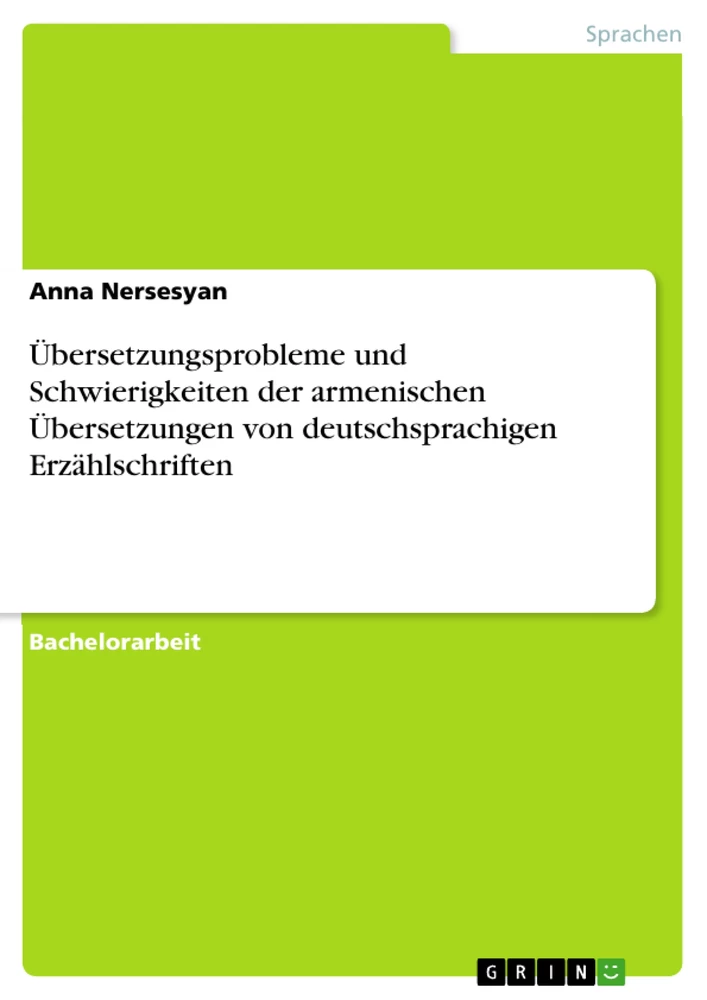
Übersetzungsprobleme und Schwierigkeiten der armenischen Übersetzungen von deutschsprachigen Erzählschriften
Bachelorarbeit, 2018
32 Seiten, Note: 100
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Was ist Übersetzen? Wie wird es definiert?
- Übersetzungsprobleme
- Weitere Übersetzungsprobleme
- Realien
- Ortsnamen
- Dialekt
- Transkription
- Metapher
- Übersetzungsschwierigkeiten
- Die Problematik der Bestimmung von Übersetzungsschwierigkeiten
- Schlussfolgerung
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Abschlussarbeit untersucht die Herausforderungen bei der Übersetzung deutschsprachiger Erzählschriften ins Armenische. Sie analysiert die spezifischen Probleme und Schwierigkeiten, die in diesem Übersetzungsprozess auftreten, und bietet mögliche Lösungen auf. Die Arbeit zielt darauf ab, ein tieferes Verständnis für die Komplexität des Übersetzungsprozesses zu schaffen und wichtige Aspekte der literarischen Übersetzung aufzuzeigen.
- Definition und Bedeutung des Übersetzens
- Analyse von Übersetzungsproblemen im Kontext der deutsch-armenischen Sprachpaarung
- Untersuchung der spezifischen Übersetzungsschwierigkeiten bei Erzählschriften
- Entwicklung von Lösungsansätzen für die auftretenden Probleme
- Bewertung des Einflusses von Kultur und Sprache auf die Übersetzung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der literarischen Übersetzung ein und stellt verschiedene Definitionen und Herangehensweisen vor. Sie beleuchtet die Komplexität des Übersetzungsprozesses und die Besonderheiten der Übersetzung von Erzählschriften.
Das erste Kapitel beschäftigt sich mit den Problemen, die bei der Übersetzung auftreten. Es wird die Theorie von Christiane Nord herangezogen, um verschiedene Arten von Problemen zu kategorisieren, darunter pragmatische, kulturspezifische, sprachpaarspezifische und ausgangstextsspezifische Übersetzungsprobleme. Die Untersuchung umfasst verschiedene Beispiele aus der schönen Literatur, die die Herausforderungen beim Übersetzen von Realien, Ortsnamen, Dialekten, Transkriptionen und Metaphern aufzeigen.
Das zweite Kapitel behandelt die spezifischen Schwierigkeiten, die beim Übersetzen von Erzählschriften auftreten. Es geht dabei um fehlende Informationen und subjektive Interpretationen, die den Übersetzungsprozess beeinflussen können. Die Kapitel bezieht sich auf wichtige Arbeiten von Christiane Nord, Werner Koller, Wolfram Wills, Magloire Fokoua, Friedmar Apel und Annette Kopetzki.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Herausforderungen der literarischen Übersetzung, insbesondere im Kontext der deutsch-armenischen Sprachpaarung. Wichtige Themen sind Übersetzungsprobleme, Übersetzungsschwierigkeiten, Äquivalenz, Realien, Ortsnamen, Dialekte, Transkription, Metaphern, Kultur, Sprache und Sprachpaarspezifität.
Details
- Titel
- Übersetzungsprobleme und Schwierigkeiten der armenischen Übersetzungen von deutschsprachigen Erzählschriften
- Note
- 100
- Autor
- Anna Nersesyan (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2018
- Seiten
- 32
- Katalognummer
- V948394
- ISBN (eBook)
- 9783346290359
- ISBN (Buch)
- 9783346290366
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- übersetzungsprobleme schwierigkeiten übersetzungen erzählschriften
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 16,99
- Preis (Book)
- US$ 18,99
- Arbeit zitieren
- Anna Nersesyan (Autor:in), 2018, Übersetzungsprobleme und Schwierigkeiten der armenischen Übersetzungen von deutschsprachigen Erzählschriften, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/948394
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-