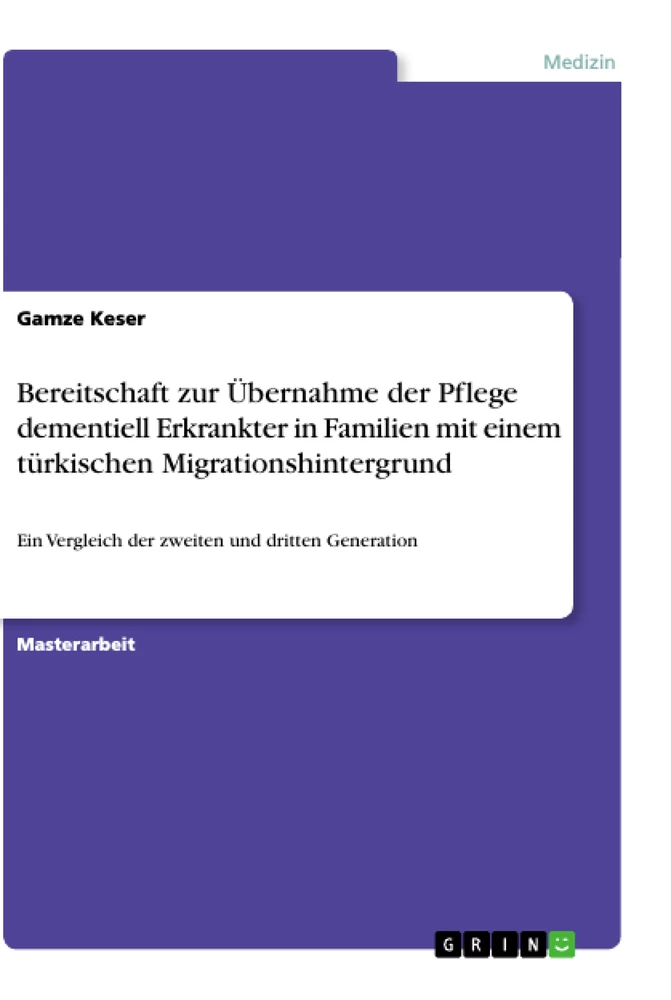
Bereitschaft zur Übernahme der Pflege dementiell Erkrankter in Familien mit einem türkischen Migrationshintergrund
Masterarbeit, 2020
119 Seiten, Note: 1,5
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Abstract
- Danksagung
- Kapitel 1: Einleitung
- Kapitel 2: Theoretische Grundlagen
- Kapitel 3: Forschungsmethodik
- Kapitel 4: Ergebnisse
- Kapitel 5: Diskussion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Masterarbeit untersucht die Bereitschaft zur Übernahme der Pflege demenziell Erkrankter in Familien mit türkischem Migrationshintergrund, indem sie die zweite und dritte Generation vergleicht. Die Arbeit analysiert die Akkulturationsstrategien und deren Einfluss auf das familiäre Pflegeverhalten. Die Ergebnisse sollen Aufschluss darüber geben, wie sich die Bereitschaft zur Pflege und die Inanspruchnahme professioneller Unterstützung zwischen den Generationen unterscheidet.
- Familiäre Pflege von Demenzkranken in Familien mit türkischem Migrationshintergrund
- Generationsübergreifende Unterschiede im Pflegeverhalten
- Einfluss von Akkulturationsstrategien auf die Pflegebereitschaft
- Inanspruchnahme professioneller Pflegeleistungen
- Herausforderungen des Gesundheitssystems im Umgang mit multikultureller Demenzpflege
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1: Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik der Demenzpflege in multikulturellen Gesellschaften ein und hebt die besondere Herausforderung der alternden Gastarbeitergeneration hervor. Es stellt die Forschungsfrage nach der Bereitschaft zur Pflegeübernahme in der zweiten und dritten Generation türkischstämmiger Familien in den Fokus und skizziert den Aufbau der Arbeit.
Kapitel 2: Theoretische Grundlagen: Dieses Kapitel beleuchtet die theoretischen Grundlagen der Arbeit, indem es relevante Konzepte und Theorien zur Demenz, Migration und Akkulturation vorstellt. Es wird insbesondere auf die Akkulturationsmodelle von Berry und Goldenberg eingegangen und deren Relevanz für die Untersuchung des familiären Pflegeverhaltens herausgestellt. Dieser Abschnitt liefert das notwendige theoretische Fundament für die Interpretation der empirischen Ergebnisse.
Kapitel 3: Forschungsmethodik: Hier wird die methodische Vorgehensweise der Studie detailliert beschrieben. Es werden die gewählten Forschungsmethoden (Experteninterviews und leitfadengestützte problemzentrierte Interviews) erläutert, die Stichprobenbeschreibung (zweite und dritte Generation türkischstämmiger Familien in Gelsenkirchen und Dinslaken) dargelegt und das Vorgehen bei der Datenauswertung beschrieben. Die Kapitel beschreibt die methodischen Schritte zur Gewährleistung der wissenschaftlichen Qualität der Studie.
Kapitel 4: Ergebnisse: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der durchgeführten Interviews. Es werden die erhobenen Daten systematisch dargestellt und analysiert, wobei die verschiedenen Aspekte der Akkulturation (sprachlich, kulturell, religiös und familiäres Pflegeverhalten) im Kontext der Pflegebereitschaft der zweiten und dritten Generation beleuchtet werden. Die Ergebnisse bilden die empirische Basis für die Diskussion im folgenden Kapitel.
Kapitel 5: Diskussion: In diesem Kapitel werden die Ergebnisse interpretiert und im Kontext der theoretischen Grundlagen diskutiert. Die Unterschiede in der Pflegebereitschaft zwischen den Generationen werden analysiert und im Lichte der Akkulturationsstrategien erklärt. Das Kapitel schließt mit einer Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse und Schlussfolgerungen sowie Implikationen für die Praxis und die zukünftige Forschung.
Schlüsselwörter
Demenz, Migration, türkischer Migrationshintergrund, intergenerationelle Pflege, Akkulturation, Familienpflege, professionelle Pflege, Generationenvertrag, Gelsenkirchen, Dinslaken, Experteninterviews, qualitative Forschung.
Häufig gestellte Fragen zur Masterarbeit: Familiäre Pflege von Demenzkranken in Familien mit türkischem Migrationshintergrund
Was ist das Thema der Masterarbeit?
Die Masterarbeit untersucht die Bereitschaft zur Übernahme der Pflege demenziell Erkrankter in Familien mit türkischem Migrationshintergrund, insbesondere den Vergleich zwischen der zweiten und dritten Generation. Ein Schwerpunkt liegt auf der Analyse von Akkulturationsstrategien und deren Einfluss auf das familiäre Pflegeverhalten.
Welche Forschungsfragen werden behandelt?
Die Arbeit untersucht, wie sich die Bereitschaft zur Pflege und die Inanspruchnahme professioneller Unterstützung zwischen der zweiten und dritten Generation türkischstämmiger Familien unterscheidet. Sie analysiert den Einfluss verschiedener Akkulturationsstrategien auf das familiäre Pflegeverhalten.
Welche Methoden wurden verwendet?
Die Studie verwendet qualitative Forschungsmethoden, konkret Experteninterviews und leitfadengestützte problemzentrierte Interviews. Die Stichprobe umfasst Familien mit türkischem Migrationshintergrund in Gelsenkirchen und Dinslaken (zweite und dritte Generation).
Welche theoretischen Grundlagen werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf Theorien zur Demenz, Migration und Akkulturation, insbesondere auf die Akkulturationsmodelle von Berry und Goldenberg. Diese Modelle helfen, das familiäre Pflegeverhalten im Kontext der Akkulturation zu verstehen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Theoretische Grundlagen, Forschungsmethodik, Ergebnisse und Diskussion. Die Einleitung führt in die Thematik ein, die theoretischen Grundlagen werden im zweiten Kapitel dargelegt, die Methodik im dritten, die Ergebnisse im vierten und die Diskussion und Schlussfolgerung im fünften Kapitel.
Wer ist die Zielgruppe der Studie?
Die Studie richtet sich an Wissenschaftler, Praktiker im Gesundheitswesen, insbesondere im Bereich der Demenzpflege, sowie an alle, die sich für die Herausforderungen der multikulturellen Demenzpflege interessieren.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Demenz, Migration, türkischer Migrationshintergrund, intergenerationelle Pflege, Akkulturation, Familienpflege, professionelle Pflege, Generationenvertrag, Gelsenkirchen, Dinslaken, Experteninterviews, qualitative Forschung.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Kapitel 4 präsentiert die Ergebnisse der durchgeführten Interviews. Die erhobenen Daten werden systematisch dargestellt und analysiert, wobei die verschiedenen Aspekte der Akkulturation (sprachlich, kulturell, religiös) im Kontext der Pflegebereitschaft der zweiten und dritten Generation beleuchtet werden.
Wie werden die Ergebnisse diskutiert?
In Kapitel 5 werden die Ergebnisse interpretiert und im Kontext der theoretischen Grundlagen diskutiert. Die Unterschiede in der Pflegebereitschaft zwischen den Generationen werden analysiert und im Lichte der Akkulturationsstrategien erklärt. Das Kapitel beinhaltet eine Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse, Schlussfolgerungen und Implikationen für die Praxis und zukünftige Forschung.
Details
- Titel
- Bereitschaft zur Übernahme der Pflege dementiell Erkrankter in Familien mit einem türkischen Migrationshintergrund
- Untertitel
- Ein Vergleich der zweiten und dritten Generation
- Hochschule
- Universität Witten/Herdecke
- Note
- 1,5
- Autor
- Gamze Keser (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2020
- Seiten
- 119
- Katalognummer
- V950845
- ISBN (eBook)
- 9783346291660
- ISBN (Buch)
- 9783346291677
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Migrationshintergrund und Bereitschaft zur Pflegeübernahme Vergleich zweiter und dritter Generation in türkeistämmigen Familien Demenz und Migration Kultursensibilität
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 38,99
- Preis (Book)
- US$ 49,99
- Arbeit zitieren
- Gamze Keser (Autor:in), 2020, Bereitschaft zur Übernahme der Pflege dementiell Erkrankter in Familien mit einem türkischen Migrationshintergrund, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/950845
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-









