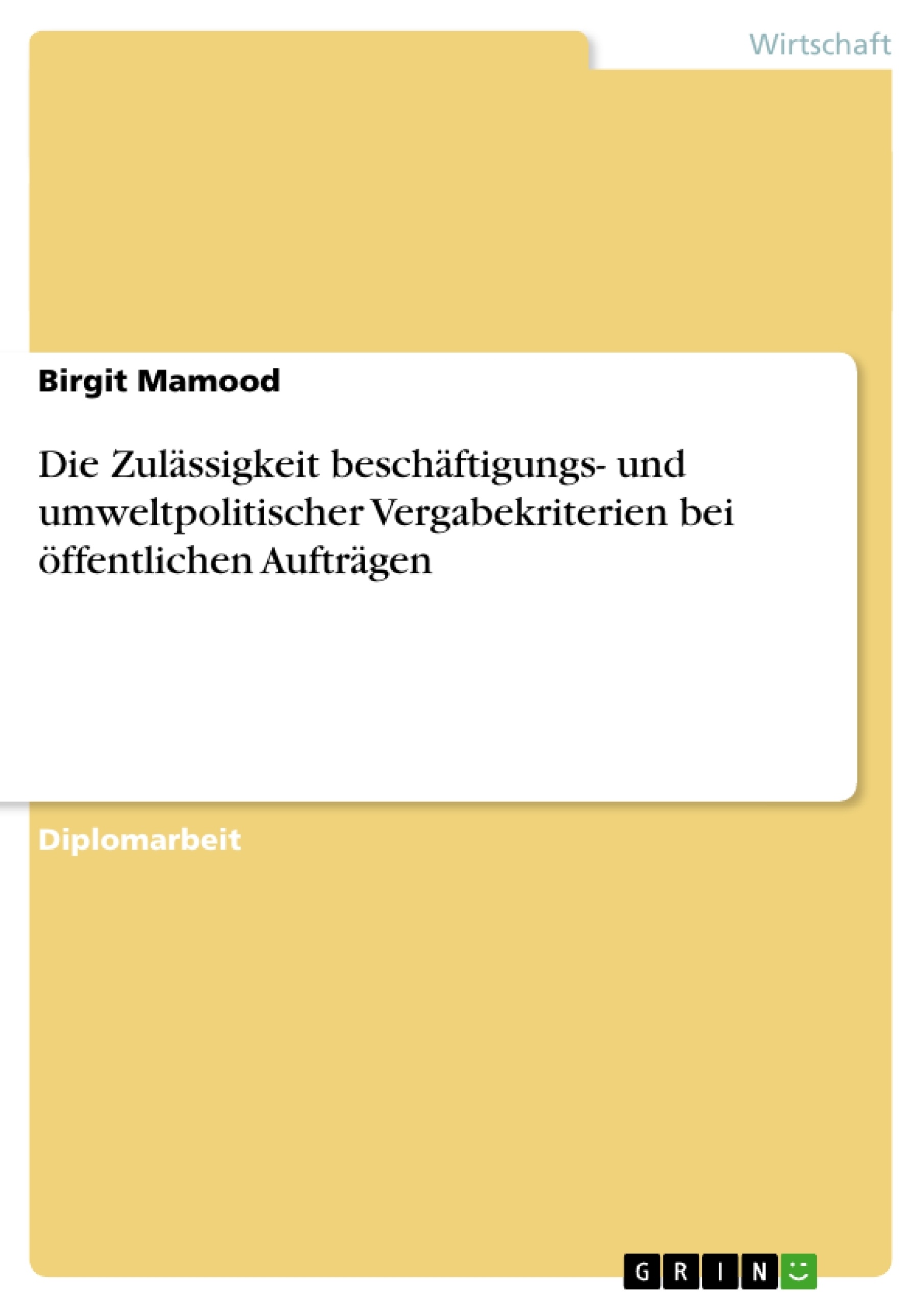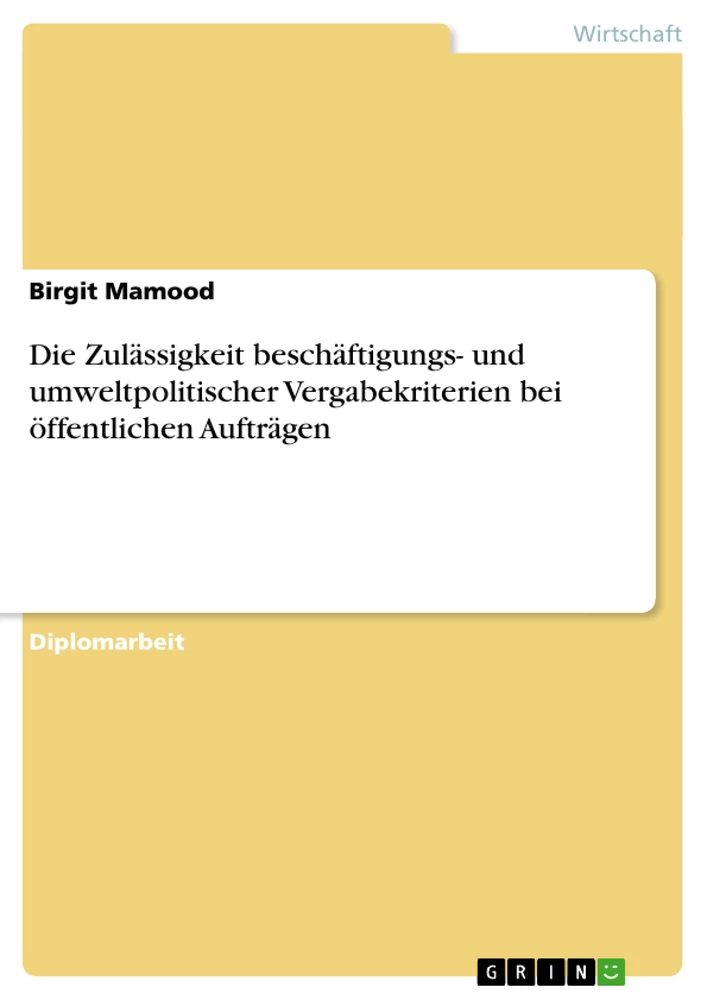
Die Zulässigkeit beschäftigungs- und umweltpolitischer Vergabekriterien bei öffentlichen Aufträgen
Diplomarbeit, 1999
42 Seiten, Note: 1,75
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Gemeinschaftsrechtliche Vergaberegeln
2.1 Sinn, Zweck und Ziele des gemeinschaftsrechtlichen Vergaberechts
2.2 Adressaten des EG Vergaberechts
2.3 Struktur des europäischen Vergaberechts
2.3.1 Der EG-Vertrag als primärrechtlicher Rahmen
2.3.2 Die Vergaberichtlinien
2.3.3 Verfahrensarten
2.4 Zwischenergebnis aus 2
3 Grundzüge des öffentlichen Auftragswesens in der Bundesrepublik Deutschland
3.1 Sinn, Herkunft, Ziele und Struktur des deutschen Vergaberechts
3.1.1 Prinzipien des deutschen Vergaberechts
3.1.2 Rechtsschutz im deutschen Vergaberecht
3.1.3 Verfahrensarten im deutschen Vergaberecht
3.2 Zwischenergebnis aus 3
4 Der Grenzbereich erweiterter Vergabekriterien
4.1 Was sind herkömmliche Vergabekriterien?
4.1.1 Zugangskriterien
4.1.2 Ausschlußkriterien
4.1.3 Eignungskriterien
4.1.4 Zuschlagskriterien
4.2 Was sind erweiterte Vergabekriterien?
4.2.1 Wirtschaftlich-politische Kriterien
4.2.2 Soziale Kriterien
4.2.3 Umweltkriterien
4.3 Welchen Sinn machen erweiterte Vergabekriterien?
4.4 Die rechtliche Zulässigkeit erweiterter Vergabekriterien
4.4.1 Zulässigkeit von Umweltkriterien
4.4.2 Zulässigkeit beschäftigungspolitischer und sozialer Kriterien
4.5 Zwischenergebnis aus 4
5 Fazit
Abkürzungsverzeichnis
Literaturverzeichnis
Verzeichnis der zitierten EuGH-Entscheidungen
Anhang
1 Einleitung
In der Bundesrepublik gerät das öffentliche Auftragswesen meistens dann in das Kreuzfeuer öffentlicher Kritik, wenn der Bund der Steuerzahler oder ein Rechnungshof wieder einmal auflisten, wo bei öffentlichen Aufträgen Geld ver- schwendet wurde. Die Rechnungsprüfer schätzen z.B., daß die Kosten bei der Vergabe öffentlicher Bauaufträge in Hamburg um 10% gedrosselt werden könnten.1 Die Verärgerung der Bevölkerung ist verständlich, wenn man bedenkt, daß europaweit jeder Unionsbürger durchschnittlich 2.000 ECU im Jahr für Auf- träge des Staates ausgibt.2 Doch kaum jemandem ist klar, nach welchen Kri- terien die öffentlichen Auftraggeber handeln und welchen Vorschriften sie unter- liegen.
Das deutsche Vergaberecht unterliegt zum einen nationalen und zum anderen übergeordneten internationalen Vorschriften. Die Grundlagen der Vergaberegeln umfassen auf supranationaler Ebene, neben der Charta der Vereinten Nationen, das WTO-Abkommen bezüglich des öffentlichen Beschaffungswesens (GPA), den EWR-Vertrag und bilaterale Abkommen.3 Da sich diese Arbeit mit einem sehr speziellen Aspekt des öffentlichen Beschaffungswesens beschäftigt, würde eine dezidierte Betrachtung der supranationalen Vorschriften den Rahmen der zu behandelnden Thematik sprengen. Obwohl zweifellos auch das universelle Völkervertragsrecht Auswirkungen auf das deutsche Vergaberecht hat4, ist für die eigentliche Fragestellung, nämlich die Zulässigkeit sozialer und umweltpolitischer Kriterien im öffentlichen Beschaffungswesen, vornehmlich regionales und nationales Vergaberecht von Belang.
Folgerichtig soll in Kapitel 2 zunächst auf die europarechtlichen Rahmen- bedingungen und im dritten Kapitel dann auf die deutschen Regelungen für die Vergabe öffentlicher Aufträge eingegangen werden. Im vierten Kapitel wird dann die eigentliche Fragestellung, nämlich die Zulässigkeit erweiterter Vergabe- kriterien, unter besonderer Berücksichtigung von Umwelt- und Sozialgesichts- punkten, behandelt. Hierbei wird sowohl auf den wirtschaftlichen bzw. politischen Sinn und Zweck als auch auf die rechtliche Zulässigkeit erweiterter Ver- gabekriterien eingegangen. Auf der Grundlage dieser Ergebnisse folgt dann in Kapitel 5 ein Fazit.
2 Gemeinschaftsrechtliche Vergaberegeln
Bezüglich europäischen Gemeinschaftsrechts gilt der Grundsatz, daß dieses grundsätzlich dem nationalen Recht übergeordnet ist. Der EG-Vertrag von 1957 ist für alle Mitgliedstaaten verbindlich. Seine Bestimmungen müssen umgesetzt werden. Meistens wurden die umzusetzenden Bestimmungen mit Hilfe des Sekundärrechts konkretisiert, d.h. mit Hilfe von Richtlinien und Verordnungen. Während Verordnungen in den Mitgliedstaaten unmittelbare Rechtswirkung entfalten, enthalten Richtlinien lediglich eine Zielvorgabe. Nach dem Subsidia- ritätsprinzip muß der Mitgliedstaat die konkrete Umsetzung in nationale Gesetze hier selbst leisten. Im öffentlichen Beschaffungswesen spielen Verordnungen eher eine sekundäre Rolle, während das Schwergewicht auf den Richtlinien liegt.
2.1 Sinn, Zweck und Ziele des gemeinschaftsrechtlichen Vergaberechts
In der Europäischen Gemeinschaft gaben öffentliche Auftraggeber 1996 etwa 720 Mrd. ECU für Waren und Dienstleistungen aus. Das waren 11% des Bruttoinlandsprodukts der EU,5 wobei 60% dieser Aufträge auf den Bereich Bau entfielen.6 Öffentliche Aufträge machen also einen nicht unbeträchtlichen Teil des in Art. 14 Abs. 2 EGV n.F. definierten Binnenmarktes aus. Voraussetzung für einen funktionierenden Binnenmarkt sind auch die ebenfalls im EGV normierten vier Grundfreiheiten: die Freizügigkeit7, die Warenverkehrsfreiheit8, die Dienstleistungsfreiheit9 und der freie Kapitalverkehr10. Die Europäische Kommission sieht die Verwirklichung insbesondere der letztgenannten drei Grundfreiheiten als Voraussetzung für wirtschaftliches Wachstum und damit letztendlich auch für eine wirksame Beschäftigungspolitik an.11 „Konkret bedeutet diese Zielvorgabe für das öffentliche Auftragswesen, daß die Vergabe von Staatsaufträgen grenzüberschreitend und möglichst ungehindert stattfinden soll.“12
Ein anderes erklärtes Ziel der Harmonisierung gemeinschaftsrechtlicher Ver- gabepraktiken ist die Herstellung eines wettbewerbsorientierten Beschaffungs- marktes. Für die Bieter bedeutet dies, daß sie sich darauf einstellen müssen, künftig mit Unternehmen aus anderen Mitgliedstaaten konkurrieren zu müssen. Für die öffentlichen Auftraggeber bedeutet der grenzüberschreitende Beschaf- fungsmarkt hingegen der Abschied von alten Gewohnheiten. Bis 1993 wurden lediglich 1 - 2 % der öffentlichen Aufträge an ausländische Bewerber vergeben.13
Ein anderes Ziel der EG bei der Harmonisierung des öffentlichen Auftragswesens ist die rationelle „Verwendung öffentlicher Mittel durch die Wahl des besten Angebots“.14 Die Europäische Kommission geht davon aus, daß aus einem größeren Angebot und mehr Wettbewerb auch automatisch ein effizienteres Beschaffungswesen mit positiven Effekten wie Einsparungen in den öffentlichen Haushalten etc. folgen müsse.15
2.2 Adressaten des EG Vergaberechts
Der traditionelle Begriff des öffentlichen Auftraggebers hat sich insbesondere durch die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs16 und durch die Sektorenrichtlinie17 gewandelt. An die Stelle einer rein formalen Definition dessen, was ein öffentlicher Auftraggeber sei, ist eine funktionale Sichtweise getreten. Die formale Rechtspersönlichkeit des Auftraggebers tritt hierbei in den Hintergrund und die Betrachtung seines tatsächlichen Aufgabenfeldes in den Vordergrund. Maßgeblich ist beispielsweise lt. Art. 1 b der BKR, LKR, DKR und SKR, ob die zu erfüllende Aufgabe
- im Allgemeininteresse liegt
- ob sie nicht-gewerblicher Art ist
- entweder in staatlicher Hand ist oder „überwiegend vom Staat...finanziert wird“ bzw. ob der Staat maßgebliche Mitspracherechte z.B. in den Aufsichtsgremien hat.
Damit wurde u.a. dem Bestreben einzelner Mitgliedstaaten Rechnung getragen, vor den strengen Vorgaben des europäischen Vergaberechts in private Rechtsformen zu flüchten.18 Die Parteien argumentierten dann typischerweise, daß die Vergaberichtlinien nicht anwendbar seien, da es sich um einen privaten Auftraggeber handele und mithin auch auf die vorgeschriebenen Verfahrensregeln keine Rücksicht genommen zu werden brauche.19 Nach h.L. soll deshalb folgerichtig mit einer Änderung des Begriffsverständnisses von „öffentlichem Auftraggeber“ weniger eine Ausweitung des Adressatenkreises erreicht, sondern vielmehr der „alte“ Geltungsbereich der Vergaberichtlinien gewährleistet werden.20
2.3 Struktur des europäischen Vergaberechts
Im Folgenden wird sowohl auf die für das Vergaberecht maßgeblichen Bestim- mungen des EG-Vertrages als auch auf das daraus resultierende Sekundärrecht eingegangen.
2.3.1 Der EG-Vertrag als primärrechtlicher Rahmen
„Bei näherer Betrachtung des EWG-Vertrages läßt sich feststellen, daß eine ausdrückliche Regelung des öffentlichen Beschaffungswesens fehlt.“21 Daraus sollte jedoch nicht gefolgert werden, daß der EGV nicht auf das öffentliche Be- schaffungswesen anwendbar sei. Nach h.L. sind hierbei vor allen Dingen die schon in Kapitel 2.1 angeführten Grundfreiheiten maßgeblich22 insbesondere Art. 28 EGV ff., der sich mit dem Verbot von mengenmäßigen Beschränkungen zwischen den Mitgliedstaaten befaßt. Diese Rechtsnormen werden im Allgemeinen als Ausfluß der in Art. 14 EGV n.F. angestrebten Verwirklichung des Binnenmarktes gesehen.23 Ob das in Art. 12 f. EGV n.F. normierte allgemeine Diskriminierungsverbot ebenfalls eine entscheidende Rolle spielt, wird mehrheitlich verneint. Die Warenverkehrsfreiheit stellt zwar in gewisser Hinsicht eine Konkretisierung des allgemeinen Diskriminierungsverbots dar, hat aber dennoch nicht den Charakter einer lex specialis, die das Diskriminierungsverbot vollständig verdrängen würde.24 Die Europäische Kommission hat ihre Liberalisierungs- und Koordinierungsrichtlinie25 ebenfalls nicht auf Art. 6, sondern auf Art. 30 EGV a.F. gestützt. Auch der EuGH stellte bisher in seinen Urteilen regelmäßig eher auf die Warenverkehrsfreiheit ab, als auf die Diskriminierung ausländischer Bieter.26 „Somit bleibt festzuhalten, daß auch auf dem Gebiet desöffentlichen Auftragswesens der Art. 30 EGV als wesentlicher primärrechtlicher Überprüfungsmaßstab heranzuziehen ist.“27 Doch inwieweit findet die Warenverkehrsfreiheit bei der Vergabe öffentlicher Aufträge überhaupt Anwendung?
Bei der Ausschreibung gibt es folgende Möglichkeiten, den freien Warenverkehr unmittelbar oder mittelbar zu behindern:
- Die Ausschreibung wird überhaupt nicht bekannt gemacht.
- Der Auftrag wird nur in nationalen Publikationen ausgeschrieben.
- Es werden ohne sachlich zwingenden Grund bestimmte technische Merkmale vorausgesetzt, die nur inländische Bieter erfüllen können.
- Es dürfen sich nur Bieter bewerben, die die inländische Staatsangehörigkeit besitzen (Dies wäre auch ein grober Verstoß gegen Art. 12 f. EGV n.F.)
- Es wird verlangt, daß der Bieter in einem nationalen Berufsregister eingetragen ist.
- Es werden nur inländische Bescheinigungen für die Leistungsfähigkeit des Bieters akzeptiert.
- Die Bewerbungsfristen sind so kurz bemessen, daß praktisch nur inländische Bieter sie einhalten können.
Doch selbst, wenn die Ausschreibung ordnungsgemäß erfolgt ist, gibt es noch zahlreiche Möglichkeiten, inländische Bieter bei der Erteilung des Zuschlags zu bevorzugen:
- Ausländische Waren werden durch Rechts- oder Verwaltungsvorschriften künstlich verteuert, so daß ausländische Bieter am Wirtschaftlichkeitsgebot scheitern.
- Es wird verlangt, daß die Lieferanten eine inländische Bankverbindung haben.
- Ausländische Waren werden nur zugelassen, wenn im Gegenzug versichert wird, daß der betreffende Mitgliedstaat in Zukunft Waren und Dienstleistungen bevorzugt aus dem Staat bezieht, zu dem der öffentliche Auftraggeber gehört.
- Lieferanten aus dem Ausland werden bei Sicherheits- und Abschlags- zahlungen anders behandelt als inländische.
- Es werden erweiterte Zuschlagskriterien eingebaut (siehe Kap. 4).28
Die Motive für die Abschottung nationaler Beschaffungsmärkte liegen auf der Hand: Neben der klassischen Versorgungsfunktion verfolgen die öffentlichen Auftraggeber oft auch makroökonomische, soziale oder sonstige politische Ziele.29 Inwieweit solche Kriterien bei der Vergabe öffentlicher Aufträge zulässig sind, ist die Kernfrage dieser Arbeit und wird in Kapitel 4 ausführlich behandelt.
2.3.2 Die Vergaberichtlinien
Das Vergaberecht gehört zu den Bereichen, die ein überproportional großes Umsetzungsdefizit in den Mitgliedstaaten aufweisen, wobei die Richtlinien ent- weder nicht rechtzeitig oder nicht korrekt umgesetzt werden.30 Bis November 1997 waren lediglich 56% der Vergaberichtlinien korrekt umgesetzt worden.31 Für das Vergaberecht sind zwei Regelungsbereiche zu unterscheiden: die Rechtsmittelrichtlinien, auch Überwachungsrichtlinien genannt, und die ma- teriellen Richtlinien.
Die materiellen Vergaberichtlinien enthalten Vorschriften über die jeweils zu wählende Verfahrensart einschließlich der Festlegung von Schwellenwerten sowie Kriterien bezüglich des zu berücksichtigenden Bieterkreises und der Zu- schlagserteilung.32
Als erster Schritt zur Schaffung eines gemeinsamen Vergabemarktes wurde 1971 die Baukoordinierungsrichtlinie erlassen.33 1993 erfolgte eine vollständige Neufassung.34 Die BKR erstreckt sich sowohl auf die Planung als auch auf die Ausführung sowohl von ganzen Bauvorhaben als auch von Teilleistungen. Die Baurichtlinie braucht aber nur berücksichtigt zu werden, wenn der Wert des Auftrags den Schwellenwert von 5 Mio. ECU überschreitet.
Die erste Lieferkoordinierungsrichtlinie wurde 1977 beschlossen.35 1993 erfolgte eine vollständige Neufassung.36 Der Anwendungsbereich der Lieferrichtlinie erstreckt sich auf Verträge über Kauf, Leasing, Miete, Pacht und Ratenkauf. Auch Nebenarbeiten wie die Installation, das Verlegen oder Anbringen von gelieferten Waren werden von der LKR erfaßt. Dabei ist es unwesentlich, ob auf die gelieferten Waren eine Kaufoption besteht oder nicht. Die LKR gilt ab einem Schwellenwert von 200.000 ECU.
„Mit der Dienstleistungsrichtlinie 92/50/EWG37 sollte die Erfassung des gesamten Bereichs des Vergabewesens der öffentlichen Hand durch Gemeinschaftsvorschriften abgeschlossen werden.“38 Von der DKR werden deshalb alle Dienstleistungsverträge erfaßt, die nicht schon von anderen Richtlinien erfaßt bzw. nicht ausdrücklich in Art. 1 a der DKR ausgeschlossen werden. Der Schwellenwert beträgt wie bei der LKR 200.000 ECU.
Kommen bei einem Auftrag mehrere Richtlinien in Frage, soll diejenige zur An- wendung kommen, die für den Teil mit dem höchsten Wert gilt. Damit soll ver- mieden werden, daß bei einer geschickten Kombination verschiedener Auf- tragsarten (z.B. eines Bauauftrags in Kombination mit Lieferaufträgen) die Schwellenwerte absichtlich unterschritten werden, um den Anwendungsbereich der Richtlinien zu umgehen.39
Mit der 1990 verabschiedeten Sektorenrichtlinie40 wurde versucht, Auftraggeber die zwar keine öffentlichen Auftraggeber im traditionellen Sinne sind, die aber gleichwohl Versorgungsaufgaben wahrnehmen, die sonst eine staatliche Insti- tution wahrnehmen müßte, in das öffentliche Vergaberecht einzubeziehen. Typischerweise umfaßt die SKR deshalb die Wasser-, Energie- und Verkehrs- versorgung sowie den Telekommunikationssektor. Eine Neufassung, die u.a. auch Dienstleistungsaufträge in die Richtlinie einbezog, erfolgte 1993.41 Die Schwellenwerte betragen für Liefer- und Dienstleistungsaufträge von Auftrag- gebern der Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung 400.000 ECU, bei Liefer- und Dienstleistungsaufträgen aus dem Telekommunikationsbereich 600.000 ECU. Bei Bauaufträgen bleibt es, unabhängig von der Art des Sek- torenauftraggebers, bei einem Schwellenwert von 5 Mio. ECU.42
Der Gegenstand der Sektorenrichtlinie ist also, im Gegensatz zu den anderen materiellen Vergaberichtlinien, weniger die Art des zu vergebenden Auftrags sondern eine (erweiterte) Definition und des öffentlichen Auftraggebers. Diese Definition geht naturgemäß über die formale Rechtspersönlichkeit der in der Richtlinie berücksichtigten Institutionen hinaus. Ein öffentliches Unternehmen ist nach Art. 1 Ziffer 2 der RL 93/38/EWG „jedes Unternehmen, auf das die staat- lichen Behörden aufgrund von Eigentum, finanzieller Beteiligung oder der für das Unternehmen einschlägigen Vorschriften unmittelbar oder mittelbar einen beherrschenden Einfluß ausüben können“. Ob es sich formaljuristisch hierbei um ein privates oder staatliches Unternehmen bzw. eine Mischform zwischen beidem handelt ist hierbei unerheblich.
Rechtsmittelrichtlinien sollen einen Minimalstandard schaffen, um den Rechtsschutz von sich benachteiligt fühlenden Bietern in den Mitgliedstaaten zu gewährleisten. Zu ihrem Regelungsziel gehört auch, daß in den Mitgliedstaaten Nachprüfungsverfahren geschaffen werden.43 Der Sinn und Zweck des angestrebten individuellen Rechtsschutzes für Bieter ergibt sich aus dem übergeordneten Ziel eines grenzüberschreitenden Wettbewerbs im öffentlichen Auftragswesen. Die erste Rechtsmittelrichtlinie wurde 1989 erlassen44. 1990 folgte dann die Rechtsmittelrichtlinie für die Sektoren.45
Die Bundesrepublik Deutschland glaubte, den Anforderungen der EG mit der Einrichtung von Vergabeprüfstellen und Vergabeüberwachungsausschüssen Genüge getan zu haben. Dies erwies sich aber als Trugschluß. Allein bis 1997 hatte die Europäische Kommission auf dem Gebiet der öffentlichen Auftrags- vergabe 30 Vertragsverletzungsverfahren gegen die Bundesrepublik Deutschland eingeleitet, die meisten davon wegen der mangelhaften Umsetzung der materiellen Vergaberichtlinien.46 Immer wieder wies sie dabei auf die gravie- renden Mängel im deutschen Vergaberecht hin, die insbesondere auf die Ver- ankerung des deutschen Vergaberechts im Haushaltsrecht zurückzuführen seien. Hauptgegenstand der Kritik war die Tatsache, daß die Verdingungsausschüsse „rein private Einrichtungen“ ohne Rechtsnormcharakter gewesen seien. Somit hätten sie dem Bieter keine subjektiven, individuell einklagbaren Rechte eingeräumt. Ein Schutz vor der „Willkür der Vergabestelle“ wäre nicht gewährleistet gewesen, u.a. weil dem Bieter die Möglichkeit verwehrt wurde, vor einem nationalen Gericht seine Rechte geltend zu machen. Es ist zu hoffen, daß der deutsche Gesetzgeber mit seiner ab 1.1.1999 geltenden Neufassung des Vergaberechts die Rechtsmittelrichtlinien zufriedenstellend umgesetzt hat. Eine kurze Darstellung der gesetzlichen Neuerungen erfolgt in Kapitel 3.1.2.
2.3.3 Verfahrensarten
Auf EG-Ebene wird zwischen dem offenen, dem nicht-offenen und dem Ver- handlungsverfahren unterschieden. Aufträge oberhalb der Schwellenwerte müssen im EG-Amtsblatt ausgeschrieben werden. Die Begriffe entsprechen grob den alten deutschen Verfahrensregeln der öffentlichen Ausschreibung, der beschränkten Ausschreibung und der freihändigen Vergabe. Die Grundprinzipien des Wettbewerbs und des Diskriminierungsverbots sind in jedem Fall zu beachten. Beispielsweise kann schon die nicht zeitgleiche Bekanntmachung in nationalen Publikationen und EG-Publikationen oder die indirekte Bevorzugung inländischer Bieter durch ausführlichere Informationen eine unzulässige Diskriminierung bedeuten.47
Zunächst wird i.d.R. eine Vorabinformation im EG-Amtsblatt veröffentlicht, auf die dann die eigentliche Bekanntmachung folgt.48 Sodann werden die Ver- dingungsunterlagen versandt. Die öffentliche Bekanntmachung muß alle Angaben enthalten, die der Bieter benötigt, um ein ordnungsgemäßes Angebot abgeben bzw. um die Verdingungsunterlagen anfordern zu können. Die im Folgenden kurz skizzierten offenen bzw. nicht-offenen Verfahren werden auch als förmliche Verfahren bezeichnet, das an der Privatwirtschaft orientierte Ver- handlungsverfahren dementsprechend als nicht-förmliches Verfahren.
Das offene Verfahren richtet sich an einen unbeschränkten Bieterkreis, d.h. im Prinzip sind alle Unternehmen innerhalb der EU aufgefordert, auf eine ent- sprechende Ausschreibung hin ein Angebot abzugeben. Aus dem Wett- bewerbsgrundsatz ergibt sich der Vorrang des offenen Verfahrens vor allen anderen Verfahrensarten.49
Beim nicht-offenen Verfahren wird nur eine beschränkte Anzahl von Bewerbern nach vorher festgelegten Kriterien zugelassen. Dabei ist zwischen einer Aus- schreibung mit und ohne öffentlichen Teilnahmewettbewerb zu unterscheiden. Die Anzahl der Bewerber soll bei Bauleistungen mindestens acht, bei übrigen Lieferungen und Leistungen mindestens drei voneinander unabhängige Bewerber berücksichtigen50
Für das Verhandlungsverfahren sind keine förmlichen Vorschriften vorgegeben. Eine Bekanntgabe mit oder ohne Teilnahmewettbewerb kann, muß aber nicht, erfolgen. Der öffentliche Auftraggeber verhandelt mit einem oder mehreren Lieferanten seiner Wahl und verhält sich damit praktisch wie ein privater Einkäufer von Waren und Dienstleistungen. Dieses Verfahren ist jedoch nur dann zulässig, wenn besondere Umstände oder die Eigenart der Leistung dies rechtfertigen. Der EuGH hat in seiner bisherigen Rechtsprechung dem offenen Verfahren absolute Priorität eingeräumt und erkennt nur in Ausnahmefällen Rechtfertigungsgründe für das nicht-offene Verfahren bzw. das Verhandlungsverfahren an.51 Um ein Verhandlungsverfahren zu rechtfertigen, müssen lt. Rechtsprechung des EuGH drei Voraussetzungen vorliegen:
- „ein unvorhersehbares Ereignis
- eine mit den Fristen anderer Vergabeverfahren unvereinbar zwingende Dringlichkeit der Auftragsvergabe und
- ein Kausalnexus zwischen den beiden vorgenannten Erfordernissen.“52
2.4 Zwischenergebnis aus 2
Die Europäische Gemeinschaft verspricht sich von einem Binnenmarkt mit funk- tionierendem Wettbewerb im öffentlichen Beschaffungswesen, daß die Haushalte der Mitgliedstaaten letztendlich Geld einsparen und daß vor allen Dingen die letzte und am schwersten einzunehmende Bastion nationaler Handelshemmnisse beseitigt wird. In den europäischen Vergaberichtlinien ist der Versuch erkennbar, die möglichen Auftragsarten (freiberufliche, Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträge) und öffentlichen Auftraggeber (z.B. mit der Sektorenrichtlinie) möglichst lückenlos zu erfassen. Die Um- und Neugestaltung des europäischen Vergaberechts kommt auf sekundärrechtlicher Ebene im Wesentlichen in zwei Bereichen zum Ausdruck:
- Einbeziehung derjenigen Auftraggeber in das öffentliche Vergaberecht, die in den in der SKR definierten Sektoren tätig sind. Daß hierbei auch private Auf- traggeber Adressaten sind, „ist ein völliges Novum im Bereich der öffentlichen Auftragsvergabe“.53
- Schaffung von Überwachungsrichtlinien, die Bietern Rechtsschutz gewähren sollen.
Die faktische Durchsetzung dieser Rechtsakte wird vom Europäischen Gerichtshof gewährleistet, der auf größtmögliche Transparenz (z.B. den absoluten Nachrang des Verhandlungsverfahrens) sowie auf eine strikte Einhaltung der im EG-Vertrag normierten Grundfreiheiten sowie der Richtlinien achtet.
3 Grundzüge des öffentlichen Auftragswesens in der Bundesrepublik Deutschland
Das deutsche Vergaberecht hat sich ab dem 1. Januar 1999 entscheidend ge- ändert. Um aber die Struktur, den Aufbau und die Grundprinzipien des öffentlichen Vergabewesens in der Bundesrepublik verstehen zu können, ist ein kurzer Rückblick unerläßlich. Im Zusammenhang mit dem im vorigen Kapitel skizzierten EG-Recht dürfte sich dann die „innere Logik“ der neuen deutschen Vergabegesetzgebung besser erschließen, und sei es auch nur teilweise.
3.1 Sinn, Herkunft, Ziele und Struktur des deutschen Vergaberechts
Der Begriff „Vergabe“ erinnert entfernt an das „Hoflieferantentum“ früherer Tage. „Das Wort suggeriert ein Entgegenkommen des Hoheitsträgers, das, wenn denn nicht eine Art Gnadenakt, so doch eine Handlung ist, die die staatliche Vergabestelle huldvoll dem gewährt, der sich würdig erweist.“54 Doch trotz des etwas altertümlichen Begriffs hat sich das Vergabewesen spätestens seit den zwanziger Jahren gewandelt. Schon 1914 wurde dem deutschen Reichstag ein Gesetzesentwurf zur Regelung des öffentlichen Vergabewesens zugeleitet. Es sollten rationale, objektiv nachprüfbare Kriterien geschaffen werden, die die ursprünglich vornehmlich auf Sympathie, Loyalität und Gewohnheit basierenden Beziehungen zwischen Staat und Lieferanten regeln sollten. Vor der Überlegung, wie sich die Beziehungen zwischen öffentlichem Auftraggeber und Marktteilnehmern regeln ließe, stand die grundsätzliche Entscheidung für die Beschaffung auf dem freien Markt und gegen die zwangsweise Beschaffung durch Hoheitsakt. Die dritte denkbare Alternative, nämlich die benötigten Güter selbst zu produzieren, galt zu dieser Zeit ohnehin schon nicht mehr als prakti- kabel, weil der mit der Industrialisierung und Verstädterung einhergehende außerordentliche Aufgabenzuwachs des Staates auch einen außerordentlich hohen Beschaffungsbedarf zur Folge hatte. Man entschied sich also für die ver- tragsweise Beschaffung auf dem freien Markt. Die Konditionen sollte der 1921 ins Leben gerufene „Reichsverdingungsausschuß“ erarbeiten. In diesem Ausschuß saßen Vertreter aus Politik, Industrie, Handwerk und Gewerkschaften. 1926 einigte man sich dann auf die ihrem Kern nach immer noch gültige „Verdingungsordnung für Bauleistungen“ (VOB), 1932/36 auf die ihrem Namen nach ebenfalls noch bestehenden „Verdingungsordnung für Leistungen - ausgenommen Bauleistungen“ (VOL).55
Der Gegenstand der Vergaberegelungen war also früher wie heute der Erwerb von Waren und Dienstleistungen am Markt gegen Entgelt. „Unter „Vergaberecht“ ist demnach „...die Gesamtheit der Regeln und Vorschriften zu verstehen, die dem Staat, seinen Behörden und Institutionen eine bestimmte Vorgehensweise beim Einkauf vorschreiben.“56 Das moderne Vergaberecht regelt das öffentliche Auftragswesen. Das öffentliche Auftragswesen wiederum umfaßt „die Vergabe von, die Finanzierung der und die Preisgestaltung bzw. -vereinbarung bei (öffentlichen, d. Verf.) Aufträgen...“57
3.1.1 Prinzipien des deutschen Vergaberechts
Das deutsche Vergaberecht war bis 1999 spezieller Bestandteil des Haushalts- rechts.58 Das Haushaltsrecht wiederum befaßt sich damit, wie der Staat mit dem Geld der SteuerzahlerInnen umzugehen hat. Die Bediensteten des Staates kaufen praktisch mit Geld ein, das ihnen nicht gehört. Ohne gesetzliche Rege- lungen bestände für die Staatsbediensteten keinerlei Anreiz, mit dem ihnen an- vertrauten Geld wirtschaftlich sinnvoll umzugehen. Außerdem wäre ohne verbindliche Vergabekriterien der Korruption Tür und Tor geöffnet. Das ursprüngliche Ziel des deutschen Vergaberechts war demnach nicht der Schutz des Marktes, sondern der Schutz der Steuerzahler. Die Adressaten des deut- schen Vergaberechts waren demnach grundsätzlich auch nicht die Bieter, sondern die Bediensteten der öffentliche Verwaltung.
Die Auftragsvergabe wird in den Verdingungsordnungen präzise geregelt. Es handelt sich hierbei nicht um Gesetze, sondern um Vereinbarungen, die zwischen beiden Marktseiten in Ausschüssen (sog. „Verdingungsausschüssen“) ausgehandelt werden. Hierbei wird zum einen sachlich nach dem Gegenstand der Auftragsvergabe unterschieden (Bauleistungen, andere Leistungen und freiberufliche Leistungen), zum anderen nach dem „Wert“ des Auftrags. Die Konditionen der öffentlichen Auftragsvergabe, d.h. Vorschriften über deren Publizität, die einzuhaltenden Fristen, die Zulassung und Wertung von Angeboten, über den Zuschlag und die diesbezügliche Transparenz richten sich nach sog. „Schwellenwerten“. Diese sind Ausfluß des EG-Rechts. Deshalb sind die Verdingunsordnungen nicht nur sachlich in eine Verdingungsordnung für Bau- leistungen (VOB), eine Verdingungsordnung für andere Leistungen (VOL) und eine Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen (VOF) geteilt, sondern auch in verschiedene Teile und Abschnitte.
- Die VOB besteht aus insgesamt drei Teilen: der VOB/A, der VOB/B und der VOB/C. Während die Teile B und C der VOB sich auf die Ausführung des Bauauftrags beziehen, also auf einen Zeitpunkt, an dem der Auftrag schon vergeben worden ist, beinhaltet Teil A der VOB alle Bestimmungen, die die Auftrags vergabe von der Ausschreibung bis zur Erteilung des Zuschlags be- treffen.
- Die VOL ist lediglich in zwei Teile gegliedert, wobei wiederum der Teil B sich mit der Ausführung des Auftrags befaßt, während Teil A sich wiederum auf den eigentlichen Vorgang der Auftrags vergabe konzentriert.
- Die erst 1997 hinzugekommene VOF besteht lediglich aus einem Teil.
Gegenstand der VOF ist wiederum die Art und Weise, wie ein Auftrag ver- geben wird. Sie kommt nur dann zum Tragen, wenn ein öffentlicher Auftrag die durch EG-Richtlinien festgesetzten Schwellenwerte überschreitet. Auf die Art und Weise der Ausführung wird in der VOF nicht dezidiert eingegangen. Dies mag zum Teil darin begründet liegen, daß die öffentlichen Aufträge an Freiberufler so unterschiedlicher Natur sind, daß sie sich schwer klassifizieren lassen. „Nach unserem Verständnis sind gerade die in der Ver- dingungsordnung für freiberufliche Leistungen (VOF) beschriebenen Lei- stungen solche, die nicht beschreibbar sind.“59 Da die VOF aber sowieso ein reiner Ausfluß des EG-Rechts ist, ist die Aussparung von Bestimmungen über die Ausführung des Auftrages auch eine logische Konsequenz des Subsidiaritätsprinzips: Schließlich hat die EG keinen Grund, einem Mitglied- staat in die zivilrechtliche Gestaltung der Vertragsbeziehungen hineinzureden. Der Europäischen Gemeinschaft geht es bei der Harmonisierung des öffentlichen Auftragswesens ja „lediglich“ um den gemeinsamen Markt, d.h. um Marktöffnung, Transparenz und um die Durchsetzung des Wettbewerbs- prinzips.60 So lange kein Bieter benachteiligt wird, besteht also auch kein dahingehender Regelungsbedarf.
- Da der Gegenstand dieser Untersuchung die öffentliche Auftragsvergabe und nicht deren Ausführung ist, sind in diesem Zusammenhang also vor allen Dingen die VOB/A, die VOL/A und die VOF relevant.
- Die angeführten Teile der Verdingungsordnungen sind wiederum in Abschnitte unterteilt. Hier kommen die schon weiter oben erwähnten Schwellenwerte zum Tragen.
- Liegt ein Bau- oder anderer, nicht freiberuflicher, Auftrag unterhalb der in den entsprechenden EG-Richtlinien festgesetzten Schwellenwerte kann, grob gesagt, nach altem deutschen Vergaberecht verfahren werden. Maßgeblich sind dann lediglich Abschnitt 1 der VOB/A bzw. der VOL/A. „Unterhalb des Schwellenwertes besteht jedoch kein rechtsfreier Raum. In jedem Fall müssen die allgemeinen EGVertragsregeln bezüglich des freien Verkehrs berücksichtigt werden.“61
- Für Aufträge oberhalb der Schwellenwerte gelten je nach Auftragsart Abschnitt 2 der VOB/A bzw. 2 der VOL/A bzw. die VOF.
- Handelt es sich bei dem öffentlichen Auftraggeber um einen Auftraggeber i.S.d. EG-Sektorenrichtlinie62, gelten zusätzlich die Abschnitte 3 und 4 der VOB/A bzw. der VOL/A (siehe hierzu auch schematische Darstellung im Anhang).
- Das Bindeglied zwischen den Verdingungsordnungen die ja, wie schon in Kap. 3.1 erwähnt, den Charakter von Allgemeinen Geschäftsbedingungen haben und dem Haushaltsrecht stellt die Vergabeverordnung (VgV) dar. Sie verweist je nach Auftrag auf die drei Verdingungsordnungen .
Außer der schon eingangs geschilderten haushaltsrechtlichen Tradition gelten im deutschen Vergaberecht folgende Prinzipien:
- Das Privatrechtsprinzip: Bei der Beschaffung von Hilfsgütern üben öffentliche Unternehmen keine andere Tätigkeit aus als Privatpersonen oder private Unter- nehmen. “Da der Staat dem Bürger nicht in einem Verhältnis der Über-/Unterordnung, sondern auf der Ebene der Gleichordnung entgegentritt, kommt der Legalität staatlichen Handelns aus der Sicht des Bürgers die gleiche Bedeutung zu wie im Privatrechtsverkehr...“63 Deshalb werden öffent- liche Unternehmen am Markt und vor dem Gesetz wie Privatunternehmen behandelt und schließen privatrechtliche Verträge.
- Das Wettbewerbsprinzip: Der Staat beschafft sich seine Güter durch Aus- schreibung, wobei das offene Verfahren bzw. die öffentliche Ausschreibung Vorrang vor allen anderen Verfahrensarten hat. Sinn und Zweck des Wettbewerbsprinzips ist traditionell „die rationelle Verwendung öffentlicher Mittel durch die Wahl des besten Angebots“.64 Auf europäischer Ebene kommt noch hinzu, daß Diskriminierungen von Mitbewerbern vermieden werden sollen (insbesondere von Bietern aus anderen Mitgliedstaaten) und die Vollendung des gemeinsamen Marktes mit auch nach außen wettbewerbsfähigen europäischen Unternehmen angestrebt wird.65
- Das Wirtschaftlichkeitsprinzip: Es ist darauf zu achten, daß mit den Haushalts- mitteln sparsam umgegangen wird. Doch das heißt nicht, daß unbedingt auf das kurzfristig billigste Angebot zurückgegriffen werden muß.66 „Wichtig ist, daß auch in Zukunft eine breite Angebotspalette und möglichst mittel- ständische Angebotsstrukturen erhalten bleiben...“67 Leistungsfähigkeit, Fachkunde, und Zuverlässigkeit der Bieter sollen bei der Zuschlagserteilung Priorität haben68 u.a. auch, um Folgekosten (z.B.: Reparaturkosten) zu ver- meiden.
- Das Prinzip der dezentralen Beschaffung: Eine zentrale Beschaffung ist mög- lichst zu vermeiden. Bei der förderalen Struktur der Bundesrepublik mit ihrer Vielzahl von Staatshaushalten ergibt sich das fast von selbst. Die Nachfragemacht des Staates soll hiermit aufgesplittet werden.69
- Das Konsensprinzip: In den Verdingungsausschüssen soll ein Konsens er- arbeitet werden, d.h. der Staat soll nicht allein und einseitig über die Vergabe- bedingungen bestimmen, sondern sich z.B. mit den Vertretern der Wirtschaft einigen.70
3.1.2 Rechtsschutz im deutschen Vergaberecht
„Rechtsschutz ist von Kontrolle zu unterscheiden als die Möglichkeit des von der Handlung eines Anderen - Privatperson oder Behörde - Betroffenen, bei einer unabhängigen Instanz Schutz vor Interessenverletzungen im Einzelfall zu suchen und zu erhalten.“71 Ein Rechtsschutzbedürfnis besteht also immer dann, wenn sich ein Beteiligter in seinen Interessen verletzt fühlt.
Der spezielle haushaltsrechtliche Charakter der Vergaberegeln mit Schutz- funktionen für das öffentliche Budget hatte aber dazu geführt, daß die Vergabe- regeln lediglich interne Anweisungen an die Bediensteten des Staates ent- hielten.72 Nach der Logik dieses Systems wären die Interessen der Bieter dabei völlig ausgeklammert gewesen. Diesem Dilemma wurde mit der Schaffung von sog. „Vergabeprüfstellen“ und „Vergabeüberwachungsausschüssen“ abzuhelfen versucht. Rechtsgrundlagen waren zum einen §§ 57 b und c HGrG und zum anderen die Nachprüfungsverordnung (NpV). Die Vergabeprüfstellen stellten hierbei regelmäßig die erste, die Vergabeüberwachungsausschüsse die zweite „Instanz“ des Vergabeverfahrens dar. Es handelte sich hierbei jedoch nicht um ordentliche Gerichte. Bieter und öffentlicher Auftraggeber hatten auch keine Antrags-, Beweis- und sonstigen Beteiligungsrechte und fungierten nicht als „Parteien“73 etwa i.S.d. VwGO oder ZPO. Die Adressaten der Vergabeprüfstellen waren also wiederum ausschließlich die öffentlichen Auftraggeber.
Insbesondere wegen der mehrmals vom EuGH angemahnten korrekten Um- setzung der Rechtsmittelrichtlinien wurde eine Neuregelung des Vergaberechts notwendig. Das neue Vergaberecht begründet „erstmals subjektive Rechte der Bieter auf Einhaltung der Vergabevorschriften durch die Vergabestellen“.74
Seit dem 1.1.1999 gilt dieses neue Vergaberecht. Die Vergaberechtsänderung wurde in den 4. Teil des GWB eingefügt.75 Die oft kritisierte haushaltsrechtliche Lösung wurde hierbei durch eine kartellrechtliche Lösung ersetzt.76 § 97 Nr. 7 GWB n.F. regelt nunmehr das Klagerecht des Bieters, wenn der öffentliche Auftraggeber die Vergabevorschriften nicht einhält. An die Stelle der Vergabeprüfstelle ist nunmehr die Vergabekammer getreten, die die Funktion einer Verwaltungsbehörde hat und von Amts wegen entscheidet.77 Die zweite Instanz bilden Vergabesenate, die Bestandteil der Oberlandesgerichte sind. Damit kann der Bieter jetzt den Weg zu einem „echten“ Gericht antreten. Die erste Konsequenz hieraus ist ein verbesserter Bieterschutz, weil der benachteiligte Bieter nunmehr als Partei im Prozeß auftreten kann. Die zweite Konsequenz ist aber, daß die Vergabekammer nur noch auf Antrag tätig wird und der Bieter den Tatsachenvortrag samt Beweismittel wie in jedem anderen Zivilprozeß darzustellen hat. Ab der zweiten Instanz besteht für in privater Rechtsform strukturierte öffentliche Auftraggeber und für die Bieter Anwaltszwang.78 Befreit vom Anwaltszwang sind hingegen „staatsunmittelbare öffentliche Auftraggeber“.79
Die Vergabekammer kann das Vergabeverfahren aussetzen80 und hat auf Antrag des Auftraggebers nach zwei Wochen zu überprüfen, ob sie das Verbot der Zuschlagserteilung aufrecht erhalten will. Dabei hat sie sowohl das Gemeinwohlinteresse als auch das Interesse des Geschädigten zu berück- sichtigen. Der Bieter kann innerhalb von zwei Wochen gegen die von der Ver- gabekammer erlaubte Zuschlagserteilung Einspruch erheben. Umgekehrt steht auch dem Auftraggeber ein eine Einspruchsmöglichkeit gegen die Aussetzung des Vergabeverfahrens zu. In § 126 GWB n.F. wird schließlich die Durchsetzung von Schadenersatzansprüchen geregelt. Auch die Auftraggeber können neuerdings Schadenersatz einklagen. Für Schadenersatzansprüche sind nach wie vor die ordentlichen Gerichte zuständig.
3.1.3 Verfahrensarten im deutschen Vergaberecht
Im deutschen Vergaberecht alter Prägung wird traditionell zwischen öffentlicher Ausschreibung, beschränkter Ausschreibung und freihändiger Vergabe unter- schieden. Die alten Begriffe gelten jedoch nur noch für Bau- oder andere Aufträge unterhalb der Schwellenwerte. Sinngemäß entsprechen sie aber den EG- Vergabeverfahren des offenen, des nicht-offenen und des Verhandlungs- verfahrens. Der einzige Unterschied liegt im in Frage kommenden Bieterkreis: Während Aufträge oberhalb der Schwellenwerte im EG-Amtsblatt ausgeschrieben werden müssen, reicht bei „kleineren“ Aufträgen die Veröffentlichung in nationalen Publikationen aus, beispielsweise im obligatorischen Bundesausschreibungsblatt und evtl. zusätzlich in den Amtsblättern der Länder- und Kom- munalverwaltungen.81
Für die verschiedenen Vergabeverfahren gelten jedoch einheitliche Grundsätze: Neben dem Wettbewerbsgrundsatz und dem Diskriminierungsverbot bzw. Gleichbehandlungsgebot gelten zusätzlich noch das Verhandlungsverbot und das Gebot der Losvergabe.
- Das Verhandlungsverbot besagt, daß Verhandlungen mit Bietern nur zum Zwecke der Aufklärung geführt werden dürfen. Hier wird der auch für das Vergaberecht geltende Grundsatz von Treu und Glauben konkretisiert. Das Verhandlungsverfahren bzw. die freihändige Vergabe sind von diesem Verbot ausgenommen.82
- Das Gebot der Losvergabe besagt, daß größere Aufträge möglichst in Lose geteilt werden sollen, um kleinen und mittleren Unternehmen eine Chance zu geben. Dieser Grundsatz gilt jedoch nicht für die VOF.83
3.2 Zwischenergebnis aus 3
Die 1999 erfolgte Gesetzesänderung war wohl auf lange Sicht gesehen unum- gänglich, denn die bisherige haushaltsrechtliche Lösung hatte, insbesondere im Hinblick auf den Bieterschutz, erhebliche Mängel und stand nach Einschätzung des Europäischen Gerichtshofs nicht mit den Rechtsmittelrichtlinien im Einklang. Ob die Einfügung in das GWB hingegen die glücklichste Art war, die Richtlinien umzusetzen, bleibt abzuwarten. Was man auf jeden Fall schon jetzt feststellen kann ist, daß das deutsche Vergaberecht weder für die Bediensteten öffentlicher Auftraggeber noch für die potentiellen Bieter durchschaubarer geworden ist. Da öffentliche Auftraggeber in Zukunft anderen marktbeherrschenden Unternehmen gleichgestellt sind, werden sich deren Bedienstetete wohl in Zukunft zusätzlich noch mit den Grundzügen des Wettbewerbsrechts vertraut machen müssen. Dabei sind schon die unterschiedlichen Anwendungsbereiche der Ver- dingungsordnungen kompliziert genug. Es scheint, als leide das deutsche Ver- gaberecht unter einem Mangel an Struktur. Man wird den Eindruck nicht los, daß die EG-Vergaberichtlinien von der Bundesrepublik eher zögerlich und widerwillig umgesetzt werden. Als Beleg hierfür mag die eher schleppende Abkehr von der haushaltsrechtlichen Lösung im Vergaberecht dienen. Während die Bundes- republik sich in anderen Bereichen immer wieder gern als europäischer Muster- schüler hervortut, erweist sie sich im Vergaberecht wohl eher als schwieriger Schüler.
4 Der Grenzbereich erweiterter Vergabekriterien
Im Folgenden wird sowohl auf herkömmliche als auch auf erweiterte Vergabekriterien eingegangen. Dabei wird sowohl auf deren wirtschaftlichen und politischen Sinn als auch auf ihre rechtliche Zulässigkeit eingegangen.
4.1 Was sind herkömmliche Vergabekriterien?
Vor Klärung der Frage, um was es bei dem Begriff „ erweiterte Vergabekriterien“ geht, erscheint es methodisch ratsam, zunächst einmal aufzuzeigen, was her kömmliche Vergabekriterien sind.
4.1.1 Zugangskriterien
„Faire, nichtdiskriminierende und transparente Vergabeverfahren vermindern das Risiko von Betrug und Korruption in der öffentlichen Verwaltung.“84 Die Ver- gabeverfahren sollen transparent, d.h. objektiv nachprüfbar sein.85 Ein Ziel der europäischen Koordinierungsrichtlinien war es denn auch, verbindliche Regelungen zu schaffen, was als Zugangsvoraussetzung in einer Ausschreibung gefordert werden kann und was nicht.
Zulässig sind technische Anforderungen. Der öffentliche Auftraggeber kann z.B. verlangen, daß eine Lieferung oder Leistung bestimmten Industrienormen entspricht. Weitere Beispiele für technische Vorschriften sind: Abmessungen, Terminologie, Bildzeichen, Prüfverfahren, Verpackung, Kennzeichnung, Beschriftung, Qualitätsstufen, Sicherheit u.v.a.m.86 Doch schreiben die Richtlinien übereinstimmend vor, daß entweder
- „auf innerstaatliche Normen, die europäische Normen umsetzen, oder
- auf europäische technische Zulassungen oder
- auf gemeinsame technische Spezifikationen“87
Bezug genommen werden soll. Der EuGH wertete in der Vergangenheit die Forderung, ausländische Bieter mögen eine Bescheinigung einer inländischen Behörde vorlegen, daß ihr Produkt bezüglich der technischen Normen mit den inländischen Normen übereinstimmt, als Verstoß gegen die Warenverkehrs- freiheit.88 Die Forderung, ein Produkt müsse aus einer besonderen Produktion oder von einem bestimmten Hersteller stammen, ist ebenfalls untersagt.89 Die Bezugnahme auf ein bestimmtes Betriebssystem („UNIX“) in der Ausschreibung ist beispielsweise nicht zulässig.90
4.1.2 Ausschlußkriterien
Auch im offenen Verfahren können Bieter u.U. von vornherein von der Aus- schreibung ausgeschlossen werden. „Dies ist dann der Fall, wenn sie eine schwere Verfehlung begangen haben, die ihre Zuverlässigkeit als Bewerber in Frage stellt, oder wenn sie im Vergabeverfahren vorsätzlich unzutreffende Er- klärungen in bezug auf ihre Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit abgegeben haben.“91 Nach Art. 24 BKR, Art. 20 LKR sowie Art. 29 DKR kommt der Ausschluß vom Vergabeverfahren insbesondere bei Verstößen gegen das Strafrecht92 sowie bei einem laufenden Konkursverfahren in Frage. Zu dem in den Richtlinien aufgeführten umfangreichen Katalog von Ausschlußgründen darf jedoch keiner hinzugefügt werden.93 In der SKR sind Ausschlußgründe nur für das nicht-offene und das Verhandlungsverfahren benannt.94
4.1.3 Eignungskriterien
Wird der Auftrag im nicht-offenen bzw. im Verhandlungsverfahren ausgeschrieben, ist es notwendig, eine Vorauswahl unter den möglichen Bietern zu treffen. Dies erfolgt mit Hilfe sogenannter Eignungskriterien. Dabei ist zwischen formellen und materiellen Eignungskriterien zu unterscheiden. Zu den formellen Kriterien zählt beispielsweise der Nachweis über den Eintrag in Berufsregister. Außer den vorgesehenen Nachweisen dürfen aber nicht zusätzliche Nachweise, z.B. beglaubigte Übersetzungen, verlangt werden.95
Mit den materiellen Kriterien soll die fachliche Eignung des Bewerbers geprüft werden. Die fachliche Eignung wiederum umfaßt die „wirtschaftliche, finanzielle und technische Leistungsfähigkeit der Betroffenen.“96 Als Nachweise für die finanzielle und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit können Bankerklärungen, Bilanzen oder Erklärungen über den Gesamtumsatz in den letzten drei Ge- schäftsjahren verlangt werden. Im Gegensatz zu den formellen Eignungskriterien ist hier die Art des Nachweises aber lt. RSpr. des Europäischen Gerichtshofs nicht abschließend festgelegt.97 Die öffentlichen Auftraggeber können also zusätzliche Nachweise verlangen. Ähnlich sieht es bei den technischen Nachweisen aus. Welche Nachweise im Einzelfall verlangt werden dürfen, richten sich nach der Art des Auftrags. Nachweise von anderen Mitgliedstaaten sind jedoch anzuerkennen.98 Zu den vorgesehenen technischen Nachweisen können z.B. gehören:
- Nachweise über die berufliche Befähigung des Unternehmers bzw. der Führungskräfte
- Angaben über die in den letzten drei Jahren erbrachten Leistungen
- Angaben über die technische Ausstattung des Unternehmens
- Angaben über die Zahl der Beschäftigten
- Angaben über Art und Umfang von Qualitätskontrollen
- Produktbeschreibungen, Muster, Planzeichnungen oder Fotografien u.v.a.m.
Die Europäische Kommission ist der Meinung, daß Rechnungen von früheren Lieferungen und Leistungen nicht zu den zulässigen Nachweisen gehören. Im fraglichen Fall hatte Griechenland von Lieferanten staatlicher Krankenhäuser frühere Rechnungen verlangt, um lt. Stellungnahme Preisabsprachen unter den Bietern zu verhindern. Ein Vertragsverletzungsverfahren vor dem EuGH ist eingeleitet.99 Die Mitgliedstaaten können auch Listen derjenigen Unternehmen führen, die für Bau-, Liefer- oder Dienstleistungen zugelassen sind. Derartige Listen werden beispielsweise in Belgien, Italien und Spanien geführt. Unternehmen aus anderen Mitgliedstaaten dürfen bei Bestehen einer solchen Liste jedoch nicht benachteiligt werden.100
4.1.4 Zuschlagskriterien
Neben den Eignungskriterien spielen die Zuschlagskriterien eine zentrale Rolle. Der Zuschlag ist lt. Art. 26 LKR bzw. Art. 36 DKR entweder dem wirtschaftlich günstigsten Angebot oder dem Angebot mit dem niedrigsten Preis zu erteilen. Bei Bauleistungen soll der Zuschlag „dem Angebot erteilt werden, das auch unter gestalterischen und funktionsbedingten Gesichtspunkten als das annehmbarste erscheint. Der niedrigste Angebotspreis allein ist nicht entscheidend.“101
Da es sich beim „niedrigsten Preis“ um ein rein quantitatives Kriterium handelt, dürfte die Bewerberauswahl hier im Normalfall keine Schwierigkeiten bereiten. Lediglich ungewöhnlich niedrige Angebote können unter bestimmten Bedingungen abgelehnt werden. Der öffentliche Auftraggeber darf solche Angebote aber nicht pauschal ablehnen, sondern muß eine Aufstellung über die Einzelposten verlangen. Der Bieter soll so Gelegenheit bekommen, die Seriosität seines Angebots darzulegen.102 In den neueren Fassungen der BKR, LKR und DKR103 ist diese Verpflichtung enthalten.
Beim Auswahlkriterium „wirtschaftlich günstigstes Angebot“ handelt es sich hin- gegen um eine Ermessensentscheidung. Als Einzelkriterien, die auch in den Richtlinien aufgeführt sind,104 kommen beispielsweise in Frage: Lieferfrist, Aus- führungsdauer, Betriebskosten, Art und Umfang der Ersatzteillieferung u.v.a.m. Die Kriterienliste ist aber nicht abschließend und kann je nach Art des Auftrags erweitert werden.105
4.2 Was sind erweiterte Vergabekriterien?
Tritt der Staat als Einkäufer von Waren am Markt auf, ist sein vorrangiges Ziel die Bedarfsdeckung. „Daneben beeinflussen das öffentliche Auftragswesen jedoch auch makroökonomische Ziele, wie etwa die Steuerung der Konjunktur und des Arbeitsmarktes, die ein Charakteristikum des ö ffentlichen Beschaffungswesens sind.“106 1988 machte der Auftragswert bundesdeutscher Aufträge, die sich auf Präferenzen bezog, 0,25% aus.107 Neben wirtschaftlichen Zielen verfolgt der Staat oft auch politische Ziele. Ein vorrangiges politisches Ziel ergibt sich schon aus der Doppelrolle des Staates in der marktwirtschaftlich orientierten Demokratie: Einerseits repräsentiert er das Volk, andererseits tritt er als privater Beschaffer von Waren und Dienstleistungen auf. Naturgemäß würde er seine Waren und Dienstleistungen am liebsten bei denjenigen beziehen, denen er seine Legitimation verdankt.108 Insofern hängen makroökonomische Ziele, wie z.B. antizyklische Krisenpolitik, und politische Ziele, wie z.B. umweltpolitische Kriterien bei der Vergabe, eng miteinander zusammen, denn beides soll letztendlich auch die Interessen der WählerInnen befriedigen.109 Ein österreichischer Landeshauptmann, der für eine illegale Auftragsvergabe beim Bau des St. Pöltener Regierungsviertels verantwortlich war, äußerte das, was viele öffentliche Auftraggeber vermutlich denken, aber selten sagen: Die EU und ihre Vorschriften seien ihm egal. Wichtig sei vielmehr, daß heimische Unternehmen Arbeit hätten.110
Eine weiterer Interessenkonflikt dürfte sich daraus ergeben, daß das, was betriebswirtschaftlich, das heißt z.B. für das Budget einer Behörde, am wirtschaftlichsten ist, nicht immer für den gesamten Staatshaushalt ökonomisch am sinnvollsten sein muß. Im Gegensatz zu privaten Auftraggebern muß der Staat, d.h. indirekt die Steuerzahler, nicht nur finanziell dafür einstehen, wenn verschiedene kleine Staatshaushalte ineffizient wirtschaften, sondern auch für die Folgen einer verfehlten Wirtschaftspolitik, z.B. eine hohe Arbeitslosenquote. Deshalb dürfte es für öffentliche Auftraggeber fast unmöglich sein, sich wie private Einkäufer von Waren und Leistungen zu verhalten und gleichzeitig die politischen und makroökonomischen Interessen des Staates zu vertreten.
Statt des Begriffs „erweiterte Vergabekriterien“ wird in der Literatur häufig der Begriff „beschaffungsfremde Kriterien“ verwendet. Gegen die Klassifizierung der weiter oben dargestellten wirtschaftlichen und politischen Kriterien als „beschaffungsfremd“ spricht hingegen zweierlei:
- Wirtschaftliche, politische und soziale Kriterien können nicht im eigentlichen Sinne als „beschaffungsfremd“ bezeichnet werden weil sie, ganz im Gegenteil, eigentlich ein Charakteristikum des öffentlichen Beschaffungswesens sind (s.o.). Inwieweit derlei Kriterien rechtlich zulässig sind, ist hierbei zunächst einmal unerheblich.
- Als „beschaffungsfremde Kriterien“ werden auch Kriterien bezeichnet, die die Grenze zur Strafbarkeit tangieren. Abgesehen von Freundschaft, Verwandt- schaft und politischer Sympathie können hier auch Korruption und Kartell- bildung, insbesondere die Bildung von Submissionskartellen111, eine Rolle spielen.112 Obwohl auch bei Anwendung der weiter oben erwähnten Kriterien egoistische Motive nicht ausgeschlossen werden können (schließlich wollen Politiker ja wieder gewählt werden), steht doch eher das Gemeinwohl als Intention im Vordergrund.
4.2.1 Wirtschaftlich-politische Kriterien
„Die Vergabe öffentlicher Aufträge wird in allen Mitgliedstaaten als konjunktur- politisches Instrument eingesetzt und ist z.B. in der Bundesrepublik durch das Stabilitätsgesetz und die einzelnen Haushaltsordnungen gesetzlich abge- sichert.“113 § 1 des Stabilitätsgesetzes114 besagt beispielsweise, daß öffentliche Beschaffungsmaßnahmen so zu treffen sind, daß im Rahmen der markt- wirtschaftlichen Ordnung die Stabilität des Preisniveaus, ein hoher Beschäf- tigungsgrad, ein außenwirtschaftliches Gleichgewicht sowie ein stetiges und angemessenes Wirtschaftswachstum gefördert wird. Durch vermehrte öffentliche Aufträge kann der Staat die Wirtschaft ankurbeln und zum Abbau der Arbeitslosigkeit beitragen. Mit dieser antizyklischen Wirtschaftspolitik sollen Konjunkturschwankungen ausgeglichen werden.115
Die gezielte Förderung einzelner Industriezweige durch öffentliche Auftrags- vergabe liegt hingegen an der Schwelle zwischen wirtschaftlichen und politischen Zielsetzungen. Wirtschaftlich gesehen kann es durchaus Sinn machen, innovative neue Industriezweige durch öffentliche Auftragsvergabe zu fördern, um Impulse für die gesamte Wirtschaft zu geben. Öffentliche Aufträge im Computerbereich, in der Gentechnik, in der Luftfahrt und im Umweltsektor werden beispielsweise oft mit der Zielsetzung vergeben, letztendlich auch die Exportchancen für den betreffenden Standort zu verbessern. Ohne die gezielte Förderung der europäischen „Airbus“-Produktion wäre es beispielsweise wahrscheinlich kaum gelungen, einen Teil des US-amerikanischen Marktes für Flugzeuge zu erobern.
Rüstung und Raumfahrt sind Industriezweige, die fast gänzlich auf staatliche Aufträge angewiesen sind. An den letztgenannten Beispielen wird besonders deutlich, daß Industriepolitik an der Schwelle zwischen politischen Grundsatzentscheidungen (z.B. für Rüstung oder für Atomenergie) und wirtschaftlichen Erwägungen liegt.
Statt einzelne Industriezweige zu fördern, können auch einzelne Regionen gefördert werden. In Frage kommen hierbei besonders benachteiligte Regionen wie einzelne Gebiete in Italien oder Griechenland. Bis kurz nach der Wiedervereinigung gehörten in der Bundesrepublik beispielsweise das „Zonenrandgebiet“ und Westberlin zu den besonders geförderten Regionen, deren Bewerber bei öffentlichen Ausschreibungen bevorzugt wurden.116
Die Förderung von kleinen und mittleren Unternehmen ist eine erklärte wirt- schaftspolitische Zielsetzung in der Bundesrepublik.117 „Durch die Erhaltung eines breiten Mittelstandes soll der Wettbewerb erhalten bzw. gefördert werden.“118 Gegenüber Großunternehmen wären sie sonst bei der Vergabe öffentlicher Aufträge wohl in vielerlei Hinsicht benachteiligt: Sie haben meistens eine geringere finanzielle Disponibilität, einen vergleichsweise kleinen Werbeetat und geringere Kapazitäten, was die Ausführung von Großaufträgen betrifft. In § 4 VOB/A bzw. § 5 VOL/A ist deshalb vorgeschrieben, daß ein Auftrag möglichst in Lose geteilt werden soll. § 4 Abs. 5 VOF schreibt vor, daß „kleinere Büroorganisationen und Berufsanfänger“ angemessen beteiligt werden sollen. Es gibt aber auch andere Methoden zur Mittelstandsförderung: In Frankreich werden die kleinen und mittleren Unternehmen mit Mitteln der Regionalpolitik gestützt.119
Die Bevorzugung von Betrieben, die nach einem bestimmten Tarif bezahlen, ist hingegen in der Grauzone zwischen wirtschaftspolitischen Erwägungen und sozialen Zielen anzusiedeln. Einerseits soll wohl mit dieser Bevorzugung der Schutz des inländischen Mittelstands vor billiger ausländischer Konkurrenz er- reicht werden, andererseits mögen auch soziale Beweggründe eine Rolle spielen: Die inländischen ArbeitnehmerInnen sollen vor Dumping-Löhnen geschützt werden.120 Inwieweit das Vergabekriterium „ortsüblicher Tarif“ rechtlich zulässig ist, wird in Kapitel 4.4 behandelt.
4.2.2 Soziale Kriterien
Manchmal werden bestimmte Personengruppen bei der Auftragsvergabe bewußt bevorzugt. Diese Bevorzugung ist meistens politisch motiviert und verfolgt das Ziel, bestehende Benachteiligungen auszugleichen. In der Bundesrepublik wurden in der Vergangenheit Vertriebene, „Sowjetzonenflüchtlinge“, Verfolgte des
Naziregimes, Evakuierte, Behinderte und Blindenwerkstätten bei der Vergabe bevorzugt.121 Es ist aber auch die Bevorzugung von Frauen, ethnischen Minderheiten usw. vorstellbar. Außerdem ist eine Bevorzugung solcher Betriebe denkbar, die Lehrlinge ausbilden oder Langzeitarbeitslose beschäftigen.122
4.2.3 Umweltkriterien
„Das wachsende Interesse am Umweltschutz führt dazu, daß die fiskalisch orientierte Beschaffung immer mehr von spezifisch umweltpolitischen Gesichtspunkten überlagert wird.“123 Besonders umweltfreundliche Produkte bzw. Baumaßnahmen sollen hierbei bevorzugt werden.
4.3 Welchen Sinn machen erweiterte Vergabekriterien?
Aus wirtschaftspolitischer Sicht gibt es sowohl Gründe für als auch gegen die Einbeziehung erweiterter Vergabekriterien. Für erweiterte Vergabekriterien im öffentlichen Beschaffungswesen würde Folgendes sprechen:
- Der bewußte Verzicht auf die steuernde Funktion erweiterter Vergabekriterien würde eine Verschwendung politischer Instrumentalisierungsmöglichkeiten bedeuten.
- Selbst wenn die Einbeziehung erweiterter Vergabekriterien kurzfristig einen höheren Beschaffungspreis zur Folge hätte, könnte die Investition jedoch längerfristig, etwa in der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung, positiv zu Buche schlagen, weil z.B. mehr Steuern eingenommen und Kosten für Arbeitslosigkeit vermieden würden.124
- Das letztendliche Ziel vieler Präferenzregelungen ist gerade der Erhalt eines funktionierenden Wettbewerbs, z.B. durch Mittelstandsförderung.125
Dem ersten Argument kann entgegengehalten werden, daß der Verzicht auf ein steuerndes Mittel unvermeidbar ist, wenn man Wettbewerbsverzerrungen und eine Inhomogenität im Gefüge des Binnenmarktes vermeiden will.126 Das zweite Argument kann entkräftet werden, wenn man bedenkt, daß sich der Staat bei einer ökonomischen Instrumentalisierung des öffentlichen Auftragswesens wahrscheinlich nicht damit zufrieden geben würde, sowieso geplante öffentliche Aufträge lediglich nach anderen Kriterien zu verteilen, sondern daß er bei Kon- junkturflauten eher dazu tendieren würde, zusätzlich öffentliche Aufträge zu vergeben.127 Dies würde eine zusätzliche Belastung der öffentlichen Haushalte bedeuten und dem Gebot der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit widersprechen. Die Planungszeiten für öffentliche Aufträge sind zudem meistens relativ lang, so daß sie als konjunkturpolitisches Mittel ungeeignet sein dürften. Außerdem führen Kritiker an, die keynesianische Theorie der antizyklischen Wirtschaftspolitik erfasse heutzutage sowieso nicht mehr den Kern der volkswirtschaftlichen Probleme in modernen Dienstleistungsgesellschaften: Nachfragegesichtspunkte spielten im Rahmen der Globalisierung nur noch eine untergeordnete Rolle, so daß mit einer konjunkturpolitischen Instrumentalisierung des öffentlichen Auftragswesens letztlich nichts gewonnen sei.128
Bezüglich des dritten Arguments (Mittelstandsförderung) herrscht weitgehende Einigkeit darüber, daß
- klein- und mittelständische Unternehmen Wettbewerbsnachteile haben
- daß sie wichtig für einen Markt mit funktionierendem Wettbewerb sind und daß es
- ein Ziel sein muß, sie stärker in die öffentliche Auftragsvergabe einzubinden.129
Uneinigkeit herrscht hingegen darüber, ob Präferenzregelungen das geeignete Mittel zur Erreichung dieses Ziels sind. Eigentlich laufen positive Diskrimi- nierungen dem europäischen Ziel eines möglichst diskriminierungsfreien Be- schaffungsmarktes mit möglichst viel Wettbewerb zuwider.130 Angesichts dieses prinzipiellen Einwands wäre zu überlegen, ob es nicht besser wäre, die Wett- bewerbsnachteile der KMU mit einer Veränderung der Rahmenbedingungen statt mit direkten Eingriffen auszugleichen.131 Einige Initiativen der Europäischen Kommission zielen bereits in diese Richtung: Unter anderem sollen der Zugang der KMU zu öffentlichen Aufträgen mit Hilfe der elektronischen Auftragsvergabe erleichtert und Defizite im Wissen über Vergabebestimmungen durch Schu- lungsmaßnahmen ausgeglichen werden.132 Die beiden Lösungswege schließen einander jedoch generell nicht aus.
Ob die Bevorzugung von Unternehmen aus benachteiligten Regionen bei der Auftragsvergabe ein geeignetes Mittel ist, um deren Wettbewerbsnachteile aus- zugleichen, ist ebenfalls strittig. Wenn das einzige Kriterium der Standort des Unternehmens ist, werden ohne Rücksicht auf die Bedürftigkeit im Einzelfall alle Unternehmen dieser Region bevorzugt,133 d.h. es kann durchaus sein, daß ein großes Unternehmen, das die Region monopolartig beherrscht, von der Regio- nalförderung zum Nachteil von kleinen und mittleren Unternehmen profitiert.
Bezüglich der Bevorzugung von umweltfreundlich arbeitenden Unternehmen darf wohl angenommen werden, daß diese allgemein gesellschaftlich akzeptiert ist. Vom Bundesumweltamt wird sogar daran gedacht, eine geringfügige Preisüberschreitung zugunsten der Umweltfreundlichkeit hinzunehmen.134 Doch da mit einen höheren Preis hier auch eine bessere, weil umweltfreundliche, Leistung verbunden ist und Umweltschutz zudem zu einem zentralen politischen Ziel der EG gehört,135 dürften umweltpolitische Vergabekriterien im Allgemeinen wohl nicht auf allzu große Akzeptanzschwierigkeiten stoßen.
Die Präferenzregelungen für bestimmte Personengruppen sind hingegen immer wieder Gegenstand der Kritik. Das gängige Argument lautet hierbei, daß sich Benachteiligungen mit anderen Maßnahmen besser und gleichmäßiger aus- gleichen ließen, als gerade mit der Bevorzugung bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen.
4.4 Die rechtliche Zulässigkeit erweiterter Vergabekriterien
Nach h.L. sind erweiterte Vergabekriterien nur in sehr engen Grenzen zulässig.136 Generell dürfen Präferenzen nur auf Grundlage einer Regelung gewährt werden, die zum einen bei Erlaß der betreffenden Richtlinie bereits in Kraft war und zum anderen nicht gegen den EG-Vertrag verstößt.137 Bezüglich der Bevorzugung bestimmter Regionen stellte der EuGH beispielsweise fest, daß eine pauschale prozentuale Bevorzugung von Unternehmen einer bestimmten Region nicht mit der im EGV normierten Warenverkehrsfreiheit vereinbar ist.138 Einen eindeutigen Verstoß gegen die Warenverkehrsfreiheit, die Dienstleistungsfreiheit und die Freizügigkeitsregelung stellt auch das als Vergabekriterium aufgestellte Erfordernis dar, möglichst einheimische Baustoffe, Verbrauchsgüter und Arbeitskräfte zu verwenden.139 Der EuGH klassifizierte hingegen das Vergabekriterium „Beschäftigung von Langzeitarbeitslosen“ als zulässig, so lange es in der Ausschreibung ausdrücklich erwähnt wird. Der Gerichtshof sah eine Diskriminierung ausländischer Bieter hier nicht gegeben, da sich das Kriterium generell auf Langzeitarbeitslose und nicht nur auf niederländische Arbeitslose bezog.140 Nach Auffassung der EU-Kommission141 verstößt es auch nicht gegen europäisches Wettbewerbsrecht, wenn die innerbetriebliche Förderung von Frauen in der Ausschreibung als Eignungskriterium auftaucht.142
4.4.1 Zulässigkeit von Umweltkriterien
Der Umweltschutz gehört zu den „wichtigsten Politikfeldern der Gemeinschaft“.143 Art. 6 EGV n.F. legt beispielsweise fest, daß die Umweltpolitik in die anderen Gemeinschaftspolitiken einbezogen werden soll. In den Richtlinien zur Auftragsvergabe sind umweltpolitische Erwägungen allerdings nicht direkt ein- geflossen. Beispielsweise ist bei den Zuschlagskriterien nirgendwo das Kriterium „Umweltfreundlichkeit“ aufgeführt. Der Zuschlag ist dem „wirtschaftlich günstig- sten“ Angebot bzw. dem Angebot mit dem niedrigsten Preis zu erteilen. Sollte das umweltfreundlichste Angebot auch gleichzeitig das wirtschaftlich günstigste sein, wäre eine Einbeziehung von Umweltkriterien also überflüssig.144 Ein dahin gehender Nachweis dürfte zwar schwierig zu führen, im Einzelfall aber durchaus vorstellbar sein. Selbst wenn das umweltfreundliche Angebot einen geringfügig höheren Preis hätte, könnte doch vom Kosten-Nutzen-Standpunkt damit argu- mentiert werden, daß dies trotz allem die wirtschaftlich günstigste Lösung sei. Es dürfte sich hierbei aber um Einzelfälle handeln.
Die Einbeziehung von Umweltkriterien in die Auftragsvergabe ist dennoch nicht ausgeschlossen. Beispielsweise erlaubt Art. 176 EGV n.F., daß die Mitglied- staaten strengere Umweltauflagen machen, als dies in den EG-Umweltrichtlinien vorgeschrieben ist. Allerdings dürfen diese Regelungen nicht gegen die Grund- sätze des EGV verstoßen. Dies dürfte in der Praxis bedeuten, daß Regelungen dann unzulässig sind, wenn ihnen lediglich nationale Normen, Zertifikate u.a. zugrunde liegen. Sind die nationalen Umweltschutzbestimmungen mit EG-Recht vereinbar, kann der Staat auch verlangen, daß Auftragnehmer diese einhalten. Die fachliche und technische Fähigkeit des Bieters, Umweltnormen einzuhalten, kann dann auch zu einem Eignungskriterium werden. Verstöße gegen nationale Umweltregeln berechtigen zu einem Ausschluß von der Ausschreibung, weil sie eine „schwere berufliche Verfehlung“ darstellen (siehe Kap. 4.1.2).145
Schwieriger wird es, wenn der öffentliche Auftraggeber umweltpolitische Ver- gabekriterien in die Ausschreibung einbeziehen will, die nicht durch nationale Normen abgesichert sind. Ähnlich wie im Beentjes-Urteil vom EuGH dargelegt146, können zwar auch Kriterien, die nicht Gegenstand der Vergaberichtlinien sind, zulässig sein. Doch muß hier im Einzelfall entschieden werden, ob auch tatsächlich nicht gegen grundsätzliche Bestimmungen des EG-Vertrags, z.B. das Diskriminierungsverbot, verstoßen wird.147 Nach bisheriger Rechtsprechung148 wird der Europäische Gerichtshof immer dann von einem Verstoß gegen Europäisches Gemeinschaftsrecht ausgehen, wenn andere Mitgliedstaaten in irgendeiner Art und Weise diskriminiert werden, insbesondere durch einen Verstoß gegen die Warenverkehrsfreiheit.
Nach der derzeitigen Rechtslage sind bei der Einbeziehung umweltpolitischer Vergabekriterien in eine Ausschreibung folgende Punkte zu beachten:
1. In keinem Fall dürfen in der Ausschreibung inländische Erzeugnisse, Personen oder Unternehmen ausdrücklich bevorzugt werden.
2. Ausländische Zertifikate, Zeugnisse und Befähigungsnachweise müssen als inländischen Eignungsnachweisen gleichwertig akzeptiert werden, ohne daß es der Bestätigung durch eine nationale Behörde bedarf.
3. Es dürfen keine Bestandteile gefordert werden, die es so nur in einem Mit- gliedstaat gibt.
4. Es dürfen nur Maße, Normen und Meßwerte benutzt werden, die europäischen Standards entsprechen.
5. Es dürfen nur Sicherheits- und Umweltstandards gefordert werden, die euro- päischen Normen entsprechen.
6. Auf Markennamen muß verzichtet werden. Statt dessen ist in der Aus- schreibung der Zusatz „oder gleichwertiger Art“ zu setzen.149
4.4.2 Zulässigkeit beschäftigungspolitischer und sozialer Kriterien
„Die Sozialpolitik der Europäischen Union trägt zur Förderung eines hohen Beschäftigungsniveaus und eines hohen Maßes an sozialem Schutz...bei.“150 Die Europäische Kommission erkennt an, daß die öffentliche Auftragsvergabe ein Instrument sein kann, um die Wirtschaftsteilnehmer bezüglich sozialpolitischer Vorgaben in ihrem Handeln zu lenken.151
Zum einen hat, ähnlich wie bei den Umweltkriterien, jeder Mitgliedstaat die Mög- lichkeit, Rechtsnormen bezüglich der Einhaltung von Mindeststandards, z.B. in puncto Arbeitssicherheit und Mindestentgelt, zu schaffen, zu deren Einhaltung die Auftragnehmer dann verpflichtet sind.152 Jüngeres Beispiel für solch eine grenzüberschreitende Norm ist das 1996 geschaffene Arbeitnehmer-Entsende- gesetz, das ausländische wie inländische Bauunternehmer gleichermaßen zur Zahlung eines Mindestlohns verpflichtet.153 Die Nichtbefolgung nationaler Normen kann, sofern diese nicht gegen EG-Recht verstoßen, den Ausschluß von weiteren Ausschreibungen zur Folge haben.
Schwieriger wird es, soziale Kriterien in eine Ausschreibung einzubeziehen, wenn diese keine gesetzliche Grundlage haben. In Einzelfällen mag das noch angehen. „Beispielsweise ist ausnahmsweise im Fall Beentjes das vergabefremde Kriterium der Beschäftigung von Langzeitarbeitslosen vom EuGH nicht beanstandet worden.“154 Dieses immer wieder zitierte Urteil kann jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, daß selbst bei einer ehrlichen sozialen Intention die Einbeziehung arbeitsmarktpoliticher Kriterien ohne Verstoß gegen EG-Recht schwierig ist. So eindeutige Verstöße gegen Grundsätze des EGV wie im Storebælt-Urteil (Aufforderung an die Unternehmer, möglichst dänische Materialien und Arbeitskräfte zu verwenden)155 sind hierzu gar nicht nötig.
Abgesehen von gesellschaftlich-politisch motivierten Präferenzen für bestimmte Personengruppen kommt es auch häufig vor, daß im öffentlichen Auftragswesen wirtschaftspolitische oder soziale Erwägungen eine Rolle spielen. Wie eng ordnungspolitische Vorstellungen und makroökonomische Ziele miteinander verwoben sind, mag ein Urteil des Kammergerichts Berlin demonstrieren, in dem es um die Verpflichtung der in der Ausschreibung angesprochenen potentiellen Bieter zur Zahlung von Berliner Tariflöhnen ging. Die Vertragsklausel sollte un- abhängig davon gelten, ob die angesprochenen Bieter tarifgebunden, d.h. Mitglied in einem Arbeitgeberverband, waren oder nicht156 An der Zuständigkeit des Kammergerichts läßt sich schon erkennen, daß es in der angesprochenen Ver- handlung weniger um die Zulässigkeit des erweiterten Vergabekriteriums „Tariftreue“ als um den Mißbrauch einer marktbeherrschenden Stellung i.S.d. § 26 Abs. 4 GWB a.F. ging. Durch dieses, wie sich in der Urteilsbegründung nachlesen läßt, rechtswidrige Erfordernis der Tariftreue157 wären kleine und mittlere Unternehmen, die oft nicht tarifgebunden wären, potentiell benachteiligt worden. Speziell Betriebe aus dem Berliner Umland hätten nur die Wahl gehabt, das Vergabekriterium „Tariftreue“ zu erfüllen oder u.U. sogar langfristig vom Berliner Markt verdrängt zu werden. Da das Land Berlin keine eigenen verbands- oder arbeitsrechtlichen Interessen verfolge, wären einzig sozial- und wirtschaftspolitische Motive zu vermuten, die mit einer mißbräuchlichen Aus- nutzung der nachgewiesenermaßen bestehenden marktbeherrschenden Stellung hätten durchgesetzt werden sollen. „Tariftreue“ als Ausschreibungskriterium wurde deshalb in dem vorliegenden Fall für unzulässig erklärt.158
Dieses Beispiel mag demonstrieren, wie schnell eigentlich gut gemeinte soziale Kriterien zu Wettbewerbsverzerrungen führen können. Die Grenze zwischen Protektionismus und gemeinnützigen Motiven ist hierbei fließend. Was für Berlin und sein Umland gilt, mag in diesem Zusammenhang erst recht für die Euro- päische Gemeinschaft gelten. Insofern sei die Frage angebracht, inwiefern Tariftreue bei offenen (europaweiten) Ausschreibungen zulässig ist. Stellt das Erfordernis, nur nach nationalen Tarifen zu bezahlen, eine potentielle Diskrimi- nierung ausländischer Bieter dar? Auf den ersten Blick läßt sich diese Frage ziemlich eindeutig mit „ja“ beantworten. Wären z.B. deutsche Tarife die Meßlatte, an die sich bei einer Ausschreibung aus Deutschland alle Bewerber orientieren müßten, hätten Unternehmen aus anderen Mitgliedstaaten so gut wie keine Chance. Je nach Auftragsart würde diese Diskriminierung auf eine Verletzung einer oder mehrerer im EG-Vertrag garantierten Grundfreiheiten hinauslaufen.
Anders sähe es aus, wenn von den Bietern die Einhaltung eines gesetzlich garantierten Mindestlohns gefordert würde, wie z.B. im Arbeitnehmer-Entsende- gesetz. Dies wiederum würde aber eine indirekte Benachteiligung derjenigen Mitgliedstaaten bedeuten, deren Schwergewicht in der Lohnpolitik im kollektiven Verhandlungswesen liegt. In der Bundesrepublik stellt z.B. eine Regelung wie das AEntG, das sich ja nur auf den Baubereich bezieht, eher die Ausnahme dar, während z.B. in Frankreich eine lange Tradition mit Gesetzen zum Mindestlohn besteht.159 Eine Diskriminierung Deutschlands würde in diesem Falle dadurch entstehen, daß nationale Vergütungsregelungen nur deshalb nicht in die Aus- schreibung einbezogen werden dürften, weil der Gesetzgeber ausdrücklich vor- sieht, daß die Tarifparteien autonom über die Vergütungen verhandeln und daß das Ergebnis in Verträgen und nicht in Gesetzen niedergelegt wird.160
Nationale Vergütungsregelungen gelten in der Bundesrepublik hingegen vor allen Dingen für „gehobene“ Dienstleistungsberufe (HOAI für Architekten und Ingenieure, BRAGO für Rechtsanwälte usw.). Zumindest nach der Dienst- leistungs- und Sektorenrichtlinie sind derlei Vergütungsregelungen auf den ersten Blick zulässig.161 Doch würde sich gleichzeitig an die Zuschlagskriterien „niedrigster Preis“ bzw. „wirtschaftlich günstigstes Angebot“ gehalten, würde z.B. ein deutscher Architekt in Spanien niemals einen Auftrag bekommen. Insofern gibt es Auffassungen, die schon in dem in der SKR und DKR formulierten Vorbehalt für nationale Vergütungsregelungen einen Verstoß gegen wesentliche Prinzipien des Primärrechts sehen.162 „Letztlich ist diese Fallgruppe mit der Problematik der vergabefremden Aspekte recht nahe verwandt, da es...um nationale Bestimmungen geht, die die Geltung der Vergaberichtlinien und damit die Erreichung des Ziels eines einheitlichen Beschaffungsmarktes beeinträchtigen.“163 Der einzige Unterschied ist nur, daß es sich um bereits bestehende Regelungen handelt.164
4.5 Zwischenergebnis aus 4
Die Zulässigkeit erweiterter Vergabekriterien muß stets im Einzelfall geprüft werden. Prüfungsmaßstab ist hierbei die Vereinbarkeit mit den Grundgehalten des EGV und mit den Vergaberichtlinien. Bei der Einbeziehung erweiterter Ver- gabekriterien einen Verstoß gegen EG-Recht, beispielsweise gegen die vier Grundfreiheiten, zu vermeiden, dürfte sich jedoch in der Praxis schwierig ge- stalten, denn der EuGH hält sich speziell bei Streitfällen zum öffentlichen Auf- tragswesen auffallend strikt an die Dassonville-Formel.165 Jede auch nur theo- retisch mögliche Diskriminierung wird als Verletzung der im EGV normierten Warenverkehrs-, Niederlassungs- und Dienstleistungsfreiheit beurteilt. Der Grund für die relativ enge Auslegung der Vergaberichtlinen liegt auf der Hand: „Entscheidend für den Protektionismus im öffentlichen Auftragswesen ist aber letztlich die Tendenz der öffentlichen Auftraggeber, vorrangig...lokalen, regionalen oder nationalen Unternehmen den Auftrag zu erteilen...“166 Die im EG-Vertrag normierte Vollendung des Binnenmarktes soll nicht durch protektionistische Maßnahmen, für die erweiterte Vergabekriterien oft nur ein Vorwand sind, gefährdet werden.167
5 Fazit
Folgt man der ständigen Rechtsprechung des EuGH, sind soziale Vergabe- kriterien schwierig umzusetzen. Die Einbeziehung von Umweltkriterien in öffent- liche Ausschreibungen wird hingegen von der Europäischen Kommission zwar ausdrücklich gewünscht und ist auch prinzipiell möglich, doch mangelt es an europäischen Umweltnormen, auf die ein öffentlicher Auftraggeber sich beziehen könnte. Um öffentliche Auftraggeber von dem Verdacht zu befreien, lediglich protektionistische Motive zu verfolgen, wären gerade im Umweltbereich größere Anstrengungen erforderlich, um „europäische Normen und gemeinsame technische Spezifikationen“, beispielsweise ein europäisches Umweltzeichen, zu entwickeln.168
Im Hinblick auf beschäftigungspolitische Kriterien im öffentlichen Beschaffungs- wesen dürfte hingegen eine bloße Homogenisierung der Vergabestandards kaum ausreichen. Die Verfasserin würde sich letztlich der h.L. anschließen, daß zumindest beschäftigungspolitische Vergabekriterien eine Wettbewerbs- verzerrung darstellen, die nicht hinnehmbar sein kann und auch dem eigentlichen Sinn von Vergaberegelungen, nämlich der Schaffung von Transparenz und objektiven Einkaufsregeln, entgegenstehen.169 Die Mängel eines nicht funk- tionierenden, weil nicht homogenen, europäischen Marktes mit Hilfe steuernder Vergabekriterien „heilen“ zu wollen, wäre letztlich bloßes Flickwerk. Die Wirk- samkeit solcher Maßnahmen, die ja stets nur einen Teil des Marktes erfassen können, sei zudem dahingestellt.
Folgerichtig kann sich das Erfordernis einer Homogenisierung nur auf den ganzen Bereich der europäischen Arbeits- und Sozialpolitik erstrecken. Nimmt man beispielsweise die einzig zulässigen Zuschlagskriterien „niedrigster Preis“ bzw. „wirtschaftlich günstigstes Angebot“, findet vor dem Hintergrund unterschiedlicher Lohnniveaus in den Mitgliedstaaten kein freier Wettbewerb, sondern vielmehr eine Wettbewerbsverzerrung zuungunsten der Mitgliedstaaten mit den höchsten Lohnniveaus und den höchsten Standards in Arbeitssicherheit usw. statt. Die faktische Unmöglichkeit, sich auf die vorgesehenen Zuschlagskriterien zu beschränken, ohne Mitgliedstaaten mit einem hohen Lohnniveau gänzlich vom Wettbewerb auszuschließen, kann letztlich nicht im Sinne eines europäischen Binnenmarktes gemäß EG-Vertrag sein. Hier zeigt sich wieder einmal, daß eine europäische Wirtschaftsunion ohne eine europäische Arbeits- und Sozialunion nicht funktionieren kann. Bei unterschiedlichen nationalen Vorgaben können ökonomische Gesetzmäßigkeiten des Marktes nicht greifen. Insofern sind die vielen Bereiche des Arbeits- und Sozialrechts, die immer noch der einstimmigen Billigung des Europäischen Rates bedürfen,170 auch Haupthindernisse auf dem Weg zu einer europäischen Wirtschaftsunion mit einem Vergabewesen, das den freien Wettbewerb garantiert und Protektionismus verhindert.
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Literaturverzeichnis
1. Walter Beck/Norbert Herig: VOB für Praktiker; Kommentar zur Verdingungs- ordnung für Bauleistungen; Teil A Ausgabe 1992, Teile B und C Ausgabe 1996; mit Graphiken, Urteilen und Praxistips; 3., neubearbeitete Auflage; Stuttgart 1997
2. Bundeskartellamt: Bundeskartellamt untersagt Berliner „Tariftreuerklärung“; http://www.bundeskartellamt.de/06111997.htm; 22.12 Uhr
3. Bundeskartellamt: Informationsblatt zum Rechtsschutz bei der Vergabe öffentlicher Aufträge (§§ 97 ff GWB in der vom 1. Januar 1999 geltenden Fassung); http://www.bundeskartellamt.de/vergabe.htm; 22.4.99; 22.14 Uhr
4. Hans-Peter Burchardt: Das neue Vergaberecht - mit neuen Aufgaben und neuen Chancen für den Anwalt; wysiwyg://36http://www.vrp.de/archiv/beitrag/b9900014.htm; 22.4.99; 21.57 Uhr
5. Hans-Gerwin Burgbacher: Skript „Europäisches Wirtschafts- und Verbraucherrecht“, WS 1998/99
6. Walter Daub: Kommentar zur VOL/A: Verdingungsordnung für Leistungen - ausgenommen Bauleistungen - Teil A; Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von Leistungen; begründet von Walter Daub und Rudolf Meierrose; fortgeführt und herausgegeben in 4., vollständig neu bearbeiteter Auflage von Hans Hermann Eberstein; Düsseldorf 1998
7. Deutscher Industrie- und Handelstag (Hrsg.): Öffentliche Aufträge; Bundes- republik Deutschland und EU-Mitgliedstaaten; Ein Leitfaden für Unternehmen und öffentliche Auftraggeber; Hachenburg 1996
8. Die Grünen im Österreichischen Landtag: Rechnungshof-Ausschuß: Grüne fordern Überprüfung der vom EuGH aufgezeigten illegalen Auftragsvergabe durch Landesrechnungshof.; Grüne Landtagsfraktion will außerdem Prüfung der Geschäftsgebarung von LR Blochberger im Landschaftsfonds erreichen.; http://www.landtag.noe.gruene.at/chrono/1990120.htm; 18.4.99; 16.08 Uhr
9. Harald Eschmann: Die Freizügigkeit der EG-Bürger und der Zugang zur öffentlichen Verwaltung; Eine Untersuchung zur gemeinschafts- und verfassungsrechtlichen Stellung der EG-Bürger im öffentlichen Dienst der Bundesrepublik Deutschland (Diss.); Baden-Baden 1992
10. Europäische Kommission: Grünbuch; Das öffentliche Auftragswesen in der Europäischen Union; Überlegungen für die Zukunft; Mitteilung, von der Kommission am 27. November 1996; auf Vorschlag von Herrn Monti beschlossen; http://simap.eu.int.EN/pub/docs/gpde.htm; 11.03.99; 10.30 Uhr
11. Europäische Kommission: Öffentliche Aufträge: Mitteilung der Kommission über politische Prioritäten; http://europa.eu.int/comm/dg15/de/publproc/comm/233.htm; 7.4.99; 13.00 Uhr
12. Europäische Kommission: Öffentliche Aufträge: Vertragsverletzungsverfahren gegen Frankreich, Deutschland, Österreich, Griechenland und Italien; http://europa.eu.int/comm/dg15/publproc/infr/618.htm; 7.4.99, 13.00 Uhr
13. Cordula Haase: Internationale Harmonisierung des öffentlichen Auftrags- wesens (Diss.); Frankfurt/Main 1997
14. Hamburger Abendblatt (kein Verfasser angegeben) vom 22.4.99, S. 14: Hochbau, Kosten um 10% zu hoch; Bericht der Rechnungsprüfer
15. Ute Jasper/Fridhelm Marx: Einführung in: Beck´sche Gesetzessammlung Vergaberecht; 1. Auflage; München 1997
16. Karin Jöns: Brüssel, 22. April 1998; Frauenförderung bei öffentlicher Auftragsvergabe zulässig; EU-Kommission widerspricht Wirtschaftsbehörde in: Pressemitteilungen von Karin Jöns (SPD), Bremer Europaabgeordnete; home.brx.epri.ord/joens/PRESSB.HTM; 18.4.99; 20.10 Uhr
17. Nicolas Michel: Das öffentliche Auftragswesen in der europäischen Recht- sprechung; Systematische Darstellung der Urteile und Beschlüsse des Gerichtshofes der Europäischen Gemeinschaften; aus dem Französischen übersetzt und bearbeitet von Silvia Bucher; Freiburg (Schweiz) 1996
18. Rainer Noch: Die Vergabe von Staatsaufträgen und der Rechtsschutz nach europäischem und deutschem Recht (Diss.); Bielefeld 1997
19. Hans-Joachim Prieß: Das öffentliche Auftragswesen in der Europäischen Union; Gesamtdarstellung der EU/EWR-Vergaberegeln mit Textausgabe; Berlin 1994
20. Thomas Rieckhoff: Die Entwicklung des Berufsbeamtentums in Europa (Diss.); Baden-Baden 1993
21. Jan Rogmans: Öffentliches Auftragswesen; Leitfaden für die Vergabe und Abwicklung von öffentlichen Aufträgen einschließlich Bauaufträgen (VO PR 30/53 und VO PR 1/72); Berlin 1993
22. Paul A. Samuelson/William D. Nordhaus: Volkswirtschaftslehre; Grundlagen der Makro- und Mikroökonomie; Bd.; 1; 8., grundlegend überarbeitete deutsche Neuauflage; Darmstadt 1987
23. Frank Sterner: Rechtsbindungen und Rechtsschutz bei der Vergabe öffent- licher Aufträge; Stuttgart 1996
24. Kathrin Stolz: Das öffentliche Auftragswesen in der EG; Möglichkeiten und Grenzen einer Liberalisierung; Baden-Baden 1991
25. Egbert Wilms: Öffentliche Beschaffung - Vergaberecht; Vortrag anläßlich der Frühjahrstagung der Deutsch-Nordischen Juristenvereinigung e.V. in Luxem- burg am 14.5.1998; http://www.dnj.org/vergabe.htm; 18.4.99; 16.18 Uhr
26. Wirtschaftsprüferkammer: Referentenentwurf für ein Vergaberechts- änderungsgesetz (Stellungnahme); http://www.wpk.de/800x600d/stel07.html; 18.4.99; 16.36 Uhr
Verzeichnis der zitierten EuGH-Entscheidungen
1. Rs. C-76/81, 10.2.82 (Transporte et traveaux/Ministère des traveaux publics), Slg. I-430
2. Rs. C-27-29/86, 9.7.87 (SA constructions et entreprises industrielles (CEI)/Société coopérative „Association intercommunale pour les autoroutes des Ardennes“ (Fonds des routes), Ing. A Bellini e Co. SpA/Régie des bâtiments und Ing. Bellini e Co. SpA/Belgien), Slg. I-3347
3. Rs. C-31/87, 20.9.88 (Gebroeders Beentjes BV/Niederlande), Slg. I-4635
4. Rs. C-45/87, 22.9.88 (Kommission (unterstützt durch Spanien))/Irland (Dundalk)), Slg. I-4929
5. Rs. C-103/88, 22.6.89 (Fratelli Constanzo SpA/Stadt Mailand), Slg. I-1839
6. Rs. C-131/88 (Kommission/Deutschland), Slg. I-825
7. Rs. C-351-88, 11.7.91 (Laboratori Bruneau Srl/Unità sanitaria locale (USL) RM/24 Monterotondo), Slg. I-3641
8. Rs. C-243/89, 22.6.93 (Kommission/Dänemark (Brücke über den Storebælt)), Slg. I-3353
9. Rs. C-295/89, 18.6.91 (Impresa Donà Alfonso 6 Figli SnC/Consorzio per lo sviluppo industriale del comune di Monfalcone, Regione Friuli-Venezia Giulia, Impresa Luigi Tacchino SpA und Impresa Carlutti Costruttori Srl), Slg. I-2967
10. Rs. C-360-89, 3.6.92 (Kommission/Italien(Italienische Gesetzgebung)), Slg. I- 3401
11. Rs. C-362/90, 31.3.92 (Kommission/Italien (USL-Genua)), Slg. I-2353
12. Rs. 24/91, 18.3.92 (Kommission/Spanien (Universidad Complutense)), Slg. I- 1989
13. Rs. C-71/92, 17.11.93 (Kommission/Spanien(Spanische Gesetzgebung)), Slg. I-5923
14. Rs. C-359/93, 24.1.95 (Kommission/Niederlande (Wetterwarte)), Slg. I-1249
15. Rs. C-433/93, 11.8.95 (Kommission/Deutschland), Slg. I-2303
16. Rs. C-318/94, 28.3.96 (Kommission/Deutschland), Slg. I-1949
17. Rs. C-253/95, 2.5.96 (Kommission/Deutschland), Slg. I-2423
18. Rs. C-360/96, 10.11.98 (Gemeente Arnhem, Gemeente Rheden/BFI Holding BV), noch nicht in der Sammlung veröffentlicht
Anhang
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Ute Jasper/Fridhelm Marx: Einführung in: Beck´sche Gesetzes- sammlung Vergaberecht; 1. Auflage; München 1997; S. XX, jedoch mit gerigfügigen Zusätzen der Verfasserin
[...]
1 Vergl. Hamburger Abendblatt (kein Verfasser angegeben) vom 22.4.99: Hochbau, Kosten um 10% zu hoch; Bericht der Rechnungsprüfer; S. 14
2 vergl. Europäische Kommision: Grünbuch; Das öffentliche Auftragswesen in der Europäischen Union; Überlegungen für die Zukunft; Mitteilung, von der Kommision am 27. November 1996; auf Vorschlag von Herrn Monti beschlossen; http://simap.eu.int/EN/pub/docs/gpde.htm; 11.03.99; 10.30 Uhr; S. 1 f.
3 vergl. hierzu: Cordula Haase: Internationale Harmonisierung des öffentlichen Auftragswesens (Diss.); Frankfurt/Main 1997; S. 33 ff. und Egbert Wilms: Öffentliche Beschaffung - Vergaberecht; Vortrag anläßlich der Frühjahrstagung der Deutsch-Nordischen Juristenvereinigung e.V. in Luxemburg am 14.5.1998; http://www.dnj.org/vergabe.htm; 18.4.99; 16.18 Uhr; S. 3 f.
4 Man denke hierbei z.B. an die 1997 erlassene EG-Richtlinie, die die Mitgliedstaaten der europäischen Gemeinschaft zur Einbeziehung von Drittstaaten in den Bieterkreis verpflichtet (RL 97/52/EG, Abl. L 328 vom 28.11.1997).
5 vergl. vergl. Europäische Kommision: Grünbuch; Das öffentliche Auftragswesen in der Europäischen Union; Überlegungen für die Zukunft; Mitteilung, von der Kommision am 27. November 1996; auf Vorschlag von Herrn Monti beschlossen; http://simap.eu.int/EN/pub/docs/gpde.htm; 11.03.99; 10.30 Uhr; S. 1 f.
6 vergl. Walter Beck/Norbert Herig: VOB für Praktiker; Kommentar zur Verdingungsordnung für Bauleistungen; Teil A Ausgabe 1992, Teile B und C Ausgabe 1996; mit Graphiken, Urteilen und Praxistips; 3., neubearbeitete Auflage; Stuttgart 1997
7 Art. 39 ff. EGV n.F.
8 Art. 23 ff. EGV n.F.
9 Art. 49 ff. EGV n.F.
10 Art. 51 ff. EGV n.F.
11 vergl. Europäische Kommision: Grünbuch; Das öffentliche Auftragswesen in der Europäischen Union; Überlegungen für die Zukunft; Mitteilung, von der Kommision am 27. November 1996; auf Vorschlag von Herrn Monti beschlossen; http://simap.eu.int/EN/pub/docs/gpde.htm; 11.03.99; 10.30 Uhr; S. 1 f.
12 Rainer Noch: Die Vergabe von Staatsaufträgen und der Rechtsschutz nach europäischem und deutschem Recht (Diss.); Bielefeld 1997; S. 5
13 vergl. Cordula Haase: Internationale Harmonisierung des öffentlichen Auftragswesens (Diss.); Frankfurt/Main 1997; S. 22
14 Europäische Kommision: Grünbuch; Das öffentliche Auftragswesen in der Europäischen Union; Überlegungen für die Zukunft; Mitteilung, von der Kommision am 27. November 1996; auf Vorschlag von Herrn Monti beschlossen; http://simap.eu.int/EN/pub/docs/gpde.htm; 11.03.99; 10.30 Uhr; S. 5
15 vergl. a.a.O.
16 siehe u.a. Rs. 31/87, 20.9.88 (Gebroeders Beentjes BV/Niederlande), Slg. I-4635 und Rs. 45/87, 22.9.88 (Kommission (unterstützt durch Spanien))/Irland (Dundalk), Slg. I-4929
17 RL 93/38/EWG, Abl. L 199/84 vom 9.8.1993
18 vergl. u.a. EuGHE Rs. 31/87, 20.9.88 (Gebroeders Beentjes BV/Niederlande), Slg. I-4635
19 vergl. Nicolas Michel: Das öffentliche Auftragswesen in der europäischen Rechtsprechung; Systematische Darstellung der Urteile und Beschlüsse des Gerichtshofes der Europäischen Gemeinschaften; aus dem Französischen übersetzt und bearbeitet von Silvia Bucher; Freiburg (Schweiz) 1996; S. 98
20 vergl hierzu: Rainer Noch: Die Vergabe von Staatsaufträgen und der Rechtsschutz nach europäischem und deutschem Recht (Diss.); Bielefeld 1997; S. 50 ff.
21 Kathrin Stolz: Das öffentliche Auftragswesen in der EG; Möglichkeiten und Grenzen einer Liberalisierung; Baden-Baden 1991, S. 5
22 Art. 39 ff. EGV n.F.
23 vergl. hierzu u.a.: Kathrin Stolz: Das öffentliche Auftragswesen in der EG; Möglichkeiten und Grenzen einer Liberalisierung; Baden-Baden 1991, S. 6 ff. und Rainer Noch: Die Vergabe von Staatsaufträgen und der Rechtsschutz nach europäischem und deutschem Recht (Diss.); Bielefeld 1997; S. 4 f.
24 vergl. Rainer Noch: Die Vergabe von Staatsaufträgen und der Rechtsschutz nach europäischem und deutschem Recht (Diss.); Bielefeld 1997; S. 16 ff.
25 RL 70/32/EWG (Abl. L 13/1970) und RL 77/67 (Abl. L 13/1977)
26 vergl. z.B. Rs. C-45/87, 22.9.88 (Kommission (unterstützt durch Spanien)/Irland (Dundalk), Slg. I-4635 und Rs. C-243/89, 22.6.93 (Kommission/Dänemark (Brücke über den Storebælt)), Slg. I-3353
27 Rainer Noch: Die Vergabe von Staatsaufträgen und der Rechtsschutz nach europäischem und deutschem Recht (Diss.); Bielefeld 1997; S. 16
28 vergl. hierzu: Kathrin Stolz: Das öffentliche Auftragswesen in der EG; Möglichkeiten und Grenzen einer Liberalisierung; Baden-Baden 1991, S. 7 f.
29 vergl. Cordula Haase: Internationale Harmonisierung des öffentlichen Auftragswesens (Diss.); Frankfurt/Main 1997; S. 23
30 vergl. Europäische Kommision: Grünbuch; Das öffentliche Auftragswesen in der Europäischen Union; Überlegungen für die Zukunft; Mitteilung, von der Kommision am 27. November 1996; auf Vorschlag von Herrn Monti beschlossen; http://simap.eu.int/EN/pub/docs/gpde.htm; 11.03.99; 10.30 Uhr; S. 10 ff.
31 vergl. Egbert Wilms: Öffentliche Beschaffung - Vergaberecht; Vortrag anläßlich der Frühjahrstagung der Deutsch-Nordischen Juristenvereinigung e.V. in Luxemburg am 14.5.1998; http://www.dnj.org/vergabe.htm; 18.4.99; 16.18 Uhr; S. 8
32 vergl. Rainer Noch: Die Vergabe von Staatsaufträgen und der Rechtsschutz nach europäischem und deutschem Recht (Diss.); Bielefeld 1997; S. 16 ff.
33 RL 71/305/EWG, Abl. L 175/5 vom 16.8.1971
34 RL 93/37 EWG, Abl. L 199/54 vom 9.8.1994
35 RL 77/62/EWG, Abl. L 13/1 vom 15.1.1977
36 RL 93/36/EWG, Abl. L 199/1 vom 9.8.1993
37 Abl. L 209/1 vom 24.7.1992
38 Hans -Joachim Prieß: Das öffentliche Auftragswesen in der Europäischen Union; Gesamtdarstellung der EU/EWR-Vergaberegeln mit Textausgabe; Berlin 1994; S. 46
39 vergl. Egbert Wilms: Öffentliche Beschaffung - Vergaberecht; Vortrag anläßlich der Frühjahrstagung der Deutsch-Nordischen Juristenvereinigung e.V. in Luxemburg am 14.5.1998; http://www.dnj.org/vergabe.htm; 18.4.99; 16.18 Uhr; S. 11
40 RL 90/531/EWG, Abl. L 297/1 vom 29.10.1990
41 RL 93/38/EWG, Abl. L 199/84 vom 9.8.1993
42 Art. 14 Abs. 1 SKR
43 vergl. Rainer Noch: Die Vergabe von Staatsaufträgen und der Rechtsschutz nach europäischem und deutschem Recht (Diss.); Bielefeld 1997; S. 25
44 RL 89/665/EWG, Abl. L 395/33 vom 30.12.1989
45 RL 92/13/EWG, Abl. L 76/14 vom 23.3.1992
46 siehe u.a. Rs. C-131/88 (Kommission/Deutschland), Slg. I-825 und Rs. C-433/93, 11.8.95 (Kommission/Deutschland), Slg. I-23303, 2311 sowie Rs. C-253/95 (Kommission/Deutschland)
47 vergl. Ute Jasper/Fridhelm Marx: Einführung in: Beck´sche Gesetzessammlung Vergaberecht; 1. Auflage; München 1997; S. XXV f.
48 Zur Verpflichtung der Veröffentlichung im EG-Amtsblatt: siehe EuGHE Rs. C-24/91, 18.3.92 (Kommission/Spanien (Universidad Complutense)), Slg. S. I-1989
49 vergl. Ute Jasper/Fridhelm Marx: Einführung in: Beck´sche Gesetzessammlung Vergaberecht; 1. Auflage; München 1997; S. XXV
50 siehe § 8 Nr. 2 Abs. 2 VOB/A und § 7 Nr. 2 Abs. 2 VOL/A
51 siehe z.B. Rs. C-318/94, 28.3.96 (Kommission/Bundesrepublik Deutschland), Slg. I-1949
52 Hans -Joachim Prieß: Das öffentliche Auftragswesen in der Europäischen Union; Gesamtdarstellung der EU/EWR-Vergaberegeln mit Textausgabe; Berlin 1994; S. 67
53 Walter Daub: Kommentar zur VOL/A: Verdingungsordnung für Leistungen - ausgenommen Bauleistungen - Teil A; Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von Leistungen; begründet von Walter Daub und Rudolf Meierrose; fortgeführt und herausgegeben in 4., vollständig neu bearbeiteter Auflage von Hans Hermann Eberstein; Düsseldorf 1998; S. 201
54 Ute Jasper/Fridhelm Marx: Einführung in: Beck´sche Gesetzessammlung Vergaberecht; 1. Auflage; München 1997; S. X
55 vergl. Frank Sterner: Rechtsbindungen und Rechtsschutz bei der Vergabe öffentlicher Aufträge; Stuttgart 1996; S. 71 f.
56 Ute Jasper/Fridhelm Marx: Einführung in: Beck´sche Gesetzessammlung Vergaberecht; 1. Auflage; München 1997; S. IX
57 Jan Rogmans: Öffentliches Auftragswesen; Leitfaden für die Vergabe und Abwicklung von öffentlichen Aufträgen einschließlich Bauaufträgen (VO PR 30/53 und VO PR 1/72); Berlin 1993; S. 13
58 vergl. Ute Jasper/Fridhelm Marx: Einführung in: Beck´sche Gesetzessammlung Vergaberecht; 1. Auflage; München 1997; S. X
59 Wirtschaftsprüferkammer: Referentenentwurf für ein Vergaberechtsänderungsgesetz (Stellungnahme); http://www.wpk.de/800x600d/stel07.html; 18.4.99; 16.36 Uhr; S. 2
60 vergl. Europäische Kommision: Grünbuch; Das öffentliche Auftragswesen in der Europäischen Union; Überlegungen für die Zukunft; Mitteilung, von der Kommision am 27. November 1996; auf Vorschlag von Herrn Monti beschlossen; http://simap.eu.int/EN/pub/docs/gpde.htm; 11.03.99; 10.30 Uhr; S. 1
61 Egbert Wilms: Öffentliche Beschaffung - Vergaberecht; Vortrag anläßlich der Frühjahrstagung der Deutsch-Nordischen Juristenvereinigung e.V. in Luxemburg am 14.5.1998; http://www.dnj.org/vergabe.htm; 18.4.99; 16.18 Uhr; S. 12
62 RL 93/38/EWG, Abl. 199/84 vom 9.8.1993
63 Harald Eschmann: Die Freizügigkeit der EG-Bürger und der Zugang zur öffentlichen Verwaltung; Eine Untersuchung zur gemeinschafts- und verfassungsrechtlichen Stellung der EG-Bürger im öffentlichen Dienst der Bundesrepublik Deutschland (Diss.); Baden-Baden 1992; S. 128
64 Europäische Kommision: Grünbuch; Das öffentliche Auftragswesen in der Europäischen Union; Überlegungen für die Zukunft; Mitteilung, von der Kommision am 27. November 1996; auf Vorschlag von Herrn Monti beschlossen; http://simap.eu.int/EN/pub/docs/gpde.htm; 11.03.99; 10.30 Uhr; S. 1
65 vergl. a.a.O.
66 vergl. z.B. § 25 Nr. 3 VOL/A
67 Ute Jasper/Fridhelm Marx: Einführung in: Beck´sche Gesetzessammlung Vergaberecht; 1. Auflage; München 1997; S. XV
68 vergl. Jan Rogmans: Öffentliches Auftragswesen; Leitfaden für die Vergabe und Abwicklung von öffentlichen Aufträgen einschließlich Bauaufträgen (VO PR 30/53 und VO PR 1/72); Berlin 1993; S. 22
69 vergl. Ute Jasper/Fridhelm Marx: Einführung in: Beck´sche Gesetzessammlung Vergaberecht; 1. Auflage; München 1997; S. XV
70 vergl. a.a.O.
71 ebd. S. XXVIII
72 vergl. vergl. Ute Jasper/Fridhelm Marx: Einführung in: Beck´sche Gesetzessammlung Vergaberecht; 1. Auflage; München 1997; S. XXVIII
73 vergl. Rainer Noch: Die Vergabe von Staatsaufträgen und der Rechtsschutz nach europäischem und deutschem Recht (Diss.); Bielefeld 1997; S. 140
74 Bundeskartellamt: Informationsblatt zum Rechtsschutz bei der Vergabe öffentlicher Aufträge (§§ 97 ff GWB in der vom 1. Januar 1999 geltenden Fassung;) http://www.bundeskartellamt.de/vergabe.htm; 22.4.99; 22.14 Uhr; S. 1
75 §§ 97 - 120 GWB n.F.
76 vergl. Hans-Peter Burchardt: Das neue Vergaberecht - mit neuen Aufgaben und neuen Chancen für den Anwalt; wysiwyg://36http://www.vrp.de/archiv/beitrag/b9900014.htm; 22.4.99; 21.57 Uhr; S. 1
77 § 104 GWB n.F.
78 § 120 GWB n.F.
79 Hans -Peter Burchardt: Das neue Vergaberecht - mit neuen Aufgaben und neuen Chancen für den Anwalt; wysiwyg://36http://www.vrp.de/archiv/beitrag/b9900014.htm; 22.4.99; 21.57 Uhr; S. 2
80 § 115 GWB n.F.
81 vergl. Deutscher Industrie- und Handelstag (Hrsg.): Öffentliche Aufträge; Bundesrepublik Deutschland und EU-Mitgliedstaaten; Ein Leitfaden für Unternehmen und öffentliche Auftraggeber; Hachenburg 1996; S. 32
82 vergl. Ute Jasper/Fridhelm Marx: Einführung i n: Beck´sche Gesetzessammlung Vergaberecht; 1. Auflage; München 1997; S. XXVI ff.
83 vergl. Ute Jasper/Fridhelm Marx: Einführung in: Beck´sche Gesetzessammlung Vergaberecht; 1. Auflage; München 1997; S. XXVI ff.
84 Europäische Kommision: Grünbuch; Das öffentliche Auftragswesen in der Europäischen Union; Überlegungen für die Zukunft; Mitteilung, von der Kommision am 27. November 1996; auf Vorschlag von Herrn Monti beschlossen; http://simap.eu.int/EN/pub/docs/gpde.htm; 11.03.99; 10.30 Uhr; S. 5
85 vergl. a.a.O.
86 vergl. Kathrin Stolz: Das öffentliche Auftragswesen in der EG; Möglichkeiten und Grenzen einer Liberalisierung; Baden-Baden 1991, S. 77
87 Hans -Joachim Prieß: Das öffentliche Auftragswesen in der Europäischen Union; Gesamtdarstellung der EU/EWR-Vergaberegeln mit Textausgabe; Berlin 1994; S. 81
88 Rs. 45/87, 22.9.88 (Kommission (unterstützt durch Spanien)/Irland (Dundalk)), Slg. I-4929, Randnr. Nr. 27
89 z.B. in Art. 8 Abs. 6 LKR (RL 93/36EWG)
90 vergl. EuGHE Rs. C-359/93, 24.1.95 (Kommission/Niederlande (Wetterwarte)), Slg. I-1249
91 Deutscher Industrie- und Handelstag (Hrsg.): Öffentliche Aufträge; Bundesrepublik Deutschland und EU-Mitgliedstaaten; Ein Leitfaden für Unternehmen und öffentliche Auftraggeber; Hachenburg 1996; S. 13
92 z.B. bei einem laufenden Verfahren wegen Hinterziehung von Sozialabgaben
93 siehe EuGHE Rs. 76/81, 10.2.82 (Transporoute et traveaux/Ministère des traveaux publics), Slg. I-430
94 Art. 31 SKR
95 vergl. z.B. EuGHE Rs. C-71/92, 17.11.93 (Kommission/Spanien(Spanische Gesetzgebung)), Slg. I-5923, Randnr. 46
96 EuGHE Rs. 31/87, 20.9.88 (Gebroeders Beentjes BV/Niederlande), Slg. I-4635
97 vergl. u.a. Rs. 76/81, 10.2.82 (Transporoute et traveaux/Ministère des traveaux publics, Slg. I- 417 und Rs. 27/29/86, 9.7.87 (SA constructions et entreprises industrielles (CEI)/Société coopérative „Association intercommunale pour les autoroutes des Ardennes“ (Fonds des routes), Ing. A Bellini e Co. SpA/Régie des bâtiments und Ing. Bellini e Co. SpA/Belgien, Slg. I- 3347, 3372
98 vergl. z.B. EuGHE Rs. C-362/90, 31.3.92 (Kommission/Italien (USL-Genua)), Slg. I-2353
99 vergl. Europäische Kommission: Öffentliche Aufträge: Vertragsverletzungsverfahren gegen Frankreich, Deutschland, Österreich, Griechenland und Italien; http://europa.eu.int/comm/dg15/publproc/infr/618.htm; 7.4.99, 13.00 Uhr; S. 3
100 vergl. hierzu: Hans-Joachim Prieß: Das öffentliche Auftragswesen in der Europäischen Union; Gesamtdarstellung der EU/EWR-Vergaberegeln mit Textausgabe; Berlin 1994; S. 93 ff.
101 Jan Rogmans: Öffentliches Auftragswesen; Leitfaden für die Vergabe und Abwicklung von öffentlichen Aufträgen einschließlich Bauaufträgen (VO PR 30/53 und VO PR 1/72); Berlin 1993; S. 22
102 vergl. EuGHE Rs. , 22.6.89 (Fratelli Constanzo SpA/Stadt Mailand), Slg. I-1839, Randnr. 19 sowie Rs. C-295/89, 18.6.91 (Impresa Donà Alfonso 6 Figli SnC/Consorzio per lo sviluppo industriale del comune di Monfalcone, Regione Friuli-Venezia Giulia, Impresa Luigi Tacchino SpA und Impresa Carlutti Costruttori Srl), Slg. I-2967, Randnr. 16
103 Art. 30 Abs. 4 BKR, Art. 27 LKR und Art. 37 DKR
104 Art. 30 Abs. 1 BKR, Art. 26 Abs. 1 b LKR, Art. 36 Abs. A b DKR und Art. 34 Abs. 1 b SKR
105 vergl. Hans-Joachim Prieß: Das öffentliche Auftragswesen in der Europäischen Union; Gesamtdarstellung der EU/EWR-Vergaberegeln mit Textausgabe; Berlin 1994; S. 104
106 Cordula Haase: Internationale Harmonisierung des öffentlichen Auftragswesens (Diss.); Frankfurt/Main 1997; S. 23
107 vergl. Kathrin Stolz: Das öffentliche Auftragswesen in der EG; Möglichkeiten und Grenzen einer Liberalisierung; Baden-Baden 1991, S. 89
108 vergl. ebd., S. 24
109 vergl. a.a.O.
110 vergl. Die Grünen im Österreichischen Landtag: Rechnungshof-Ausschuß: Grüne fordern Überprüfung der vom EuGH aufgezeigten illegalen Auftragsvergabe durch Landesrechnungshof.; Grüne Landtagsfraktion will außerdem Prüfung der Geschäftsgebarung von LR Blochberger im Landschaftsfonds erreichen.; http://www.landtag.noe.gruene.at/chrono/1990120.htm; 18.4.99; 16.08 Uhr; S. 1
111 Unter einem Submissionskartell ist ein Kartell zu verstehen, das die Angabe eines einheitlichen Angebotspreises zum Ziel hat.
112 vergl. Cordula Haase: Internationale Harmonisierung des öffentlichen Auftragswesens (Diss.); Frankfurt/Main 1997; S. 29 f.
113 Kathrin Stolz: Das öffentliche Auftragswesen in der EG; Möglichkeiten und Grenzen einer Liberalisierung; Baden-Baden 1991, S. 86
114 Gesetz zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft vom 8.7.1967
115 vergl. Paul A. Samuelson/William D. Nordhaus: Volkswirtschaftslehre; Grundlagen der Makro- und Mikroökonomie; Bd. 1; 8., grundlegend überarbeitete deutsche Neuauflage; Darmstadt 1987; S. 239 ff.
116 vergl. Jan Rogmans: Öffentliches Auftragswesen; Leitfaden für die Vergabe und Abwicklung von öffentlichen Aufträgen einschließlich Bauaufträgen (VO PR 30/53 und VO PR 1/72); Berlin 1993; S. 22
117 siehe hierzu RLen vom 1.6.1976, Bundesanzeiger 1976, Nr. 111
118 Kathrin Stolz: Das öffentliche Auftragswesen in der EG; Möglichkeiten und Grenzen einer Liberalisierung; Baden-Baden 1991, S. 89
119 vergl. a.a.O.
120 vergl. Bundeskartellamt: Bundeskartellamt ordnet sofortige Vollziehung seiner Untersagung der Berliner Tariftreueerklärung an; http://www.bundeskartellamt.de/28101998.htm; S. 1
121 vergl. hierzu: RLen vom 11.8.1975, Bundesanzeiger 1975, Nr. 152
122 vergl. Cordula Haase: Internationale Harmonisierung des öffentlichen Auftragswesens (Diss.); Frankfurt/Main 1997; S. 29
123 Kathrin Stolz: Das öffentliche Auftragswesen in der EG; Möglichkeiten und Grenzen einer Liberalisierung; Baden-Baden 1991, S. 91
124 vergl. ebd. S. 91 f.
125 vergl. Rainer Noch: Die Vergabe von Staatsaufträgen und der Rechtsschutz nach europäischem und deutschem Recht (Diss.); Bielefeld 1997; S. 65
126 vergl. Rainer Noch: Die Vergabe von Staatsaufträgen und der Rechtsschutz nach europäischem und deutschem Recht (Diss.); Bielefeld 1997; S. 64 ff. und Kathrin Stolz: Das öffentliche Auftragswesen in der EG; Möglichkeiten und Grenzen einer Liberalisierung; Baden-Baden 1991, S. 65
127 vergl. Kathrin Stolz: Das öffentliche Auftragswesen in der EG; Möglichkeiten und Grenzen einer Liberalisierung; Baden-Baden 1991, S. 91 ff.
128 vergl. a.a.O.
129 vergl. Europäische Kommision: Grünbuch; Das öffentliche Auftragswesen in der Europäischen Union; Überlegungen für die Zukunft; Mitteilung, von der Kommision am 27. November 1996; auf Vorschlag von Herrn Monti beschlossen; http://simap.eu.int/EN/pub/docs/gpde.htm; 11.03.99; 10.30 Uhr; S. 35 ff.
130 vergl. Rainer Noch: Die Vergabe von Staatsaufträgen und der Rechtsschutz nach europäischem und deutschem Recht (Diss.); Bielefeld 1997; S. 65
131 vergl. Kathrin Stolz: Das öffentliche Auftragswesen in der EG; Möglichkeiten und Grenzen einer Liberalisierung; Baden-Baden 1991, S. 96 f.
132 vergl. Europäische Kommission: Öffentliche Aufträge: Mitteilung der Kommission über politische Prioritäten; http://europa.eu.int/comm/dg15/de/publproc/comm/233.htm; S. 3 f.
133 vergl. Kathrin Stolz: Das öffentliche Auftragswesen in der EG; Möglichkeiten und Grenzen einer Liberalisierung; Baden-Baden 1991, S. 90 ff.
134 vergl. a.a.O.
135 vergl. Europäische Kommission: Öffentliche Aufträge: Mitteilung der Kom mission über politische Prioritäten; http://europa.eu.int/comm/dg15/de/publproc/comm/233.htm; S. 1
136 vergl. hierzu u.a. Rainer Noch: Die Vergabe von Staatsaufträgen und der Rechtsschutz nach europäischem und deutschem Recht (Diss.); Bielefeld 1997; S. 64 ff. und Kathrin Stolz: Das öffentliche Auftragswesen in der EG; Möglichkeiten und Grenzen einer Liberalisierung; Baden-Baden 1991, S. 86 ff.
137 vergl. Hans-Joachim Prieß: Das öffentliche Auftragswesen in der Europäischen Union; Gesamtdarstellung der EU/EWR-Vergaberegeln mit Textausgabe; Berlin 1994; S. 109
138 vergl. Rs. C-351-88, 11.7.91 (Laboratori Bruneau Srl/Unità sanitaria locale (USL) RM/24 Monterotondo, Slg. I-3641, Randnr. 7 und Rs. C-360-89, 3.6.92 (Kommission/Italien(Italienische Gesetzgebung)), Slg. I-3401
139 vergl. Rs. C-243/89, 22.6.93 (Kommission/Dänemark (Brücke über den Storebælt)), Slg. I- 3353
140 vergl. Rs. 31/87, 20.9.88 (Gebroeders Beentjes BV/Niederlande), Slg. I-4635, Randnr. 32 ff.
141 Die Kommission äußerte diese Auffassung anläßlich einer Anfrage einer SPD- Europaabgeordneten.
142 vergl. Karin Jöns: Brüssel 22. April 1998; Frauenförderung bei öffentlicher Auftragsvergabe zulässig; EU-Kommission widerspricht Wirtschaftsbehörde in: Pressemitteilungen von Karin Jöns (SPD), Bremer Europaabgeordnete; home.brx.epri.ord/joens/PRESSB.HTM; 18.4.99; 20.10 Uhr; S. 4
143 Europäische Kommission: Öffentliche Aufträge: Mitteilung der Kommission über politische Prioritäten; http://europa.eu.int/comm/dg15/de/publproc/comm/233.htm; S. 45
144 vergl. ebd. S. 45 f.
145 vergl. a.a.O.
146 Rs. 31/87, 20.9.88 (Gebroeders Beentjes BV/Niederlande), Slg. I-4635
147 vergl. ebd. Randnr. 28 ff.
148 siehe nahezu alle zitierten EuGH -Urteile in dieser Arbeit
149 vergl. Rs. C-359/93, 24.1.95 (Kommission/Niederlande (Wetterwarte)), Slg. I-1249
150 Europäische Kommision: Grünbuch; Das öffentliche Auftragswesen in der Europäischen Union; Überlegungen für die Zukunft; Mitteilung, von der Kommision am 27. November 1996; auf Vorschlag von Herrn Monti beschlossen; http://simap.eu.int/EN/pub/docs/gpde.htm; 11.03.99; 10.30 Uhr; S. 44
151 vergl. a.a.O.
152 vergl. a.a.O.
153 Gesetz über zwingende Arbeitsbedingungen bei grenzüberschreitenden Dienstleistungen (Arbeitnehmer-Entsendegesetz, AEntG) vom 26.2.96
154 Rainer Noch: Die Vergabe von Staatsaufträgen und der Rechtsschutz nach europäischem und deutschem Recht (Diss.); Bielefeld 1997; S. 66
155 vergl. EuGHE Rs. C-243/89, 22.6.93 (Kommission/Dänemark (Brücke über den Storebælt)), Slg. I-3353
156 KG, Beschluß vom 20.5.98, Kart 24/97 - Tariftreueerklärung
157 u.a. wegen Verstoß gegen § 3 TVG (Tarifgebundenheit) und Art. 9 Abs. 3 GG (sog. „negative Koalitionsfreiheit“)
158 vergl. KG, Beschluß vom 20.5.98, Kart 24/97 - Tariftreueerklärung
159 bis 1968/70: Salaire Minimum Interprofessionel Garanti (SMIG), seither: Salaire Minimum Interprofessionel de Croissance (SMIC)
160 vergl. §§ 2 ff. TVG
161 Art. 36 Abs. 1 DKR und Art. 34 Abs. 1 SKR
162 vergl. Rainer Noch: Die Vergabe von Staatsaufträgen und der Rechtsschutz nach europäischem und deutschem Recht (Diss.); Bielefeld 1997; S. 66 ff.
163 Rainer Noch: Die Vergabe von Staatsaufträgen und der Rechtsschutz nach europäischem und deutschem Recht (Diss.); Bielefeld 1997; S. 68
164 vergl. ebd. S. 69
165 EuGHE Rs. 852/74 (Dassonville), zitiert nach Hans -Gerwin Burgbacher: Skript „Europäisches Wirtschafts- und Verbraucherrecht“, WS 1998/99, S. 23: Danach ist eine Maßnahme gleicher Wirkung (im Bezug auf den freien Warenverkehr) „jede Handelsregelung der Mitgliedstaaten, die geeignet ist, den innergemeinschaftlichen Handel unmittelbar oder mittelbar, tatsächlich oder potentiell (Hervorh. d. Verf.) zu behindern“.
166 vergl. Kathrin Stolz: Das öffentliche Auftragswesen in der EG; Möglichkeiten und Grenzen einer Liberalisierung; Baden-Baden 1991, S. 91
167 vergl. Europäische Kommission: Öffentliche Aufträge: Mitteilung der Kommission über politische Prioritäten; http://europa.eu.int/comm/dg15/de/publproc/comm/233.htm; S. 46
168 vergl. Europäische Kommision: Grünbuch; Das öffentliche Auftragswesen in der Europäischen Union; Überlegungen für die Zukunft; Mitteilung, von der Kommision am 27. November 1996; auf Vorschlag von Herrn Monti beschlossen; http://simap.eu.int/EN/pub/docs/gpde.htm; 11.03.99; 10.30 Uhr; S. 44
169 vergl. hierzu: Rainer Noch: Die Vergabe von Staatsaufträgen und der Rechtsschutz nach europäischem und deutschem Recht (Diss.); Bielefeld 1997; S. 64 ff. und Kathrin Stolz: Das öffentliche Auftragswesen in der EG; Möglichkeiten und Grenzen einer Liberalisierung; Baden-Baden 1991, S. 99 ff.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Zweck des gemeinschaftsrechtlichen Vergaberechts?
Das gemeinschaftsrechtliche Vergaberecht zielt darauf ab, einen wettbewerbsorientierten Beschaffungsmarkt zu schaffen, den grenzüberschreitenden Handel zu fördern, und eine rationelle Verwendung öffentlicher Mittel durch die Wahl des besten Angebots zu gewährleisten. Es soll sicherstellen, dass öffentliche Aufträge transparent und diskriminierungsfrei vergeben werden.
Wer sind die Adressaten des EG Vergaberechts?
Adressaten des EG Vergaberechts sind öffentliche Auftraggeber, deren Definition durch die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und die Sektorenrichtlinie erweitert wurde. Es umfasst nicht nur formale staatliche Stellen, sondern auch Einrichtungen, die Aufgaben im Allgemeininteresse erfüllen und überwiegend vom Staat finanziert oder kontrolliert werden.
Welche Struktur hat das europäische Vergaberecht?
Das europäische Vergaberecht besteht aus dem EG-Vertrag als primärrechtlichem Rahmen und den daraus resultierenden Vergaberichtlinien als Sekundärrecht. Die Grundfreiheiten des EGV, insbesondere die Warenverkehrsfreiheit, sind maßgeblich. Die Vergaberichtlinien umfassen materielle Richtlinien (BKR, LKR, DKR, SKR) und Rechtsmittelrichtlinien.
Was sind die Grundzüge des öffentlichen Auftragswesens in Deutschland?
Das deutsche Vergaberecht, bis 1999 Teil des Haushaltsrechts, regelt die Vergabe öffentlicher Aufträge auf Grundlage von Prinzipien wie dem Privatrechtsprinzip, dem Wettbewerbsprinzip, dem Wirtschaftlichkeitsprinzip, dem Prinzip der dezentralen Beschaffung und dem Konsensprinzip. Es unterscheidet zwischen öffentlicher Ausschreibung, beschränkter Ausschreibung und freihändiger Vergabe.
Wie ist der Rechtsschutz im deutschen Vergaberecht geregelt?
Seit 1999 ist das Vergaberecht im 4. Teil des GWB geregelt, wodurch Bieter subjektive Rechte auf Einhaltung der Vergabevorschriften haben. An die Stelle der Vergabeprüfstelle ist die Vergabekammer getreten, deren Entscheidungen durch Vergabesenate bei den Oberlandesgerichten überprüft werden können.
Was sind herkömmliche Vergabekriterien?
Herkömmliche Vergabekriterien umfassen Zugangskriterien (technische Anforderungen), Ausschlusskriterien (Verstöße gegen Strafrecht, Konkursverfahren), Eignungskriterien (formelle und materielle Anforderungen an die Leistungsfähigkeit des Bieters) und Zuschlagskriterien (niedrigster Preis oder wirtschaftlich günstigstes Angebot).
Was sind erweiterte Vergabekriterien?
Erweiterte Vergabekriterien sind solche, die über die herkömmlichen Kriterien hinausgehen und wirtschaftlich-politische (Konjunktursteuerung, Förderung einzelner Industriezweige), soziale (Bevorzugung bestimmter Personengruppen) oder Umweltkriterien (Bevorzugung umweltfreundlicher Produkte) berücksichtigen.
Welchen Sinn machen erweiterte Vergabekriterien?
Aus wirtschaftspolitischer Sicht können erweiterte Vergabekriterien eine steuernde Funktion haben und längerfristig positive Effekte erzielen. Das Ziel vieler Präferenzregelungen ist der Erhalt eines funktionierenden Wettbewerbs. Kritiker bemängeln jedoch mögliche Wettbewerbsverzerrungen und eine Belastung öffentlicher Haushalte.
Wie ist die rechtliche Zulässigkeit erweiterter Vergabekriterien geregelt?
Erweiterte Vergabekriterien sind nur in engen Grenzen zulässig und müssen mit dem EG-Vertrag und den Vergaberichtlinien vereinbar sein. Pauschale Bevorzugungen bestimmter Regionen oder die Forderung nach einheimischen Materialien sind unzulässig. Umweltkriterien und soziale Kriterien wie die Beschäftigung von Langzeitarbeitslosen können unter bestimmten Bedingungen zulässig sein.
Welche Punkte sind bei der Einbeziehung umweltpolitischer Vergabekriterien zu beachten?
Bei der Einbeziehung umweltpolitischer Vergabekriterien darf es zu keiner Diskriminierung inländischer Erzeugnisse kommen und es sind europäische Standards zu wahren. Es dürfen nur Maße, Normen und Messwerte verwendet werden, die europäischen Standards entsprechen.
Details
- Titel
- Die Zulässigkeit beschäftigungs- und umweltpolitischer Vergabekriterien bei öffentlichen Aufträgen
- Hochschule
- Hamburger Universität für Wirtschaft und Politik (ehem. Hochschule für Wirtschaft und Politik)
- Veranstaltung
- Europäisches Wirtschaftsrecht
- Note
- 1,75
- Autor
- Birgit Mamood (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 1999
- Seiten
- 42
- Katalognummer
- V95304
- ISBN (eBook)
- 9783638079822
- Dateigröße
- 470 KB
- Sprache
- Deutsch
- Anmerkungen
- Diplomarbeit zur Erlangung des ",Diploms für Wirtschafts- und Arbeitsrecht",
- Schlagworte
- Zulässigkeit Vergabekriterien Aufträgen Europäisches Wirtschaftsrecht
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 0,99
- Arbeit zitieren
- Birgit Mamood (Autor:in), 1999, Die Zulässigkeit beschäftigungs- und umweltpolitischer Vergabekriterien bei öffentlichen Aufträgen, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/95304
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-