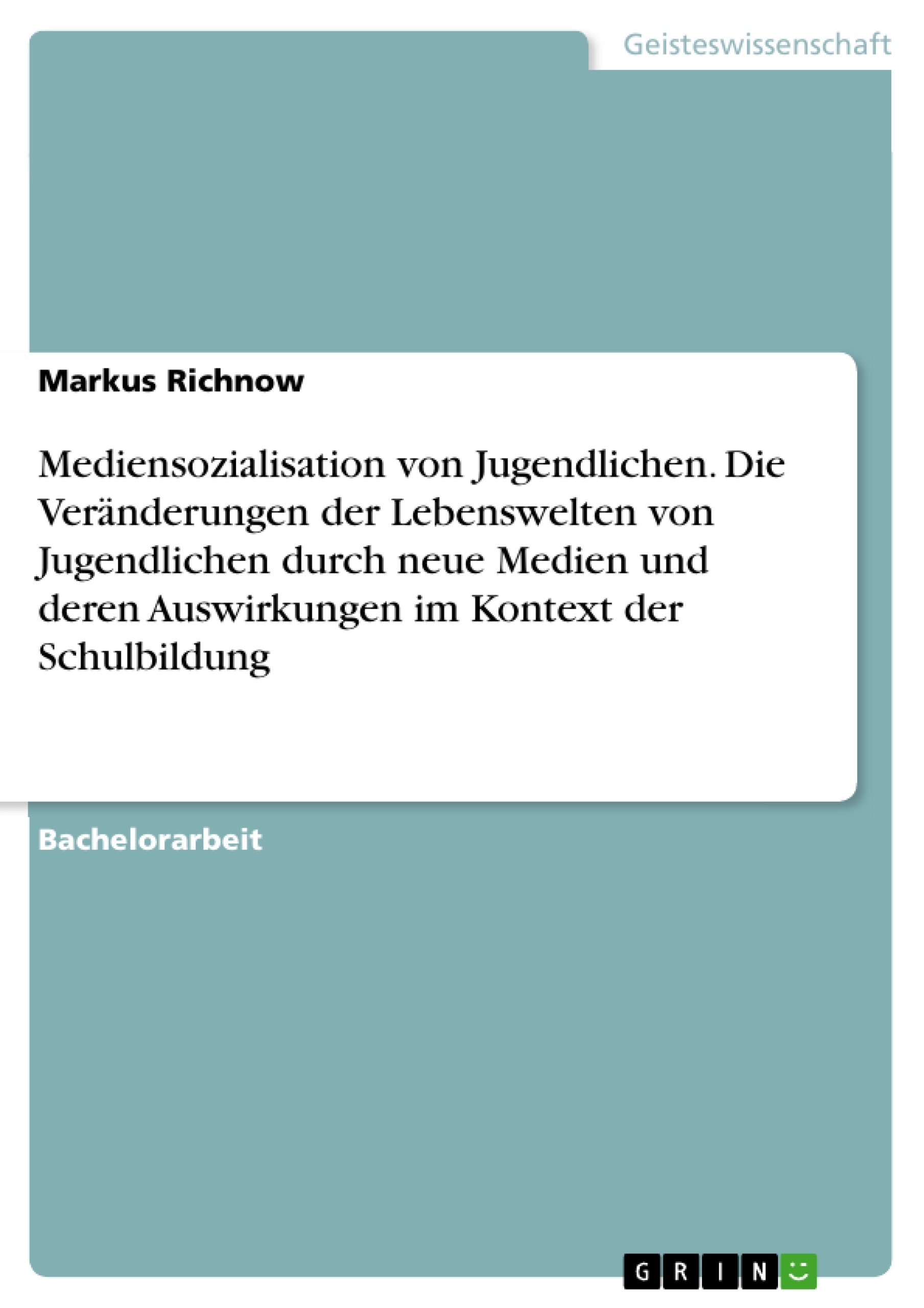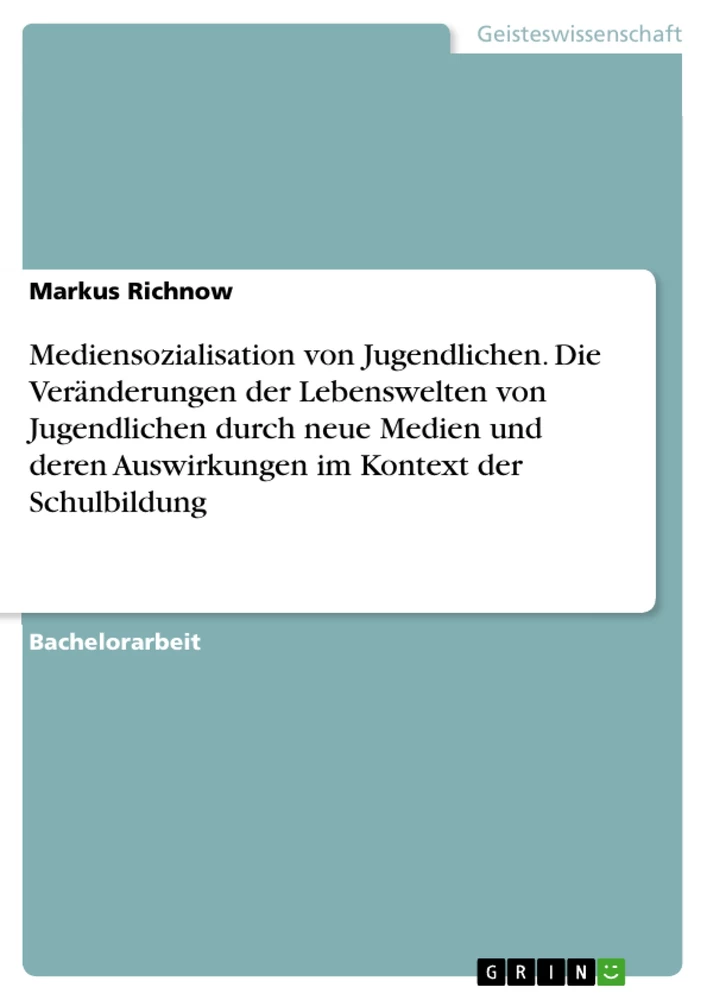
Mediensozialisation von Jugendlichen. Die Veränderungen der Lebenswelten von Jugendlichen durch neue Medien und deren Auswirkungen im Kontext der Schulbildung
Bachelorarbeit, 2020
46 Seiten, Note: 2.0
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Annäherung an die Begriffe Medien und Sozialisation
- Medienwirkung vs. Mediensozialisation
- Medienwirkungen
- Mediensozialisation
- Mediennutzung zwischen Selbst- und Fremdsozialisation
- Zeitgeschichte und Generationen
- Generationengestalten
- Generationen und Medien
- Medienaneignung im Jugendalter
- Neue Medien und die kommunikative Vernetzung Jugendlicher
- Aufwachsen in digitalen Welten im Kontext verschiedener Internetdienste
- Internetdienste und der virtuelle Raum des Internets
- Internetsuche
- Soziale Netzwerke
- JIM - Jugend, Information, Medien Studie 2019 eine darstellende Zusammenfassung
- Jugendliche Lebenswelten in der Mediengesellschaft und mediale Inszenierung
- Risiken im Entwicklungsverlauf von Jugendlichen durch Medien
- Auflösung der Identitätsgrenzen - Identitätskonstruktion
- Konsum- und Anpassungsdruck
- Verschiebungen von Selbst- und Weltbild
- Zeitmanagement
- Chancen im Entwicklungsverlauf von Jugendlichen durch Medien mit kritischen Verweisen
- Problemauswirkungen aus der Sicht der Lebensweltorientierung nach Thiersch
- Medien und die Auswirkungen im Kontext der Schulbildung
- Handlungsorientierte Medienarbeit für eine gesellschaftliche Partizipation
- Soziale Arbeit in Zeiten der Digitalisierung
- Digitalisierung im Kontext Sozialer Arbeit und die
- Zeitverdrängungshypothese
- Inhaltshypothese
- Löschungshypothese
- Zusammenfassende Darstellung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die Mediensozialisation von Jugendlichen, indem sie Sozialisationsprozesse und die Wirkungsweise von Medien auf junge Menschen umfassend darstellt. Die Arbeit beleuchtet den Einfluss neuer Medien auf die Lebenswelten Jugendlicher und deren Auswirkungen auf die schulische Bildung. Die Begriffe Medien und Sozialisation werden definiert und in Beziehung zueinander gesetzt.
- Der Einfluss von Medien auf die Sozialisation Jugendlicher
- Die Auswirkungen neuer Medien auf die Lebenswelten Jugendlicher
- Die Rolle von Medien in der Identitätsbildung Jugendlicher
- Risiken und Chancen der Mediennutzung für Jugendliche
- Der Zusammenhang zwischen Mediennutzung und schulischer Leistung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Mediensozialisation von Jugendlichen ein und skizziert den Aufbau der Arbeit. Sie benennt die zentralen Forschungsfragen und erläutert die Herangehensweise an die Thematik. Die Arbeit verspricht eine umfassende Darstellung der Sozialisationsprozesse und der Wirkprinzipien von Medien im Kontext der jugendlichen Altersgruppe. Die Notwendigkeit einer geschichtlichen und begrifflichen Einordnung wird im Hinblick auf die Medienaneignung im Jugendalter hervorgehoben, um Generationenkontexte zu berücksichtigen.
Annäherung an die Begriffe Medien und Sozialisation: Dieses Kapitel widmet sich der Definition der zentralen Begriffe "Medien" und "Sozialisation". Es wird auf die unterschiedlichen Forschungswege in der Medien- und Sozialisationsforschung eingegangen, die erst seit etwa 2010 einen intensiveren Austausch pflegen. Die Kapitel erläutert die Notwendigkeit eines klar definierten Bezugsrahmens für die Betrachtung von Mediensozialisation, Medienwirkung und Mediennutzung im Kontext von Selbst- und Fremdsozialisation.
Medienwirkung vs. Mediensozialisation: Dieser Abschnitt differenziert zwischen Medienwirkung und Mediensozialisation. Es werden die unterschiedlichen Perspektiven und analytischen Ansätze zur Erforschung beider Phänomene dargestellt und gegeneinander abgegrenzt. Die komplexen Wechselwirkungen zwischen Medien und Sozialisationsprozessen werden beleuchtet.
Mediennutzung zwischen Selbst- und Fremdsozialisation: Dieses Kapitel analysiert die Mediennutzung Jugendlicher im Spannungsfeld zwischen Selbst- und Fremdsozialisation. Es untersucht, wie Jugendliche Medien zur Konstruktion ihrer Identität und zur Gestaltung ihrer sozialen Beziehungen nutzen, und wie diese Nutzung durch soziale Einflüsse und Erwartungen geprägt ist. Der Fokus liegt auf der aktiven Gestaltung der eigenen Identität durch Medien und den Einfluss der sozialen Umwelt auf diesen Prozess.
Zeitgeschichte und Generationen: Dieses Kapitel betrachtet den historischen Kontext der Medienentwicklung und deren Einfluss auf verschiedene Generationen. Es untersucht, wie sich die Medienlandschaft im Laufe der Zeit verändert hat und wie diese Veränderungen die Sozialisationsprozesse Jugendlicher beeinflusst haben. Der Fokus liegt auf der Analyse von Generationengestalten und dem Verständnis des spezifischen Verhältnisses von Generationen und Medien in verschiedenen Epochen.
Medienaneignung im Jugendalter: Das Kapitel befasst sich mit den verschiedenen Weisen, wie Jugendliche Medien im Jugendalter aneignen und in ihr Leben integrieren. Es analysiert die Prozesse der Medienaneignung, den Umgang mit neuen Medien und den Einfluss von Peers und Familie auf diesen Prozess. Es wird auf die aktive Gestaltung der eigenen Medienlandschaft durch die Jugendlichen eingegangen.
Neue Medien und die kommunikative Vernetzung Jugendlicher: Hier wird die zunehmende Vernetzung Jugendlicher durch neue Medien untersucht, sowie die daraus resultierenden Möglichkeiten und Herausforderungen in der Kommunikation. Der Fokus liegt auf der Analyse der kommunikativen Praktiken Jugendlicher im digitalen Raum und den Auswirkungen auf ihre sozialen Beziehungen.
Aufwachsen in digitalen Welten im Kontext verschiedener Internetdienste: Dieses Kapitel beleuchtet die Lebenswelten Jugendlicher im Kontext verschiedener Internetdienste. Es untersucht den Einfluss von Internetdiensten, der Internetsuche und sozialer Netzwerke auf die Entwicklung und Sozialisation Jugendlicher, sowie die Herausforderungen und Chancen, die sich durch die Nutzung dieser Dienste ergeben.
JIM - Jugend, Information, Medien Studie 2019 eine darstellende Zusammenfassung: Dieses Kapitel fasst die Ergebnisse der JIM-Studie 2019 zusammen und präsentiert relevante Daten zur Mediennutzung Jugendlicher. Die Ergebnisse werden im Kontext der vorherigen Kapitel analysiert und interpretiert. Die Studie liefert wichtige empirische Daten zur Mediensozialisation Jugendlicher.
Jugendliche Lebenswelten in der Mediengesellschaft und mediale Inszenierung: Dieses Kapitel beschreibt die Lebenswelten Jugendlicher in der heutigen Mediengesellschaft und beleuchtet den Einfluss von Medien auf die Selbstinszenierung und die Darstellung der eigenen Identität. Der Fokus liegt auf der Analyse der medialen Praktiken Jugendlicher und deren Auswirkungen auf das Selbstbild und die soziale Interaktion.
Risiken im Entwicklungsverlauf von Jugendlichen durch Medien: Hier werden die potenziellen Risiken der Mediennutzung für Jugendliche diskutiert. Es werden verschiedene Aspekte wie die Auflösung von Identitätsgrenzen, Konsum- und Anpassungsdruck, Verschiebungen von Selbst- und Weltbild sowie Probleme im Zeitmanagement behandelt. Die negativen Auswirkungen auf die Entwicklung Jugendlicher werden im Detail analysiert.
Chancen im Entwicklungsverlauf von Jugendlichen durch Medien mit kritischen Verweisen: Dieser Abschnitt beleuchtet die Chancen, die die Mediennutzung für Jugendliche bietet. Es werden positive Aspekte hervorgehoben und kritische Anmerkungen eingefügt, um ein ausgewogenes Bild zu zeichnen. Die positiven Auswirkungen der Mediennutzung werden im Kontext der zuvor beschriebenen Risiken diskutiert.
Problemauswirkungen aus der Sicht der Lebensweltorientierung nach Thiersch: Dieses Kapitel analysiert die Auswirkungen der Mediennutzung auf Jugendliche aus der Perspektive der Lebensweltorientierung nach Thiersch. Es betrachtet die Bedeutung von Lebenswelten für die Entwicklung Jugendlicher und untersucht, wie Medien diese Lebenswelten beeinflussen und verändern.
Medien und die Auswirkungen im Kontext der Schulbildung: Der Zusammenhang zwischen Mediennutzung und schulischen Leistungen wird in diesem Kapitel analysiert. Es wird untersucht, wie Medien die Lernprozesse Jugendlicher beeinflussen und welche Auswirkungen sie auf deren schulische Leistungen haben. Positive und negative Einflüsse werden gleichermaßen betrachtet.
Handlungsorientierte Medienarbeit für eine gesellschaftliche Partizipation: Das Kapitel befasst sich mit der Bedeutung handlungsorientierter Medienarbeit für die gesellschaftliche Partizipation Jugendlicher. Es wird untersucht, wie Medienkompetenz gefördert werden kann und wie Jugendliche durch Medienarbeit zu aktiver Teilnahme am gesellschaftlichen Leben befähigt werden können.
Soziale Arbeit in Zeiten der Digitalisierung: Dieser Abschnitt behandelt die Rolle der Sozialen Arbeit in Zeiten der Digitalisierung. Es wird die Bedeutung der Sozialen Arbeit im Umgang mit den Herausforderungen und Chancen der digitalen Welt für Jugendliche erörtert und Strategien zur Unterstützung Jugendlicher entwickelt.
Schlüsselwörter
Mediensozialisation, Jugendliche, Medienwirkung, neue Medien, mobile Medien, Digitalisierung, Identitätsbildung, Sozialisationsprozesse, Medienkompetenz, Soziale Arbeit, Schulbildung, Lebensweltorientierung, Generationen, JIM-Studie, soziale Ungleichheit, Ressourcenanalyse.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Mediensozialisation von Jugendlichen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Bachelorarbeit untersucht die Mediensozialisation von Jugendlichen. Sie analysiert umfassend die Sozialisationsprozesse und die Wirkungsweise von Medien auf junge Menschen, beleuchtet den Einfluss neuer Medien auf deren Lebenswelten und die Auswirkungen auf die schulische Bildung. Die Arbeit definiert die Begriffe Medien und Sozialisation und setzt sie zueinander in Beziehung.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Schwerpunkte: Der Einfluss von Medien auf die Sozialisation Jugendlicher, die Auswirkungen neuer Medien auf deren Lebenswelten, die Rolle von Medien in der Identitätsbildung, Risiken und Chancen der Mediennutzung, und der Zusammenhang zwischen Mediennutzung und schulischer Leistung. Dabei werden verschiedene Internetdienste, soziale Netzwerke und die JIM-Studie 2019 herangezogen.
Wie werden die Begriffe "Medien" und "Sozialisation" definiert?
Die Arbeit widmet sich der Definition der zentralen Begriffe "Medien" und "Sozialisation" und erläutert die unterschiedlichen Forschungswege in der Medien- und Sozialisationsforschung. Es wird die Notwendigkeit eines klar definierten Bezugsrahmens für die Betrachtung von Mediensozialisation, Medienwirkung und Mediennutzung im Kontext von Selbst- und Fremdsozialisation herausgestellt.
Wie unterscheidet die Arbeit zwischen Medienwirkung und Mediensozialisation?
Die Arbeit differenziert zwischen Medienwirkung und Mediensozialisation, indem sie die unterschiedlichen Perspektiven und analytischen Ansätze zur Erforschung beider Phänomene darstellt und gegeneinander abgrenzt. Die komplexen Wechselwirkungen zwischen Medien und Sozialisationsprozessen werden beleuchtet.
Wie wird die Mediennutzung Jugendlicher im Kontext von Selbst- und Fremdsozialisation betrachtet?
Die Arbeit analysiert die Mediennutzung Jugendlicher im Spannungsfeld zwischen Selbst- und Fremdsozialisation. Sie untersucht, wie Jugendliche Medien zur Konstruktion ihrer Identität und zur Gestaltung ihrer sozialen Beziehungen nutzen und wie diese Nutzung durch soziale Einflüsse und Erwartungen geprägt ist.
Welche Rolle spielt die Zeitgeschichte und die Betrachtung verschiedener Generationen?
Die Arbeit betrachtet den historischen Kontext der Medienentwicklung und deren Einfluss auf verschiedene Generationen. Sie untersucht, wie sich die Medienlandschaft im Laufe der Zeit verändert hat und wie diese Veränderungen die Sozialisationsprozesse Jugendlicher beeinflusst haben. Der Fokus liegt auf der Analyse von Generationengestalten und dem Verständnis des spezifischen Verhältnisses von Generationen und Medien in verschiedenen Epochen.
Wie werden die Prozesse der Medienaneignung im Jugendalter analysiert?
Die Arbeit befasst sich mit den verschiedenen Weisen, wie Jugendliche Medien im Jugendalter aneignen und in ihr Leben integrieren. Sie analysiert die Prozesse der Medienaneignung, den Umgang mit neuen Medien und den Einfluss von Peers und Familie auf diesen Prozess.
Welche Rolle spielen neue Medien und die kommunikative Vernetzung Jugendlicher?
Die Arbeit untersucht die zunehmende Vernetzung Jugendlicher durch neue Medien und die daraus resultierenden Möglichkeiten und Herausforderungen in der Kommunikation. Der Fokus liegt auf der Analyse der kommunikativen Praktiken Jugendlicher im digitalen Raum und den Auswirkungen auf ihre sozialen Beziehungen.
Wie werden die Ergebnisse der JIM-Studie 2019 in die Arbeit eingebunden?
Die Arbeit fasst die Ergebnisse der JIM-Studie 2019 zusammen und präsentiert relevante Daten zur Mediennutzung Jugendlicher. Die Ergebnisse werden im Kontext der vorherigen Kapitel analysiert und interpretiert.
Wie werden die Lebenswelten Jugendlicher in der Mediengesellschaft und die mediale Inszenierung beschrieben?
Die Arbeit beschreibt die Lebenswelten Jugendlicher in der heutigen Mediengesellschaft und beleuchtet den Einfluss von Medien auf die Selbstinszenierung und die Darstellung der eigenen Identität. Der Fokus liegt auf der Analyse der medialen Praktiken Jugendlicher und deren Auswirkungen auf das Selbstbild und die soziale Interaktion.
Welche Risiken und Chancen der Mediennutzung für Jugendliche werden diskutiert?
Die Arbeit diskutiert potenzielle Risiken der Mediennutzung (Auflösung von Identitätsgrenzen, Konsum- und Anpassungsdruck, Verschiebungen von Selbst- und Weltbild, Zeitmanagementprobleme) und beleuchtet gleichzeitig die Chancen der Mediennutzung. Positive und negative Aspekte werden ausgewogen dargestellt.
Wie wird die Perspektive der Lebensweltorientierung nach Thiersch berücksichtigt?
Die Arbeit analysiert die Auswirkungen der Mediennutzung auf Jugendliche aus der Perspektive der Lebensweltorientierung nach Thiersch. Sie betrachtet die Bedeutung von Lebenswelten für die Entwicklung Jugendlicher und untersucht, wie Medien diese Lebenswelten beeinflussen und verändern.
Welchen Zusammenhang untersucht die Arbeit zwischen Mediennutzung und Schulbildung?
Die Arbeit analysiert den Zusammenhang zwischen Mediennutzung und schulischen Leistungen. Sie untersucht, wie Medien die Lernprozesse Jugendlicher beeinflussen und welche Auswirkungen sie auf deren schulische Leistungen haben.
Welche Bedeutung hat handlungsorientierte Medienarbeit für die gesellschaftliche Partizipation?
Die Arbeit befasst sich mit der Bedeutung handlungsorientierter Medienarbeit für die gesellschaftliche Partizipation Jugendlicher. Sie untersucht, wie Medienkompetenz gefördert werden kann und wie Jugendliche durch Medienarbeit zu aktiver Teilnahme am gesellschaftlichen Leben befähigt werden können.
Welche Rolle spielt Soziale Arbeit in Zeiten der Digitalisierung?
Die Arbeit behandelt die Rolle der Sozialen Arbeit in Zeiten der Digitalisierung und erörtert die Bedeutung der Sozialen Arbeit im Umgang mit den Herausforderungen und Chancen der digitalen Welt für Jugendliche.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Mediensozialisation, Jugendliche, Medienwirkung, neue Medien, mobile Medien, Digitalisierung, Identitätsbildung, Sozialisationsprozesse, Medienkompetenz, Soziale Arbeit, Schulbildung, Lebensweltorientierung, Generationen, JIM-Studie, soziale Ungleichheit, Ressourcenanalyse.
Details
- Titel
- Mediensozialisation von Jugendlichen. Die Veränderungen der Lebenswelten von Jugendlichen durch neue Medien und deren Auswirkungen im Kontext der Schulbildung
- Hochschule
- Alice-Salomon Hochschule Berlin
- Note
- 2.0
- Autor
- Markus Richnow (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2020
- Seiten
- 46
- Katalognummer
- V960550
- ISBN (eBook)
- 9783346308054
- ISBN (Buch)
- 9783346308061
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- mediensozialisation jugendlichen veränderungen lebenswelten medien auswirkungen kontext schulbildung
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 19,99
- Preis (Book)
- US$ 28,99
- Arbeit zitieren
- Markus Richnow (Autor:in), 2020, Mediensozialisation von Jugendlichen. Die Veränderungen der Lebenswelten von Jugendlichen durch neue Medien und deren Auswirkungen im Kontext der Schulbildung, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/960550
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-