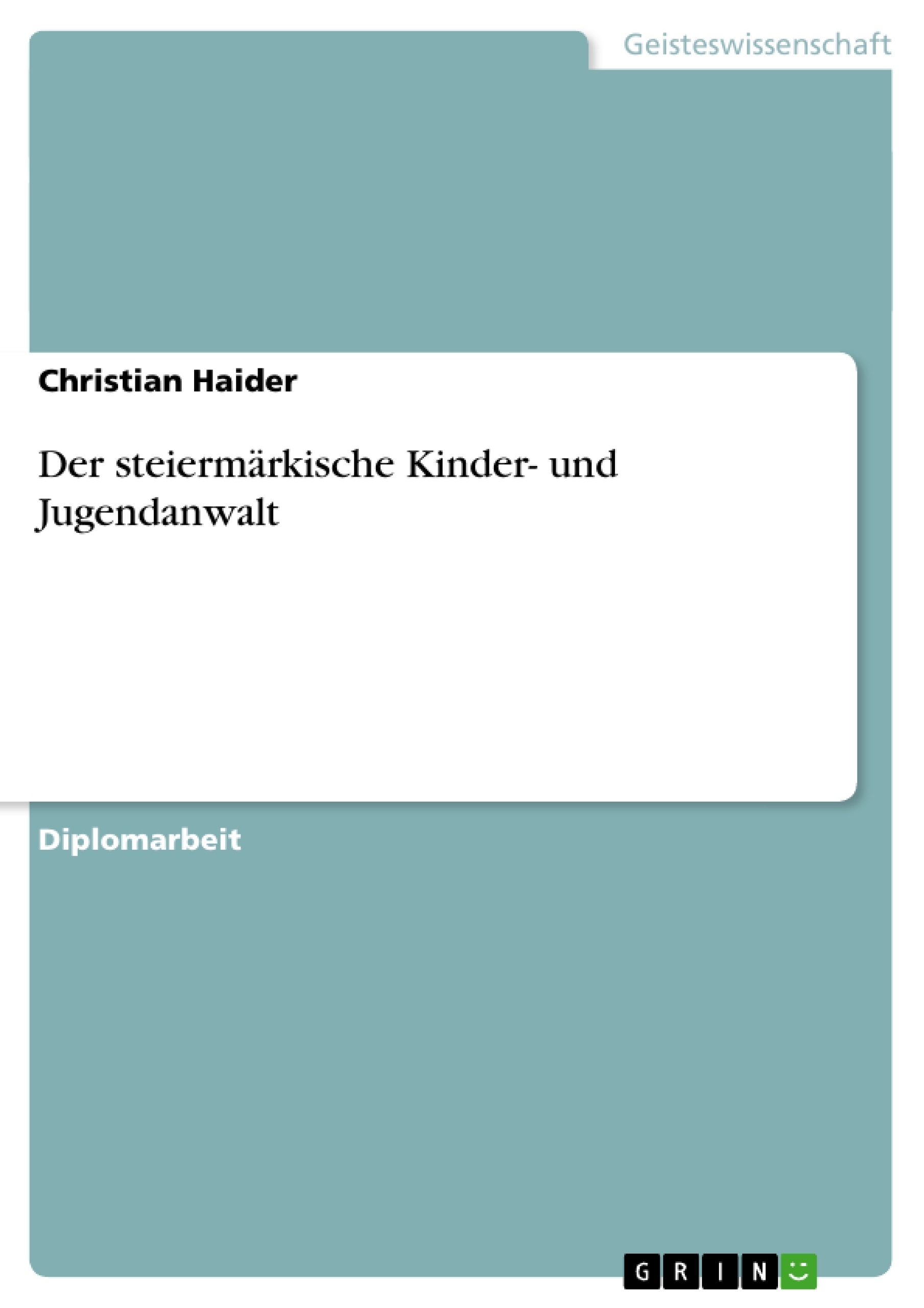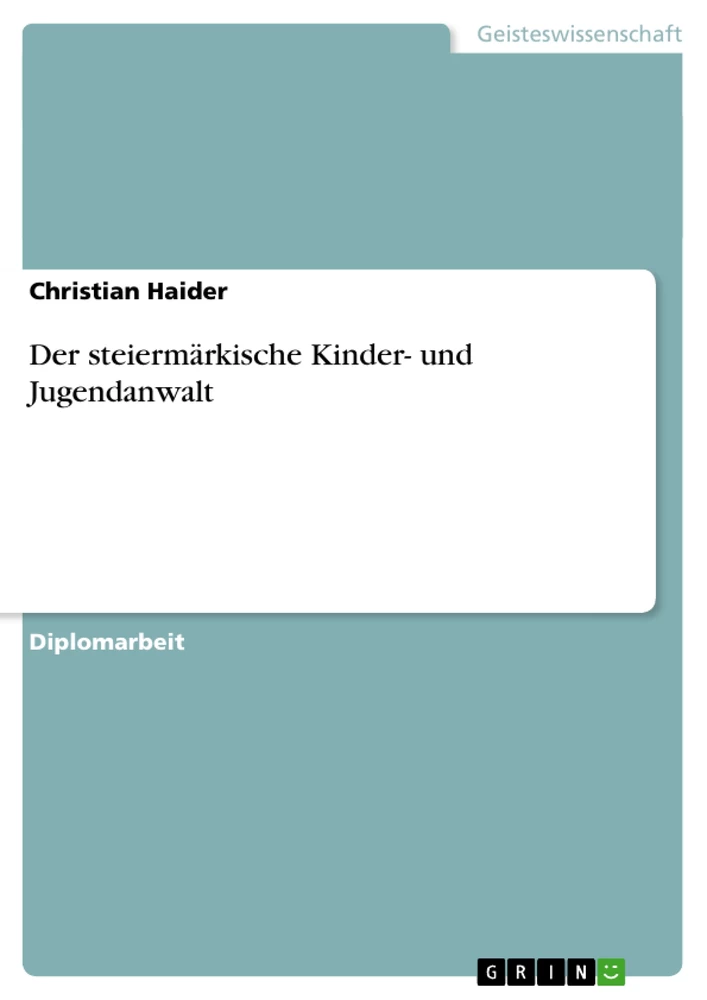
Der steiermärkische Kinder- und Jugendanwalt
Diplomarbeit, 1996
112 Seiten
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Erklärung:I
1. Einleitung
2. Die Entstehung der Forderung nach einer Kinder- und Jugendanwaltschaft
2.1. Die Stellung des Kindes in der Gesellschaft
2.2. Die Stellung des Kindes in der Rechtsordnung
2.2.1. Allgemein
2.2.2. Die UN-Konvention über die Rechte der Kinder
2.2.3. Das Kind im Jugendwohlfahrtsrecht
2.3. Modelle der Interessensvertretung für Kinder
2.3.1. Interessensvertretung im gesellschaftspolitischen Bereich
2.3.2. Interessensvertretung im Verfahren
2.3.3. Das „österreichische Modell“
3. Die Entwicklung des Steiermärkischen Jugendwohlfahrtsgesetzes mit besonderem Augenmerk auf den Kinder- und Jugendanwalt 33
3.1. Das Grundsatzgesetz des Bundes - JWG 1989
3.2. Das Steiermärkische Jugendwohlfahrtsgesetz
3.2.1. Novellen 1994
3.2.1.1. Zielsetzung der Novelle
3.2.2. Novelle 1995
4. Der Kinder- und Jugendanwalt im steiermärkischen Jugendwohlfahrtsgesetz 43
4.1. Die „Kinder- und Jugendanwaltschaft“ versus „Der Kinder und Jugendanwalt“
4.2. Der Jugendwohlfahrtsbeirat
4.3. Der steiermärkische Kinder- und Jugendanwalt
4.3.1. Ausgestaltung
4.3.1.1. Organisation
4.3.1.2. Bestellung, Amtsdauer und Abberufung
4.3.1.3. Ausstattung
4.3.1.4. Weisungsfreistellung
4.3.1.5. Leichter Zugang, Anonymität und Vertraulichkeit der Inanspruchnahme
4.3.1.6. Politische Kontrolle
4.3.2. Allgemeine Aufgaben
4.3.2.1. Rechte und Interessen von Kindern vertreten
4.3.2.2. Anregung zur Schaffung von besseren Lebensbedingungen für Kinder und Jugendliche
4.3.2.3. Öffentlichkeit informieren
4.3.2.4. Begutachtung von Gesetzen und sonstigen Rechtsvorschriften
4.3.2.5. Einbringung der Interessen von Kindern und Jugendlichen
4.3.2.6. Koordination verschiedener Aktivitäten
4.3.2.7. Mitarbeit in der Ständigen Konferenz der Kinder- und Jugendanwaltschaften Österreichs
4.3.3. Besondere Aufgaben
4.3.3.1. Beratung bezüglich der Stellung von Kindern und die Aufgaben der Erziehungsberechtigten
4.3.3.2. Hilfe bei Meinungsverschiedenheiten zwischen Kindern und Erziehungsberechtigten
4.3.3.3.Vermittlung bei Meinungsverschiedenheiten zwischen Erziehungsberechtigten oder Kindern und Jugendlichen einerseits und Behörden andererseits
4.3.3.4. Befassung von Organen des Jugendwohlfahrtsträgers
4.3.4. Das Recht auf Akteneinsicht
4.3.5. Auskunftspflicht der Organe des Landes und der Gemeinden
5. Erste Erfahrungen und politische Forderungen des steiermärkischen Kinder- und Jugendanwaltes
5.1. Erste Erfahrungen
5.2. Die Arbeitsschwerpunkte
5.3. Politische Forderungen des steiermärkischen Kinder- und Jugendanwaltes
5.3.1. Verbesserung der Personalausstattung
5.3.2. Parteistellung im Verwaltungsverfahren
5.3.3. Möglichkeit der Bescheidbeschwerde
5.3.4. Probleme im Bereich Weisungsgebundenheit - Weisungsfreistellung
5.3.5. Rechtsvertretung von Kindern im Gerichtsverfahren
6. Resümee
Literaturverzeichnis:
Erklärung:
Ich erkläre ehrenwörtlich, daß ich die vorliegende Arbeit selbständig und ohne fremde Hilfe verfaßt, andere als die angegebenen Quellen nicht benutzt und die den benutzen Quellen wörtlich oder inhaltlich entnommenen Stellen, als solche kenntlich gemacht habe.
Graz, im August
1. Einleitung
Die Idee zu dieser Arbeit entstand aus der Tatsache, daß der Steiermärkische Kinder- und Jugendanwalt 1995 seine Arbeit aufnahm, nachdem 1994 das Steiermärkische Jugendwohlfahrtsgesetz1 novelliert wurde. Dadurch war es möglich, eine Arbeit im Bereich des Jugendwohlfahrtsrechtes zu verfassen, und einen Bereich - für den der Verfasser als Sozialarbeiter besonderes Interesse hat, da das Jugendwohlfahrtsgesetz auch die Grundlage für seine berufliche Tätigkeit als Erziehungshelfer (§ 36 Abs 2 Z 7 StJWG) darstellt -, aus rechtlicher Sicht zu betrachten.
Bei der Auseinandersetzung mit der Thematik „Kinder- und Jugendanwalt“, wurde ersichtlich, daß unterschiedliche Bezeichnungen für gleiche Konzepte existieren und es daher vorkommen kann, daß zum Beispiel die Begriffe Kinder- und Jugendanwalt und Kinder- und Jugendbeauftragter sowie Kinder- und Jugendanwalt und Kinder- und Jugendanwaltschaft synonym verwendet werden.
Der Begriff Kinder- und Jugendbeauftragter wird eher in Deutschland verwendet und bezeichnet Personen oder sogar Behörden, die auf kommunaler Ebene, im Rahmen der Verwaltung, die Rechte und Interessen von Kindern vertreten sollen.2 Die Aufgaben dieser Kinder- und Jugendbeauftragten sind im wesentlichen die eines Ombudsmanns. Daher können die Begriffe Kinder- und Jugendanwalt und Kinder- und Jugendbeauftragter synonym verwendet werden, soweit unter dem Begriff Kinder- und Jugendanwalt ein Ombudsmann für Kinder, der im gesellschaftspolitischen Bereich eine Lobbyfunktion für Kinder ausübt, gemeint ist. Kinderanwalt nennen sich in Deutschland Kinderbeauftragte, die bei freien Trägern der Wohlfahrtspflege eingesetzt werden, die sich, analog zu den Kinderbeauftragten innerhalb der Verwaltung, als parteiliche Vertreter der Interessen des Kindes verstehen. Die Vertretung von Kindesinteressen im Verfahren, die in Österreich in Ansätzen ebenfalls geregelt ist, wird wiederum unter dem Begriff „Anwalt des Kindes“ in der Literatur verwendet.3 Seit 1989 findet sich im österreichischen Recht der Begriff „Kinder- und Jugendanwalt“. Die erstmalige Verwendung dieses Begriffes im Bundesgrundsatzgesetz JWG 19894, das die Jugendwohlfahrtsträger zur Beratung von Minderjährigen und deren Erziehungsberechtigten berief, war Ausgangspunkt für die Entwicklung von Regelungen in den Ausführungsgesetzen der Bundesländer, die sich an den Forderungen der Kinderrechtsbewegung orientierten und den Kinder- und Jugendanwälten wesentlich mehr Aufgaben und Befugnisse brachten, als dies im Grundsatzgesetz vorgesehen ist.
Dabei gibt es in den einzelnen Landesgesetzen Unterschiede in der Terminologie. So wird in Wien, Burgenland, Vorarlberg, Kärnten und Tirol die Bezeichnung Kinder- und Jugendanwalt, in Salzburg, Niederösterreich und Oberösterreich der Begriff Kinder- und Jugendanwaltschaft verwendet, wobei in diesen Bundesländern der Leiter/die Leiterin als Kinder- und Jugendanwalt/Kinder- und Jugendanwältin bezeichnet wird. Aus der Bezeichnung allein kann aber nicht auf die Aufgaben geschlossen werden, obwohl der Begriff Kinder- und Jugendanwaltschaft eher auf Institutionalisierung als Amt hindeutet, während der Begriff Kinder- und Jugendanwalt auf eine, von der Verwaltung unabhängigen Stellung hinweist. In der Steiermark werden beide Begriffe verwendet, wobei die Regelung über die Kinder- und Jugendanwaltschaft an die Jugendwohlfahrtsträger gerichtet ist ( § 13 StJWG). Mit der Regelung des Kinder- und Jugendanwaltes (§§ 13a, 13b StJWG) wurde eine Einrichtung geschaffen, die mit den Kinder- und Jugendanwälten und Kinder- und Jugendanwaltschaften der anderen Bundesländer vergleichbar ist.
In dieser Arbeit wird versucht, die Entwicklung im gesellschaftspolitischen Bereich, die zur Einrichtung einer institutionalisierten Vertretung der Interessen von Kindern und Jugendlichen in Österreich führte, darzustellen.
Daher werden einzelne Modelle der Interessensvertretung von Kindern und Jugendlichen vorgestellt. Weiters sollen die UN-Konvention über die Rechte der Kinder, die auch Österreich unterzeichnet hat und die eine Entwicklung der Sichtweise von Kindheit darstellt, ebenso die Stellung des Kindes in der Rechtsordnung, als maßgebliche, die Einrichtung der Kinder- und Jugendanwaltschaften beeinflussende Faktoren aufgezeigt werden. Es soll daher der Versuch unternommen werden, grundlegende Sichtweisen des Kindes in der Rechtsordnung aufzuzeigen, und vor allem die Veränderungstendenzen der letzten Jahre im Überblick darzustellen, eine wirklich umfassende Behandlung der Stellung des Kindes in der Rechtsordnung würde aber den Rahmen dieser Arbeit sprengen.
Die Entwicklung des Jugendwohlfahrtsgesetzes vom Bundesgesetz bis zur Novelle des steiermärkischen Jugendwohlfahrtsgesetzes 1994, die erst die maßgeblichen Bestimmungen für den Kinder- und Jugendanwalt/die Kinder- und Jugendanwältin brachte5 und die konkrete Ausgestaltung der steiermärkischen Bestimmungen, sowie die ersten Erfahrungen und politischen Forderungen des Kinder- und Jugendanwaltes stellen den Hauptteil dieser Arbeit dar. Dabei sollen auch die Regelungen in anderen Bundesländern im Vergleich eingebracht werden, wobei vor allem die Unterschiede zu den steiermärkischen Bestimmungen ausgearbeitet werden sollen. Ein umfassender Vergleich aller einschlägigen Regelungen in allen Bundesländern ist nicht beabsichtigt und wurde außerdem bereits von Roth vorgenommen.6
2. Die Entstehung der Forderung nach einer Kinder- und Jugendanwaltschaft
2.1. Die Stellung des Kindes in der Gesellschaft
Kinder werden als eigene Kategorie der Bevölkerung oft nicht wahrgenommen. Sie haben keine Teilhabe an zentralen Bereichen der Gesellschaft, wie Z B. der Politik. Die Interessen der Kinder werden bei Stadtplanung, im Bereich der elterlichen Arbeitsbedingungen, etc. vielfach ignoriert.
„Kinder wurden in der Vergangenheit vorwiegend von Seiten der Psychologie, Pädagogik und der Sozialisationsforschung betrachtet und dabei vor allem als „Werdende“, als „zu Entwickelnde“, als „zukünftige Erwachsene“ definiert. Man sah in ihnen kaum die hier und jetzt so „Seienden“, die als Kinder vollwertige Mitglieder der Gesellschaft darstellen.“7
Erst in den letzten ein- bis zwei Jahrzehnten fand „Kindheit“ auch in der soziologischen Forschung ihren Platz.8
Kindheit, als soziale Konstruktion wird von verschiedenen Forschern meist durch einen zentralen Faktor charakterisiert:
So sieht Aries den Zustand Kindheit gekennzeichnet durch „Herausgerissensein aus der Erwachsenengesellschaft“ und den „Entzug von Freiheit.“9
Postman wiederum meint, daß durch die modernen Medien die Kindheit wieder zum Verschwinden gebracht wurde, da der Unterschied zwischen Kindern und Erwachsenen nivelliert wird, weil Kinder mit Hilfe des Fernsehens und der dabei verwendeten Bildersprache der Zugang zum Wissen und Geheimwissen der Erwachsenen tagtäglich ermöglicht wird.10 Einige Autoren sehen in der Institutionalisierung der Kindheit durch die Erziehungs- und Bildungseinrichtungen das sie kennzeichnende Merkmal. Andere halten den Gebrauch der Massenmedien, vor allem das Fernsehen, für einen die Kindheit prägenden Faktor.11
Demographisch ist die heutige Kindheit in der industrialisierten Welt durch einen ständig sinkenden Anteil der Kinder an der Gesamtbevölkerung gekennzeichnet (der Anteil der Kinder an der Gesamtbevölkerung betrug 1951 22,9%, 1981 17,9%, 1991 17,5%); auch die Zahl der Kinder insgesamt geht in den Industriestaaten zurück. Gleichzeitig stieg die Scheidungsrate und damit die Zahl der alleinerziehenden Mütter. Das wiederum hat Auswirkungen auf die Verteilungsgerechtigkeit, da ein relativ großer Teil sogenannter Eineltern-Familien an der Armutsgrenze lebt.
Da Kindheit aus soziologischer Sicht eine soziale Konstruktion der Gesellschaft ist, nimmt Wilk an, daß charakteristische Merkmale dieser Konstruktion in der Rechtsordnung der Gesellschaft zum Ausdruck kommen und gewinnt aus der soziologischen Betrachtung der rechtlichen Stellung des Kindes den Eindruck, daß diese von folgenden Orientierungen bestimmt ist:
„1. Der Schutz des Kindes erhält mehr Gewicht als seine Autonomie, und dem aus der Schutzbedürftigkeit des Kindes abgeleiteten Ausschluß des Kindes von verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen wird mehr Raum gegeben als seiner Partizipation. (...)
2. Das „Wohl des Kindes“, das eine zentrale Orientierung für die rechtliche Situation des Kindes darstellt, ist äußerst unbestimmt, seine Orientierung ist vorwiegend eine erwachsenenorientierte. (...)
3. Die Rechtsstellung des Kindes ist durch eine ausgeprägte Familialisierung und Paternalisierung gekennzeichnet.“12
Wilk ist der Ansicht, das die Betonung des Rechtes des Kindes auf Schutz zwangsläufig dessen Recht auf Autonomie und Freiheit einschränkt, räumt aber ein, daß das Kind in zunehmendem Maß auch als realitätsgestaltendes, eigenständiges Subjekt gesehen wird, was auch in der UN - Konvention über die Rechte des Kindes zum Ausdruck kommt. Das Kindeswohl wiederum wird von den Erwachsenen für das Kind und nicht durch das Kind selbst bestimmt, wobei die Frage aufgeworfen wird, ob sich Erwachsene überhaupt in die Perspektive von Kindern zu versetzen in der Lage sind und ob dies überhaupt intendiert ist. Weiters ist die Verantwortung für Kinder gesetzlich weitgehend deren Eltern übertragen, was immer dann problematisch wird, wenn die Interessen der Kinder mit denen der Eltern kollidieren.
Wintersberger spricht bei der Betrachtung der Stellung des Kindes in der Gesellschaft sogar von einer „strukturellen Rücksichtslosigkeit der Gesellschaft gegenüber Kindern“13, da Kinder unter anderem ein weit höheres Armutsrisiko als Erwachsene haben und ihre Stellung sowohl in öffentlichen Institutionen (wie Schule und Kindergarten) als auch in der Familie nach wie vor von den traditionellen Formen eines ungebrochenen Paternalismus gekennzeichnet ist.
Das höhere Armutsrisiko von Kindern entsteht dadurch, daß die Verfügbarkeit von Ressourcen in Haushalten mit mehreren Kindern von vornherein begrenzter als in anderen Haushalten ist. Die Lern-Arbeit von Schulkindern stellt keinen produktiven Beitrag zur Hauswirtschaft dar, sondern wird vielmehr als kostenverursachender Faktor gesehen. Ein konstantes Haushaltseinkommen durch eine größere Zahl von Köpfen dividiert, führt zu einem Sinken des Pro-Kopf-Einkommens. Staatliche Transferleistungen können das nicht wettmachen. Außerdem sind Kinder von der Verfügung über das Familieneinkommen weitgehend ausgeschlossen.14 Wintersberger kommt zu folgender pointiert formulierter Schlußfolgerung:
„Einerseits werden Kinder mit Erwartungen und Verpflichtungen konfrontiert, die nicht allzu verschieden von jenen der Erwachsenen sind; auf der anderen Seite werden ihnen nicht die entsprechenden Rechte zugestanden. So leben Kinder heute, soweit es ihre Verantwortung betrifft, mit einem Fuß schon im 21. Jahrhundert; was hingegen ihre Rechte anbelangt, leben sie noch im Zeitalter des Feudalismus.“15
2.2. Die Stellung des Kindes in der Rechtsordnung
Wenn über die Stellung des Kindes in der Rechtsordnung etwas ausgesagt werden soll, muß vorerst geklärt werden, was unter dem Begriff „Kind“ zu verstehen ist. Das ABGB differenziert in § 21 zwischen Kindern, womit Kinder, die das siebente Lebensjahr noch nicht vollendet haben bezeichnet werden, unmündigen Minderjährigen, die das vierzehnte und mündigen Minderjährigen, die das neunzehnte Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Im Strafrecht wiederum wird von Unmündigen (Kindern unter 14 Jahren) gesprochen, welche vollkommen schuldunfähig sind (§ 4 Abs 1 JGG) und von Jugendlichen (14 - 19 Jahre), die bereits schuldfähig, außer im Fall der verzögerten Reife, sind. Art 1 der UN-Konvention über die Rechte der Kinder (KRK) legt fest, daß jeder Mensch, der das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, Kind ist.
In dieser Arbeit sollen mit dem Begriff „Kind“ alle Minderjährigen bis zur Vollendung des neunzehnten Lebensjahres erfaßt werden, da es ja um die Kinder- und Jugendanwaltschaften geht, deren Zielgruppe alle Kinder und Jugendlichen bis zur Volljährigkeit sind.
2.2.1. Allgemein
Die Position von Kindern in der Gesellschaft bestimmt indirekt auch die Stellung des Kindes in der Rechtsordnung, da das Recht die grundlegende und umfassende normative Institution einer Gesellschaft ist.16 Man kann davon ausgehen, daß hinter allen Bestimmungen, die Kinder berühren, eine bestimmte Vorstellung von Kindheit steckt. Kinder werden vor allem als arm, schwach und hilfsbedürftig gesehen, deren Wohl zu schützen ist. Im ABGB beispielsweise findet sich keine einzige Bestimmung, die vom Recht eines Kindes spricht, es ist stets nur von Verpflichtungen der Eltern oder sonstiger Erwachsener die Rede. Das Kind wird mehr als Objekt, denn als Subjekt gesehen.
„Die Krönung dieser Entwicklung in der Praxis sind Verfahren, in denen der weitere Verbleib eines Kindes entschieden werden soll, wo eine Fülle von wohlgesinnten Richtern, Gutachtern und Sozialarbeitern über das Wohl eines Kindes diskutieren, niemand es aber selbst dazu befragt hat.“17
Ein zentraler Begriff, wenn es um die Interessen von Kindern geht und die Berechtigung des Staates, in die Rechte und Pflichten der Eltern einzugreifen, ist im Zivilrecht das Kindeswohl. Dieses wird für das einzelne Kind aber stets von Erwachsenen definiert. Grundsätzlich kommt ja den Eltern die Obsorge zu. Der Staat muß dann eingreifen, wenn das Wohl des minderjährigen Kindes gefährdet ist (§§176ff ABGB).
Der Begriff „Kindeswohl“ ist sehr vage und wird immer nur im Einzelfall konkret beurteilt, wobei laut § 178a ABGB die Persönlichkeit des Kindes und seine Bedürfnisse, besonders seine Anlagen, Fähigkeiten, Neigungen und Entwicklungsmöglichkeiten sowie die Lebensverhältnisse der Eltern entsprechend zu berücksichtigen sind. Unter Berücksichtigung der Vorgaben des §178a ABGB wird dann im Einzelfall versucht, das objektive Interesse des Kindes, d.h. jenes Interesse, welches bei vernünftiger Betrachtung langfristig seinem Wohle dient, zu ermitteln.18
„Die Generalklausel „Kindeswohl“ bietet aber dennoch die Möglichkeit, die jeweils herrschenden gesellschaftlichen Auffassungen des Kindeswohles sowie die unterschiedlichen Anschauungen über elterliche Erziehungsziele in die Entscheidung aufzunehmen und der Einzelfallgerechtigkeit näherzukommen.“19
Die Stellung des Kindes im Strafrecht ist unter zwei Gesichtspunkten zu betrachten, einerseits wie und ab wann auf deliktisches Verhalten von Kindern reagiert wird und andererseits welche Regelungen es gibt, die auf das besondere Schutzbedürfnis von Kindern abgestimmt sind. Wie schon erwähnt, ist mit der Vollendung des vierzehnten Lebensjahres die Strafmündigkeit erreicht. Jüngere sind gemäß § 4 Abs 1 JGG nicht strafbar. Für schon strafmündige Jugendliche, die Straftaten begehen, gibt es im Strafrecht etliche Besonderheiten, wie zum Beispiel, daß die Anwendung des Jugendstrafrechts nur Spezialprävention als Ziel hat (§ 5 Z 1 JGG), oder daß es bei Tatbegehung bis zur Vollendung des 20. Lebensjahres keine lebenslange Freiheitsstrafe gibt (§ 36 StGB iVm § 5 Z 2 lit a). Auch gibt es besondere Verfahrensbestimmungen wie zum Beispiel die Bestimmung des § 39 Abs 3 JGG, die festlegt, daß ein von einem Gerichtshof erster Instanz oder von einem Geschworenengericht gefälltes Urteil, mit dem ein Jugendlicher schuldig gesprochen wird, nichtig ist, wenn nicht während der ganzen Hauptverhandlung ein Verteidiger des Jugendlichen anwesend war. Es gibt einige Delikte, welche die besondere Schutzbedürftigkeit von Kindern im Visier haben, wie das Quälen und Vernachlässigen, oder das Überanstrengen unmündiger, jüngerer oder wehrloser Personen (§§ 92,93 StGB), oder das Verlassen eines Unmündigen (§197 StGB) und im Sexualstrafrecht Beischlaf mit Unmündigen, Unzucht mit Unmündigen und pornographische Darstellungen mit Unmündigen (§§ 206, 207, 207a StGB). Auch der sogenannte Homosexuellen-Paragraph, der in letzter Zeit wieder in der Öffentlichkeit diskutiert wird, § 209 StGB, der die Strafbarkeit männlicher Homosexualität festlegt, wenn der Täter das 19. Lebensjahr vollendet hat und sein Partner ein Jugendlicher über 14 und unter 18 Jahren ist, geht von besonderer Schutzbedürftigkeit männlicher Jugendlicher in diesem Alter aus. Im Verwaltungsrecht sind es einerseits die Jugendwohlfahrtsgesetze, die Regelungen beinhalten, die Kinder und Jugendliche betreffen und die Jugendschutzgesetze, deren Zweck wie folgt definiert wird:
„Die JugendschutzG enthalten Vorschriften, die dazu dienen, Kinder und Jugendliche gegen für sie besonders nachteilige Gefährdungen (insb sittlicher und gesundheitlicher Art) zu schützen (Vgl. § 1 der meisten LG).“20
Die von den Jugendschutzgesetzen geschützten Personen sind solche, die im allgemeinen das Alter von 18 Jahren noch nicht erreicht haben (Ausnahme: Tirol, 17 Jahre).
Zusammenfassend ist festzuhalten, daß bei den unterschiedlichsten Regelungen, die Kinder und Jugendliche betreffen, meist das Kindeswohl, das geschützt werden muß, Ausgangspunkt und Maßstab für rechtliche Normen ist.
2.2.2. Die UN-Konvention über die Rechte der Kinder
Der heute erreichte Stand der in internationalen Regelungswerken umschriebenen Kinderrechte geht auf die Erkenntnisse der besonderen Verletzlichkeit und damit Schutzbedürftigkeit von Kindern zurück. Die UN- Konvention über die Rechte der Kinder ist der Versuch, ein multilaterales, völkerrechtliches Vertragswerk zu schaffen, das eine möglichst geschlossene und umfassend angelegte Grundlegung der Rechte des Kindes beinhalten sollte.21
Die UN-Konvention über die Rechte der Kinder (KRK) wurde am 20.11.1989 von der Generalversammlung im Rahmen der Resolution Nr. 44/25 angenommen. Die Vorarbeiten dazu dauerten über zehn Jahre und begannen nach der Ausrufung des „Internationalen Jahres des Kindes 1979“ aufgrund einer Initiative von Polen.22
Bis zur KRK wurde das Kind in den einschlägigen internationalen Regelungen hauptsächlich als Schutzobjekt gesehen.
„Der angesprochene Schutz besteht dabei im wesentlichen aus zwei Dimensionen: Einerseits der Dimension (Gefahren-)Abwehr, andererseits der Dimension Fürsorge. Erheblich geringeres Gewicht hat in der historischen Dimension der Ansatz, das Kind in internationalen Rechtsgrundlagen als Rechtssubjekt - also als eigentlichen Rechtsträger - anzusehen.“23
Die UN-Konvention über die Rechte der Kinder stellt einen Schritt in der Rechtsentwicklung dar, da hier erstmals vom Recht des Kindes die Rede ist und somit Kinder erstmals auf einer breiten völkerrechtlich verbindlichen Basis als eigenständige Grundrechtsträger angesprochen werden.
„Erstmals sind wir mit einem neuen Kinderbild konfrontiert; dem grundsätzlich gleichberechtigten Subjekt Kind, dem ebensoviel Achtung und Respekt seiner Menschenwürde gebührt, die wir Erwachsene für uns erwarten.“24
Österreich unterzeichnete die Konvention am 26. Jänner 1990 (Vgl.. nunmehr BGBl 7/1993). Der Nationalrat hat anläßlich der Genehmigung der KRK beschlossen, daß der Staatsvertrag im Sinne von Art 50 Abs 2 B-VG durch Erlassung von Gesetzen zu erfüllen ist (Erfüllungsvorbehalt).
„Mangels unmittelbarer innerstaatlicher Anwendbarkeit ihrer Regelungen kann die Konvention als völkerrechtlicher Vertrag derzeit in Österreich keinen neuen rechtlichen Status des Kindes bewirken.“25
Kind im Sinne der KRK ist gemäß Art 1 jeder Mensch, der das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat. Das Kindeswohl ist auch in der KRK ein vorrangig zu berücksichtigender Gesichtspunkt, sowohl in bezug auf Kinder zu treffende Entscheidungen (Art 3), als auch als Grundlage des erzieherischen Verhaltens der Eltern (Art 18). Die KRK umfaßt einen umfassenden Katalog von Grundrechten, wie zum Beispiel die Rechte jedes Kindes auf Leben, auf familiäre Beziehungen, auf Anhörung und freie Meinungsäußerung, auf Gedanken-. Gewissens- und Religionsfreiheit, auf angemessenen Lebensstandard, auf Bildung,
Besonders umstritten waren bei der Erstellung des Konventionstextes vor allem folgende Bereiche:
a) die Frage der Rechtsposition und des Schutzes ungeborenen Lebens
b) der Bereich der Betreuung von Kindern im Rahmen einer Pflegefamilie und der Adoption
c) das Recht auf Religionsfreiheit
d) die Altersgrenze hinsichtlich der Teilnahme von Kindern an bewaffneten Konflikten26
Vor der KRK gab es allerdings auch schon eine ganze Reihe völkerrechtlicher Verträge mit unterschiedlichem Verbindlichkeitsgrad, unterschiedlichem räumlichen Geltungsbereich und unterschiedlicher Zielsetzung, die sich auf Teilaspekte des Schutzes und der Rechtsposition von Kindern beziehen (insgesamt etwa 80 verschiedene thematisch einschlägige Rechtsgrundlagen).27 Auch Österreich ist bereits vor der Unterzeichnung der KRK Vertragspartner etlicher multilateraler Übereinkommen dieser Art gewesen.28
Die KRK übernahm zahlreiche Bestimmungen, die sich bereits auf Vertragswerke, die vor der Konvention entstanden sind, zurückführen lassen. Dennoch liegt gerade in der Zusammenfassung einer großen Zahl bereits existierender Bestimmungen eine zentrale Funktion der KRK. Die KRK beschreitet aber auch durch Schaffung verschiedener neuer Rechte neue Wege (ZB. Recht auf Identität (Art 8), Subsidiarität der internationalen Adoption (Art 21)).
Die KRK faßt sowohl die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen, als auch die bürgerlichen und politischen Rechte in einem Katalog zusammen, wobei das Prinzip der Anerkennung des Kindes als selbständige Rechtspersönlichkeit in allen Lebensbereichen als wesentliches Merkmal dieser Konvention angesehen werden kann.29
2.2.3. Das Kind im Jugendwohlfahrtsrecht
Das Jugendwohlfahrtsrecht ist einerseits im ABGB (§§ 211ff) und in den Jugendwohlfahrtsgesetzen geregelt (Grundsatzgesetz - Bund; Ausführungsgesetze - Länder).
Gemäß § 1 Abs 1 Z 2 JWG (ebenso § 1 Abs 1 Z 2 StJWG) ist es eine Aufgabe der öffentlichen Jugendwohlfahrt, durch Anbot von Hilfen zur Pflege und Erziehung, die Entwicklung Minderjähriger zu fördern und durch Gewährung von Erziehungsmaßnahmen zu sichern. Das zweite Hauptstück sieht die für die Erfüllung dieser Aufgaben notwendigen Leistungen vor; nämlich Soziale Dienste, das Pflegekinderwesen, Heime und sonstige Einrichtungen für Minderjährige, Vermittlung der Annahme an Kindes statt und Hilfen zur Erziehung. In Verbindung mit der allgemeinen Maxime die Familie bei der Erfüllung ihrer Aufgaben in der Pflege und Erziehung zu unterstützen, kommt die Sichtweise der Jugendwohlfahrt als integrierte Familienhilfe zum Ausdruck.
„Neben der rechtlichen Betreuung sind auch die Beratungsbedürfnisse psychologischer, psychiatrischer, fürsorgerischer und medizinischer Art (...) zu erfüllen. Diese Beratung besteht nach dem gegenwärtigen Stand der Sozialarbeit in einer Analyse des angeschnittenen Problems, in der Unterrichtung der Betroffenen über die zur Verfügung stehenden Lösungsmöglichkeiten und in der Unterstützung und Hilfe zur Verwirklichung der getroffenen Entscheidung einschließlich der Festigung einer notwendigen Verhaltensänderung“30 Grundsätzliches zur Stellung des Kindes im Jugendwohlfahrtsrecht besagt § 2 JWG, der das Verhältnis Familie - öffentliche Jugendwohlfahrt regelt und festlegt, unter welchen Bedingungen die öffentliche Jugendwohlfahrt jedenfalls zu gewähren ist:
§ 2 JWG 1989:
(1) Der öffentlichen Jugendwohlfahrt kommt die allgemeine Aufgabe zu, die Familie bei der Erfüllung ihrer Aufgaben in der Pflege und Erziehung Minderjähriger zu beraten und zu unterstützen.
(2) Öffentliche Jugendwohlfahrt ist zu gewähren, wenn und soweit die Erziehungsberechtigten des Wohl des Minderjährigen nicht gewährleisten.
(3) Die öffentliche Jugendwohlfahrt darf in familiäre Bereiche und Beziehungen nur insoweit eingreifen, als dies zum Wohl des Minderjährigen notwendig ist. Dies ist besonders auch dann der Fall, wenn zur Durchsetzung von Erziehungszielen Gewalt angewendet oder körperliches oder seelisches Leid zugefügt wird.
Der Kommentar zum JWG sagt hierzu, daß die Familienbezogenheit der öffentlichen Jugendwohlfahrt bedeutet, daß diese kein absolutes Erziehungsziel für den Minderjährigen verfolgen darf. Vielmehr ist im konkreten Einzelfall das Wohl des Minderjährigen durch Stärkung der Erziehungskraft der Familie zu fördern.31
Auch im Jugendwohlfahrtsrecht nimmt das Kindeswohl die zentrale Stellung ein, einerseits als Legitimation einzugreifen, wenn es durch die Erziehungsberechtigten nicht mehr gewährleistet wird (§ 2 Abs 2 JWG) und andererseits als Grenze eben dieses Eingriffs (§ 2 Abs 3 JWG). Das Wohl des Kindes ist besonders dann gefährdet, wenn die Erziehungsberechtigten ihre im Familienrecht festgelegten Pflichten (besonders §§ 144ff ABGB) nicht erfüllen. Im § 2 Abs 3 JWG wird im Besonderen darauf hingewiesen, daß Gewaltanwendung und die Zufügung körperlichen oder seelischen Leids zum Eingreifen der öffentlichen Jugendwohlfahrt verpflichten. Die Formulierung des § 2 Abs 2 ist so gewählt, daß öffentliche Jugendwohlfahrt unabhängig vom Verschulden des Erziehungsberechtigten zu gewähren ist. Lediglich die objektive Gefährdung des Wohls des Minderjährigen ist ausschlaggebend. Gegen den Willen der Erziehungsberechtigten darf die öffentliche Jugendwohlfahrt entweder auf Grund einer gerichtlichen Entscheidung (§ 215 Abs 1 1.Satz ABGB) oder bei Gefahr im Verzug (§ 215 Abs 1 2.Satz ABGB) einschreiten. Auch im StJWG findet sich die Bestimmung des § 2 JWG, nämlich der erste Absatz in § 1 Abs 2 StJWG und der zweite und dritte Absatz in § 2 StJWG. Die Ausführungen zu § 2 JWG gelten sinngemäß.
In den Erläuterungen zur Regierungsvorlage findet sich zu § 1 Abs 2 StJWG der Hinweis, daß das Kindeswohl nicht isoliert betrachtet, sondern daß die Familie als Bezugsfeld angesehen werden soll.32 Es wird hier also ausdrücklich darauf hingewiesen, daß das Kindeswohl immer im konkreten Einzelfall unter Berücksichtigung der jeweiligen Familiensituation definiert werden muß und die öffentliche Jugendwohlfahrt daher keine absoluten Erziehungsziele verfolgen darf.
Weitere Regelungen, welche die Rechtsstellung des Kindes unmittelbar betreffen, sind in § 16 JWG (Pflegebewilligung) und § 29 JWG (freiwillige Erziehungshilfen) zu finden. Beide Regelungen betreffen die Stellung des Kindes im Verfahren und legen fest, daß das mindestens zehnjährige Kind persönlich, das noch nicht zehnjährige Kind tunlichst, in geeigneter Weise zu hören ist.
Zusammenfassend kann gesagt werden, daß sich die öffentliche Jugendwohlfahrt einerseits als „Familienberatungsstelle“ sieht, die Beratung und Hilfe anbietet, andererseits aber auch als Wächter über das Kindeswohl, der eingreift, wenn das Kindeswohl nicht mehr gewährleistet ist. Das Kind hat bei gerichtlichen Entscheidungen über die Pflege und Erziehung ein Anhörungsrecht (§ 178b ABGB), welches bei Entscheidungen nach den §§ 145, 145b, 147, 148, 154(2), 167, 176, 176a, 177, 178, 186a ABGB und bei allen vormundschaftsgerichtlichen Pflege- oder Erziehungsentscheidungen zu beachten ist.33
2.3. Modelle der Interessensvertretung für Kinder
Aufgrund der Stellung des Kindes in der Gesellschaft und in der Rechtsordnung, wurden seit dem Ende der siebziger Jahre Modelle für eine wirksame Vertretung der Interessen von Kindern in Fachkreisen diskutiert. Die verschiedenen Modelle der Interessensvertretung für Kinder lassen sich nach deren Zielrichtung unterscheiden, nämlich in Interessensvertretung im gesellschaftspolitischen Bereich und Interessensvertretung im Verfahren. Es soll hier auch auf Diskussionen in Österreich eingegangen werden, die, nachdem das JWG 1989 in Kraft trat, geführt wurden. Die Regelung im Grundsatzgesetz wurde mehrheitlich als unzureichend angesehen. Dieser Ansicht folgten dann auch die Landesgesetzgeber, was zu Regelungen führte, die den Kinder- und Jugendanwälten in den Bundesländern weit mehr Aufgaben zukommen ließen als der Text des Grundsatzgesetzes vermuten läßt (Vgl.. 3.1.).
Allen Modellen gemeinsam ist die Annahme, daß die Interessen von Kindern in verschiedenen Bereichen und Konfliktsituationen nicht ausreichend wahrgenommen werden. Besonders problematisch ist die Vertretung der Interessen des Kindes im Verfahren, da es sich hier oft um Angelegenheiten handelt, die aus der familiären Situation entstehen und daher auch die Frage, wie weit der Staat eingreifen soll, zu bedenken ist.
Grundsätzlich übernehmen die Vertretung der Kindesinteressen die Eltern. Nur wenn diese bei ihrer Aufgabe versagen oder wenn es zu Interessenskonflikten zwischen Kindern und Eltern kommt, übernehmen Jugendämter, Richter und Sachverständige die Aufgabe, das Kindeswohl sicherzustellen.
Zu Konflikten, bei denen die Interessen des Kindes betroffen sind, kommt es sehr oft in finanziellen Belangen (zum Beispiel bei einer Erbschaft), oder bei Scheidungen, wenn es um das Sorgerecht geht. Im österreichischen Recht gibt es beispielsweise in Erbschaftsangelegenheiten einen sogenannten Kollisionskurator, der zu bestellen ist, wenn der gesetzliche Vertreter des Minderjährigen wegen einer Interessenskollision an der Ausübung dieses Amtes verhindert ist und der die Interessen des Minderjährigen wahrnehmen soll.34
In zivilrechtlichen Verfahren, wo es zu Interessenskonflikten zwischen Kindern und Eltern kommt, die nicht vermögensrechtlicher Art sind, fehlt in Österreich eine eigenständige Interessensvertretung für Kinder- und Jugendliche. Aber auch bei strafrechtlichen Tatbeständen, wie Mißbrauch und Mißhandlung, stellt sich die Frage nach der Vertretung der Kindesinteressen. Besonders in diesem Spannungsfeld ist es fraglich, wie die Interessen des Kindes am Besten gewahrt werden können, beziehungsweise ob die Interessen des Kindes durch Jugendamt, Pflegschaftsgericht, Staatsanwaltschaft, Gutachter, etc. bereits ausreichend gewahrt sind.
„Bis heute verstehen sich auch Strafverfolgungsbehörden als Sachwalter von Kindesinteressen, wenn etwa Kindesmißhandlungen oder sexueller Mißbrauch von Kindern zur Anklage kommen. Freilich handelt es sich hier um eine spezielle Situation: Kindesinteressen sind bereits schwerwiegend verletzt worden, und die staatliche Reaktion hat stets auch allgemeine gesellschaftliche Interessen - Generalprävention, Normstabilisierung, unter Umständen auch Vergeltungszwecke - im Blick. Das Interesse des einzelnen verletzten Kindes konkurriert also mit einer Reihe anderer Interessen.“35
Gerade im und nach einem gerichtlichen Verfahren stellt sich bei einer solchen Interessenskollision die Frage, wie dieser Konflikt gelöst und dabei gleichzeitig die, bei Kindern immer wieder durch das Verfahren verursachten, sogenannten sekundären Traumatisierungen hintangehalten werden können.
Bei zivilrechtlichen Kindesschutzverfahren, wo es um Einschränkung oder Entzug der elterlichen Rechte geht, wie Obsorge- und Sorgerechtsverfahren, ist ebenfalls die Vertretung der Kindesinteressen zu hinterfragen.
Im anglo-amerikanischen Raum, aber zum Beispiel auch in Frankreich und Deutschland, gibt es bereits verschiedene Konzeptionen einer solchen Interessensvertretung, wie noch im Überblick dargestellt werden soll. In Österreich wird mit der Kinder- und Jugendanwaltschaft ein Pfad beschritten, der einerseits konzeptuell an die Interessensvertretung im gesellschaftspolitischen Bereich angelehnt ist, andererseits aber auch Ansätze einer Vertretung im Verfahrensbereich enthält.
2.3.1. Interessensvertretung im gesellschaftspolitischen Bereich
Der Gedanke, die Interessen von Kindern im gesellschaftspolitischen Bereich durch ein Ombudssystem vertreten zu lassen ist keineswegs neu. Bereits 1979 gab es eine Empfehlung des Europarates zur Schaffung eines Kinderombudssystems.36
Norwegen war 1981 das erste Land, in dem ein Kinder-Ombudsmann aufgrund einer gesetzlichen Grundlage eingeführt wurde.
Beispielhaft für andere Modelle, die Interessen von Kindern im gesellschaftspolitischen Bereich zu vertreten, soll hier das norwegische System des Kinder-Ombudsmanns näher ausgeführt werden:
„Bei der Aufgabenumschreibung bediente sich der Gesetzgeber gesetzestechnisch einer Generalklausel, die vor allem die Lobbyfunktion des Ombudsmanns hervorhebt und festlegt, daß der Ombudsmann die Belange der Kinder gegenüber öffentlichen und privaten Stellen zu unterstützen hat.“37
Mit dieser Generalklausel gekoppelt wurde eine demonstrative Aufzählung wichtiger Aufgabenbereiche, die der Kinder-Ombudsmann wahrzunehmen hat:
„a) Schutz der Interessen von Kindern bei allen Planungs- und Begutachtungsvorlagen, die das Kind betreffen; entweder durch Eigeninitiative oder als öffentliche Anhörungsinstanz
b) Gewährleistung, daß die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Interessen des Kindes befolgt werden
c) Vorschläge von Maßnahmen, die Konflikte zwischen Kind und Gesellschaft lösen oder vermeiden
d) Vorschläge, die die Rechtssicherheit des Kindes am Kinderschutz verstärken
e) Gewährleistung, daß der öffentliche und private Sektor mit ausreichender Information über die Situation der Kinder versehen wird.“38
Dabei hat der Kinder-Ombudsmann aber nicht das Recht, Fälle zu entscheiden oder offizielle Beschlüsse rückgängig zu machen. Es ist ihm untersagt, sich mit Fällen zu befassen, bei denen es um Konflikte innerhalb einer Familie geht, er darf jedoch Auskünfte und Ratschläge erteilen, wo das Kind, beziehungsweise die Eltern Hilfe bekommen können. Fälle, die bereits gerichtsanhängig sind, muß er ablehnen.
Dem Kinder-Ombudsmann ist es also untersagt, die Interessen von Kindern im familiären Bereich wahrzunehmen. Lediglich die Auskunft, von wo sich die Betroffenen Hilfe holen können, ist ihm gestattet. Hier zeigt sich deutlich, daß bei den Funktionen des Kinder-Ombudsmanns die Lobbyfunktion im Vordergrund steht. Einzelfallhilfe gehört nur bedingt zu seinen Aufgaben, nämlich dort, wo es um Wahrnehmung der Kindesinteressen gegenüber öffentlichen und privaten Stellen geht.
Da der Kinder-Ombudsmann vor allem an gesellschaftspolitischen Prozessen mitwirkt, gehört die Öffentlichkeitsarbeit naturgemäß zu seinen wichtigsten Aufgaben, da sein Einfluß maßgeblich von seinem Bekanntheitsgrad sowie seiner fachlichen Überzeugungskraft abhängt.
Auch in der Bundesrepublik Deutschland gibt es auf kommunaler Ebene verschiedene Versuche, Kinder- und Jugendbeauftragte zu etablieren. Die formal umfassendste Form der Wahrnehmung von Kinderinteressen stellt die Einrichtung eines Amtes für Kinderinteressen dar, wie es 1991 in Köln geschaffen wurde, welches 58 (!) Mitarbeiterstellen umfaßt und dessen Hauptaufgabe in einer Politik für Kinder liegt, mit den Schwerpunkten Interessensvertretung und Planung, sowie Freizeitgestaltung und Spielpädagogik.
Der unmittelbare Kontakt mit Kindern wird überwiegend durch Projekte und ein Kindertelefon („Junge Leitung“) hergestellt. Dieses Amt ist Planungsbüro für andere Dienststellen der Stadtverwaltung und hat den Bedarf an Einrichtungen und Diensten unter Berücksichtigung der Wünsche, Interessen und Bedürfnisse junger Menschen und deren Erziehungsberechtigten für einen mittelfristigen Zeitraum zu ermitteln. Große Bedeutung hat dabei die Arbeit auf der Ebene der Infrastruktur, nämlich in den Bereichen Verkehr, Wohnraum, Raum zur Bewegung.39
2.3.2. Interessensvertretung im Verfahren
Anders als beim norwegischen Modell, wo der Ombudsmann Fälle, die gerichtsanhängig sind, ablehnen muß, wird im anglo-amerikanischen Raum die Frage der Vertretung der Interessen von Kindern eher durch eine eigenständige Vertretung von Kindern im Verfahren gelöst. Ein Grund dafür ist die stärker individualisierende Wahrnehmung der einzelnen Familienmitglieder. Ein weiterer Grund dafür ist die Überzeugung, daß Freiheitsrechte und Verfahren in einem untrennbaren Zusammenhang stehen.40 In den USA erging im Jahr 1967 eine maßgebliche Entscheidung für die Entwicklung verschiedener Modelle der Vertretung von Minderjährigen in Verfahren:
„Als richtungsweisender Markstein in der Entwicklung zu einer eigenständigen Vertretung Minderjähriger in gerichtlichen Verfahren gilt die Entscheidung des Supreme Court der USA In Re Gault. Gegenstand des Verfahrens war die Frage, ob einem Jugendlichen im Ermittlungs- und Strafverfahren das Recht auf eine Verteidigung durch einen Rechtsanwalt zusteht. Das Gericht erkannte ein solches Recht an. Obwohl hier im Mittelpunkt die Stellung des minderjährigen Verfahrensbeteiligten im Jugendstrafverfahren steht, gehen in den USA übereinstimmend Rechtsprechung und Lehre davon aus, daß mit dieser Entscheidung die verfassungsrechtliche Begründung der Verfahrensgarantien für Minderjährige nach wie vor gültig und generell, d. h. auch für andere Verfahrensarten, bestimmt worden sind.“41
Im Jahre 1974 erließ der Kongreß den Child Abuse Prevention and Treatment Act, wo von den Einzelstaaten gewisse Standards in der Gesetzgebung gefordert werden, darunter daß in allen Fällen, die zu einem Prozeß führen und in die ein mißbrauchtes oder vernachlässigtes Kind verwickelt ist, dem Kind ein guardian ad litem ernannt wird, um es in solchen zu vertreten. Unter guardian ad litem versteht man eine Person, der das Recht und die Pflicht zum Schutz einer anderen Person und deren Rechten aufgetragen wurde, weil diese Person nicht imstande ist, ihre Angelegenheiten selbst zu regeln.
Diese Gesetzgebung des Bundes veranlaßte viele Bundesstaaten, guardian ad litem-Modelle auch im zivilrechtlichen Verfahren zu entwickeln, wobei die Vertretung des Kindes vor dem Gericht zum Teil durch Rechtsanwälte, aber auch durch geschulte Freiwillige stattfand. Die zum Teil sehr unterschiedlichen Modelle mit manchmal sehr geringen Erfolgen lassen keinen allgemein gültigen Schluß zu, ob Anwälte oder geschulte Freiwillige die Vertretung als guardian ad litem effizienter wahrnehmen können.42
In Großbritannien gibt es für die sogenannten care proceedings, das sind von den Sozialbehörden initiierte Verfahren, die den Schutz Minderjähriger bei Kindeswohlgefährdung zu sichern suchen, eine besondere Lösung. In diesen Verfahren muß das Kind durch einen ausgebildeten Sozialarbeiter, als guardian ad litem, und einem, auf solche Verfahren spezialisierten Anwalt, vertreten werden. Diese Regelung besteht seit etwa 15 Jahren und gilt als sehr zielführend.43
In Frankreich wiederum fand durch die Verabschiedung und Ratifizierung der UN-Konvention über die Rechte des Kindes eine Sensibilisierung für die Rechte des Kindes statt und ließ Zweifel am System aufkommen, daß im Zentrum des Kinder- und Jugendschutzsystems ein mit weitreichenden Eingriffsbefugnissen und umfassenden jugendhilferechtlichen Anordnungsmöglichkeiten ausgestatteter Kinder- und Jugendrichter steht.
„In den letzten Jahren sind jedoch zunehmend auch Bemühungen in Gang gekommen, die verfahrensrechtliche Stellung von Kindern und Jugendlichen in zivilrechtlichen Sorgerechts- und Kinderschutzverfahren durch neue Formen der Rechtsberatung und qualifizierten Interessensvertretung von Kindern zu verbessern.“44
Bereits 1984 wurde in das französische Gesetz der Kinder- und Jugendhilfe eine Bestimmung aufgenommen, nach der Kinder und Jugendliche an den sie betreffenden Entscheidungen der Jugendhilfe zu beteiligen sind. Die Forderungen der Kinderrechtsbewegung gingen aber weiter. So wurde unter anderem eine eigene Parteistellung des Kindes im Sorgerechtsverfahren verlangt, um vom Status des Kindes als Objekt staatlicher Schutzmaßnahmen wegzukommen. Das französische Justizministerium fördert seit 1990 verschiedene modellhafte Ansätze auf dem Gebiet der Minderjährigenvertretung, die unabhängig voneinander in mehreren Städten von den dortigen Anwaltskammern entwickelt wurden.
„ Im Zentrum der Modellversuche stand zum einen die interdisziplinäre Aus- und Fortbildung von Anwälten im Familien- und Jugendrecht sowie auf angrenzenden sozialwissenschaftlichen Gebieten.“45
Auch in Deutschland gibt es eine Diskussion darüber, ob die Interessen von Kindern im Verfahren ausreichend gewahrt sind. Allerdings wird immer wieder davor gewarnt, einerseits eine Vermehrung der am Entscheidungsprozeß Beteiligten einzuführen,46 andererseits wird auf die Aufgaben der bereits am Verfahren beteiligten Inhaber des „staatlichen Wächteramtes“ verwiesen. Jugendamt und Gericht hätten die Interessen des Kindes so wahrzunehmen, daß das Kind keiner eigenständigen Vertretung im Verfahren mehr bedürfe.47 Damit wird die Auffassung vertreten, daß die Interessen des Jugendamtes und die des dem Kind beigeordneten Anwalts identisch sind. Dem wird entgegengestellt, daß das Jugendamt eine Behörde mit entsprechenden Eigeninteressen ist, die nicht stets mit den
Interessen der betroffenen Kinder identisch sein können, weshalb es eine ausschließlich die Interessen des Kindes berücksichtigende Vertretung nicht gibt, was zur Forderung nach einer eigenständigen Vertretung führte, die aber noch nicht verwirklicht ist. Es gibt verschiedene Vorschläge, wer diese Vertretung übernehmen könnte, die von der Vertretung durch einen spezialisierten Anwalt, über eine multiprofessionelle Expertengruppe oder der Übernahme des britischen Modells, bis zu einer Einzelperson, die nicht unbedingt Jurist sein muß, reichen.48
2.3.3. Das „österreichische Modell“
Die Regelung des Kinder- und Jugendanwaltes im Grundsatzgesetz (JWG 1989) wurde als zu einschränkend kritisiert, weil der Jugendwohlfahrtsträger nur dazu berufen wurde, im Einzelfall Beratung und Auskunft in jugendwohlfahrts-rechtlichen Angelegenheiten zu erteilen. Der Kinder- und Jugendanwalt sollte aber jemand sein, der sich auch losgelöst vom Einzelfall für generelle Anliegen von Kindern und Jugendlichen einsetzen soll, also in der Öffentlichkeit die Interessen von Kindern und Jugendlichen vertritt.49
„Zielsetzung bei der Einrichtung einer Kinder- und Jugendanwaltschaft muß es sein, den Kindern und Jugendlichen unseres Landes eine Interessensvertretung zu geben, die sie möglichst umfassend in allen Lebensbereichen - im Rahmen der diesbezüglichen Erfordernisse - vertritt, somit auch außerhalb des Bereiches der „Jugendwohlfahrt“ im engeren Sinn.“50
Es wurde, wenn die Definition einer „idealen“ Kinder- und Jugendanwaltschaft unternommen wurde, immer wieder auf das norwegische Modell (Vgl.. 2.3.1.) und auf Salgo bezug genommen, der sich mit der Funktion von Kinder- und Jugendbeauftragten im internationalen Vergleich auseinandergesetzt hat, die ebenfalls meist die klassischen Aufgaben eines Ombudsmanns erfüllen. Die Vertretung im Verfahren (Vgl. 2.3.2.) nahm in dieser Diskussion kaum Platz ein. Die typischen Merkmale von Kinder- und Jugendbeauftragten, die eine Ombudsmannfunktion erfüllen sind:
- Leichter Zugang
- Persönlichkeit, die in der Öffentlichkeit mit dem Amt des Kinder- und Jugendbeauftragten identifiziert wird
- Autorität und Unabhängigkeit, beruhend auf einer gesetzlichen Grundlage
- Autonome Beratung unter Wahrung von Anonymität und Vertraulichkeit
- Weisungsfreistellung in Ausübung der Tätigkeit
- Berichtspflicht an das Parlament
- Interdisziplinärer Mitarbeiterstab und die Möglichkeit ein wissenschaftliches Konsultationsorgan in Anspruch zu nehmen
- Akteneinsicht und Zutrittsrechte
- Berichts- und Auskunftspflicht von Einrichtungen, die mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben
- Recht auf Gehör in gesetzlichen Verfahren die Kinder betreffen (was jedenfalls einen Schritt in Richtung der Vertretung im Verfahren darstellt)
- Mitwirkung im Gesetzgebungsverfahren
- Selbständige Öffentlichkeitsarbeit
- gute finanzielle und personelle Ausstattung51
Mit der Regelung des § 10 JWG wurde den Jugendwohlfahrtsträgern lediglich aufgetragen, einen abgegrenzten Personenkreis in Einzelfällen zu beraten und ihm zu helfen. Weder wurde die Schaffung einer eigenen organisatorischen Einheit vorgesehen, noch war von einer generellen Vertretung der Interessen der Kinder und Jugendlichen die Rede. Der Kommentar zum JWG vertritt die Ansicht, daß die Schaffung einer besonderen organisatorischen Einrichtung zu Recht mit dem Argument abgelehnt wurde, daß man helfende Menschen an der Basis benötige, welche die tägliche Kleinarbeit leisten und nicht zusätzliche Organisationen mit zusätzlichem Aufwand. Weiters wird dort festgestellt, daß einzelne Landesgesetze mit ihren Regelungen in bezug auf die Kinder- und Jugendanwaltschaft über die grundsatzgesetzlichen Vorgaben hinaus gehen.52
Um eine Kinder- und Jugendanwaltschaft einzurichten, die der oben beschriebenen Ombudsmannfunktion auch nur einigermaßen gerecht wird, mußten die Landesgesetzgeber in ihren Ausführungsgesetzen die Regelungen, welche die Kinder- und Jugendanwaltschaft betreffen, gehörig erweitern.
Die Gründe für den zögerlichen Umgang mit der Einführung einer Kinder- und Jugendanwaltschaft teilt Pichler in vier Kategorien von Einwänden gegen Kinder- und Jugendanwaltschaften auf:
1. Einwände politischer Art, wie die Befürchtung, daß eine politische Interventionskonkurrenz entstehen könnte...
2. Einwände organisatorischer Art, wie zum Beispiel der Streit, ob die Service- oder die Hoheitsfunktion im Vordergrund stehen sollte, oder das Mißtrauen, das Klientenanwälten zunächst einmal entgegengebracht wird, da man hierzulande mit Bürgeranwaltschaften noch wenig vertraut ist...
3. Probleme kompetenzrechtlicher Art, wie die Befürchtung einer Kompetenzverschiebung zwischen Bund und Ländern, oder die Kapitulation vor einer „unlösbaren Querschnittsaufgabe“...
4. Probleme philosophisch - ideologischer Art, zum Beispiel, daß manchen die ganze Kinderrechtsbewegung wegen des Ziels der „Gleichberechtigung“, also wegen vermuteter Gleichmacherei suspekt ist...53
Letztlich setzte sich aber eine im Vergleich zur bundesgesetzlichen Regelung weitergehende Sichtweise der Kinder- und Jugendanwaltschaften durch. Auch Bundesländer, die ursprünglich nur die abgeschwächte Idee der Kinder- und Jugendanwaltschaft übernahmen, wie sie im JWG 1989 vorgesehen ist, novellierten ihre Ausführungsgesetze und führten Kinder- und Jugendanwälte ein, die eine Ombudsmannfunktion zu erfüllen haben.54 Die überwiegende Mehrheit der Regelungen, welche die Aufgaben der Kinder- und Jugendanwaltschaften in Österreich festlegen, sind Regelungen zur Vertretung der Interessen von Kindern und Jugendlichen im gesellschaftspolitischen Bereich. In Niederösterreich und Salzburg gibt es aber auch Regelungen, wo dem Kinder- und Jugendanwalt Rechte im Verwaltungsverfahren zugestanden werden. Beispielsweise wird der Salzburger Kinder- und Jugendanwaltschaft in § 14 Abs 3 lit a Salzburger JWO Parteistellung (§ 8 AVG) in Verwaltungsverfahren auf Grund der Salzburger JWO, des Salzburger Tagesbetreuungsgesetzes oder auf Grund landesgesetzlicher Vorschriften über bestimmte Vorhaben55 eingeräumt, soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist. Weiters hat die Salzburger Kinder- und Jugendanwaltschaft gemäß § 14 Abs 3 lit b das Recht auf Akteneinsicht (§ 17 AVG) und auf Ladung zur Teilnahme an mündlichen Verhandlungen in allen weiteren Verwaltungsverfahren, die auf Grund landesgesetzlicher Vorschriften durchzuführen sind und die Interessen von Kindern und Jugendlichen betreffen.
Auch das NÖJWG räumt der Kinder- und Jugendanwaltschaft in § 8 NÖJWG Rechte im Verwaltungsverfahren ein, nämlich in behördlichen Verfahren aufgrund des NÖJWG, soweit dies zur Erfüllung der Aufgaben erforderlich ist und, soweit der Kinder- und Jugendanwaltschaft Parteistellung zukommt, auch das Recht der Bescheidbeschwerde beim Verwaltungsgerichtshof gemäß Art 131 Abs 2 B-VG.
In weiterer Folge wird der Begriff Kinder- und Jugendanwalt für die Kinder- und Jugendanwälte, wie sie im österreichischen Recht definiert werden, verwendet.
In Graz wurde beim Magistrat ein Kinder- und Jugendbeauftragter mit den folgenden Schwerpunkten eingerichtet:
1. kinderfreundliche Stadtplanung,
2. Förderung von Kinderbeteiligung (Kinderrat, Kinderzeitung),
3. Engagement für ein kinderfreundliches Klima in der Gesellschaft
Der Kinder- und Jugendbeauftragte hat somit, auf kommunaler Ebene, ähnliche Arbeitsgebiete wie der steiermärkische Kinder- und Jugendanwalt, weshalb ein Koordinationsbedarf zwischen diesen beiden Einrichtungen zur Interessensvertretung von Kindern und Jugendlichen besteht.
3. Die Entwicklung des Steiermärkischen Jugendwohlfahrtsgesetzes mit besonderem Augenmerk auf den Kinder- und Jugendanwalt
3.1. Das Grundsatzgesetz des Bundes - JWG 1989
Das neue JWG ist im Zusammenhang mit den Reformen des Familienrechtes zu sehen, die 1970 begonnen wurden. 1989 wurden wesentliche Endschritte der Familienrechtsreform gesetzt, sowohl im zivilrechtlichen Bereich (KindRÄG, ErbRÄG), als auch im öffentlich- rechtlichen Bereich, durch das JWG 1989.56 Vor allem zivilrechtliche Regelungen, die im JWG 1954 enthalten waren, wurden nun im ABGB geregelt.
Die Neuregelung erfolgte mit den Zielen, das Jugendwohlfahrtsrecht an die veränderten gesellschaftlichen Verhältnisse und die tiefgreifenden Änderungen des Familienrechts anzupassen, den Dienstleistungscharakter der Jugendwohlfahrt zu verstärken, die freien Träger vermehrt für Aufgaben der Jugendwohlfahrtspflege heranzuziehen und allgemein anerkannte wissenschaftliche Erkenntnisse und geänderte Anschauungen über eine zielgerichtete Sozialarbeit zu berücksichtigen.57
Das JWG deckt den Bereich der in Art 12 Abs 1 Z 1 B-VG bezeichneten „Mutterschafts-, Säuglings- und Jugendfürsorge“ ab.
Das Jugendwohlfahrtsgesetz 1989 (JWG)58 trat mit 1. Juli 1989 in Kraft und löste damit das JWG 1954 ab. Die Übergangsbestimmungen, die das neue JWG vorsah, waren allerdings sehr kompliziert und widersprachen einander im § 42 Abs 2 und § 46. Nach § 42 Abs 2 JWG 1989 tritt das JWG 1954 am 30.Juni 1989 außer Kraft und nach § 42 Abs 1 JWG 1989 tritt am 1. Juli 1989 das JWG 1989 in Kraft. Im Widerspruch dazu steht § 46 JWG 1989, der bestimmt, daß bestimmte Teile des JWG 1954 erst dann außer Kraft treten, wenn in den Ländern die zu erlassenden Ausführungsgesetze zum JWG 1989 in Kraft treten. Es konnte daher eigentlich nicht genau gesagt werden, wann der Übergang vom JWG 1954 zum JWG 1989 stattfindet und dies wiederum widersprach dem Determinierungsgebot des Art 18 Abs 1 B- VG.
Gemäß Art 12 Abs 1 B-VG ist die Kompetenz zur Grundsatzgesetzgebung Bundessache, die Erlassung von Ausführungsgesetzen und die Vollziehung Landessache.
Gemäß Art 15 Abs 6 B-VG kann das Bundesgesetz für die Erlassung der Ausführungsgesetze eine Frist setzen, die im § 42 Abs 3 JWG mit einem Jahr vom Tag des Inkrafttretens des JWG festgesetzt wurde. Wird diese Frist überschritten, so geht gemäß Art 15 Abs 6 B-VG die Zuständigkeit für die Erlassung des Ausführungsgesetzes für dieses Land auf den Bund über. Die bestehenden Ausführungsgesetze blieben jedoch gemäß § 46 JWG 1989 in Kraft. Die Bestimmungen des JWG 1954 treten gemäß § 46 erst außer Kraft, wenn die Ausführungsgesetze erlassen werden. Dies würde dazu führen, daß bei einer Überschreitung der Einjahresfrist das
Ausführungsgesetz in Folge des Inkraftbleibens des JWG 1954 grundsatzgemäß blieb. Dies und die Tatsache, daß § 40 JWG als unzulässiger Eingriff in die Vollziehungskompetenz der Länder gesehen wurde, veranlaßte das KG Steyr, ein Gesetzprüfungsverfahren vor dem Verfassungsgerichtshof zu beantragen. Bezüglich der Übergangsbestimmungen kam der Verfassungsgerichtshof zum Ergebnis, daß diese mehrfach widersprüchlich formuliert sind und hob §46 des JWG 1989 wegen Verstoßes gegen Art 18 B-VG auf.59
Da das steiermärkische Jugendwohlfahrtsgesetz 1991 (StJWG)60 gemäß § 51 Abs 1 StJWG erst mit 1.Jänner 1991 in Kraft trat, war die Zuständigkeit für die Ausführungsgesetzgebung formell auf den Bund übergegangen, der allerdings kein Ausführungsgesetz erließ, da seine Kompetenz nur vorläufig war, da gemäß Art 15 Abs 6 B-VG mit der Erlassung eines Ausführungsgesetzes des Landes ein Ausführungsgesetz des Bundes außer Kraft tritt. Anzumerken ist noch, daß mit Ausnahme Wiens (WrJWG 1990) kein einziges Bundesland das Ausführungsgesetz zum JWG fristgerecht erließ.
Unter dem Titel „Kinder- und Jugendanwalt“ kommt es in § 10 JWG zur ersten gesetzlichen Umschreibung dieses Begriffs:
§ 10 JWG:
Die Jugendwohlfahrtsträger sind berufen,
1. Minderjährige, Erziehungsberechtigte und gesetzliche Vertreter in allen Angelegenheiten zu beraten, die die Stellung der Minderjährigen und die Aufgaben der Erziehungsberechtigten betreffen,
2. bei Meinungsverschiedenheiten und Auseinandersetzung über die Pflege und Erziehung zu helfen.
Mit diesem Paragraphen wurde der Gedanke einer Kinder- und Jugendanwaltschaft, die allgemein Kinder- und Jugendinteressen vertreten sollte61 in abgeschwächter Form aufgegriffen, um nicht in andere Zuständigkeiten einzugreifen. Der Jugendwohlfahrtsträger sollte dazu berufen werden, im Einzelfall Beratung und Auskunft in jugendwohlfahrtsrechtlichen Angelegenheiten zu erteilen.62 Diese Regelung kann sogar als Einschränkung gesehen werden, da der Kreis derer, die beraten werden sollen, allzu eng gefaßt wird.
„Wenn man bedenkt, daß die Jugendwohlfahrtsträger seit langem Auskünfte geben und beraten, und zwar nicht nur (...) gegenüber eng definierten Personen, sondern umfassend, weil Betreuung sonst im allgemeinen (und nicht nur im Einzelfall) gar keinen Sinn hat, scheinen die angeführten Begrenzungen sehr hinderlich. Was wäre, wenn eine querulatorische Partei einen Amtsträger anzeigt, weil er der zwar involvierten, aber nicht erziehungsberechtigten Tante eines Minderjährigen Auskünfte erteilt?“63
Es besteht aber auch die Auffassung, daß durch die Verwendung des Begriffes Kinder- und Jugendanwalt eine Ausgestaltung dieser Funktion in Richtung einer umfassenden Interessensvertretung für Kinder und Jugendliche, also auch die Vertretung allgemeiner Jugendinteressen, möglich sei.64 Der Kommentar zum JWG sagt dazu, daß dem Jugendwohlfahrtsträger damit eine umfassende Beratungs- und Hilfeleistungskompetenz zukommt, lehnt aber die Schaffung einer besonderen organisatorischen Einrichtung ab.65
Die, wie in der Literatur geforderte, allgemeine Vertretung von Kinder- und Jugendinteressen66, wurde im Grundsatzgesetz jedenfalls nicht vorgesehen, da der Kreis derer, die beraten werden müssen, auf einen bestimmten Personenkreis, nämlich die betroffenen Minderjährigen, deren Eltern und Erziehungsberechtigten eingeschränkt wurde. Die Tätigkeit der Jugendwohlfahrtsträger wurde also auf Einzelfallbearbeitung fixiert (Vgl.. 2.3.3.).67
3.2. Das Steiermärkische Jugendwohlfahrtsgesetz
In der Sitzung des steiermärkischen Landtages vom 16.10.1990 wurde das StJWG beschlossen, das laut § 51 Abs 1 StJWG mit 1.1.1991 in Kraft trat. In die Regierungsvorlage wurde, als § 14 unter dem Titel Kinder- und Jugendanwaltschaft, folgender Gesetzestext aufgenommen:
„Die Landesregierung und die Bezirksverwaltungsbehörden sind berufen, Minderjährige, Erziehungsberechtigte und gesetzliche Vertreter in allen Angelegenheiten zu beraten, die die Stellung der Minderjährigen und die Aufgaben der Erziehungsberechtigten betreffen, bei Meinungsverschiedenheiten und Auseinandersetzung über die Pflege und Erziehung zu helfen.“68
Die Regierungsvorlage übernahm also den Text des JWG beinahe wortwörtlich. Konkretisiert wurde lediglich der Begriff „Jugendwohlfahrtsträger“, nämlich durch „Landesregierung“ und „Bezirksverwaltungsbehörden“. In den Erläuterungen zur Regierungsvorlage schloß sich die Landesregierung der bundesgesetzlichen Regelung soweit an, daß sie die Erläuterungen der Regierungsvorlage der Bundesregierung69 wörtlich übernahm und nur folgenden Absatz hinzufügte:
„Es handelt sich hier um eine Tätigkeit, die sie bereits jetzt ausüben, aber in Zukunft in verstärktem Ausmaß als Servicefunktion anbieten sollen.“70
Damit ging der Entwurf der Landesregierung mit der Intention des § 10 JWG konform, wo die Schaffung einer eigenen organisatorischen Einheit abgelehnt wurde. Es wurde unter dem Titel „Kinder- und Jugendanwaltschaft“ kein eigenes Amt geschaffen, wie das auf Grund dieser Bezeichnung naheliegend wäre, sondern die kinder- und jugendanwaltschaftlichen Aufgaben wurden dem Jugendwohlfahrtsträger übertragen. Die Bestimmung im StJWG ist somit als Auftrag an den Jugendwohlfahrtsträger zu sehen, die bereits ausgeübte Beratungs- und Hilfeleistungskompetenz in Zukunft verstärkt als Service anzubieten. Da diese Funktion nach Ansicht der Landesregierung bereits ausgeübt wurde, wurden auch keine zusätzlichen Kosten veranschlagt.
Diese Regelung ist dann auch im gleichen Wortlaut beschlossen worden, allerdings als § 13 StJWG, da die Regelung über die Kinder- und Jugendanwaltschaft vor den § 14 „Verschwiegenheitspflicht“ (= § 13 der Regierungsvorlage) gezogen wurde. In § 5 Abs 3 Z 8 StJWG wird eine Kompetenz der Landesregierung zur Wahrnehmung der jugendanwaltschaftlichen Aufgaben, als nichtbehördliche Aufgabe, unbeschadet der Zuständigkeit der Bezirksverwaltungsbehörde statuiert.
3.2.1. Novellen 1994
Im Jahr 1994 wurde das StJWG zweimal novelliert. Die erste Novelle LGBl 1994/20 regelte die Kinder- und Jugendanwaltschaft neu, die zweite Novelle LGBl 1994/71 brachte Änderungen beim Pflegeelterngeld. In der Regierungsvorlage war noch nicht von einem Kinder- und Jugendanwalt, sondern von einem Kinder- und Jugendbeauftragten die Rede.71 In den Erläuterungen zur Regierungsvorlage wurde dies damit begründet, daß im Bundesgrundsatzgesetz der Begriff Kinder- und Jugendanwalt so definiert ist, daß die Jugendwohlfahrtsträger berufen seien, in Einzelfällen Beratung und Auskunft in jugendwohlfahrtsrechtlichen Angelegenheiten zu erteilen, weshalb im § 13 StJWG eine Kinder- und Jugendanwaltschaft mit den gleichen Aufgaben vorgesehen wurde. Daher mußte, nach der in der Regierungsvorlage vertretenen Ansicht, für die hinzugekommenen Aufgaben der §§ 13a und 13b eine neue Funktionsbezeichnung gewählt werden.72
Im Rahmen der Parteienverhandlungen im Ausschuß für Jugend, Familie und Frauenfragen wurde von diesem Begriff aber wieder abgegangen und der Begriff „Steiermärkischer Kinder- und Jugendanwalt“ eingeführt; weiters wurde die Regierungsvorlage noch wesentlich verändert. So wurde die Abberufung des Kinder- und Jugendanwaltes, die in der Regierungsvorlage noch relativ genau durch eine demonstrative Aufzählung der Abberufungsgründe geregelt war,73 in der endgültigen Fassung auf folgenden Text geändert:
§13a Abs 6 2.Satz StJWG
Die Landesregierung hat den Kinder- und Jugendanwalt abzuberufen, wenn in seiner Person Umstände eintreten, die ihn für dieses Amt als nicht mehr geeignet erscheinen lassen.
Auch wurde im Rahmen der Parteienverhandlungen der Aufgabenkatalog des Kinder- und Jugendanwaltes erweitert. In §13a Abs 1 2.Satz wird dem Kinder- und Jugendanwalt die Aufgabe, die Rechte und Interessen von Kindern und Jugendlichen zu vertreten, zugeteilt. Die genaue Zuteilung in allgemeine und besondere Aufgaben wird erst in § 13b vorgenommen. Aus den Reden im Landtag zur Beschlußfassung dieses Gesetzes geht hervor, daß mit der Bestimmung des § 13a Abs 1 2.Satz, der Kinder- und
Jugendanwalt nicht allein auf die Erfüllung der Aufgaben des §13b eingeschränkt werden soll, sondern eigene Schwerpunkte setzen kann.74 Unbeschadet der Einführung eines Kinder- und Jugendanwaltes haben die Jugendämter weiterhin kinder- und jugendanwaltschaftliche Aufgaben, nämlich die in § 13 fixierte Beratungs- und Hilfeleistungskompetenz, wahrzunehmen.
3.2.1.1. Zielsetzung der Novelle
Die Erläuterungen der Regierungsvorlage gehen davon aus, daß die individuellen Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen bereits weitgehend von freien Trägern der Jugendwohlfahrt und von den Jugendämtern wahrgenommen werden.
„Daher soll der Kinder- und Jugendbeauftragte nicht in erster Linie ein „Ombudsmann für Einzelfälle“, sondern ein „Ombudsmann für die generellen Bedürfnisse“ von Kindern und Jugendlichen sein. Dies schließt natürlich die Beratung in Einzelfällen nicht aus. Grundsätzlich soll seine Arbeit jedoch auf die Gesamtsituation von Kindern und Jugendlichen ausgerichtet sein.“75
Dieser Grundgedanke in der Regierungsvorlage wurde im Gesetz zwar beibehalten und spiegelt sich in § 13b Abs 1 wider, jedoch fand auch die Beratung und Hilfe in Einzelfällen in § 13b Abs 2 verstärktes Gewicht.
3.2.2. Novelle 1995
Auch im Jahr 1995 wurde das StJWG novelliert, wobei mit LGBl 81/1995 Änderungen im Bereich der Kostentragung wirksam wurden. Auf die
Regelungen über den Kinder- und Jugendanwalt hat dies jedoch keine Auswirkungen.
4. Der Kinder- und Jugendanwalt im steiermärkischen Jugendwohlfahrtsgesetz
4.1. Die „Kinder- und Jugendanwaltschaft“ versus „Der Kinder und Jugendanwalt“
Die Literatur verwendet die Begriffe Kinder- und Jugendanwaltschaft und Kinder- und Jugendanwalt oftmals synonym.76 Oft wird der Begriff Kinder- und Jugendanwaltschaft auch für die Institution, Kinder- und Jugendanwalt für die Person, die dieser Einrichtung vorsteht, verwendet. Betreffend die Regelungen in der Steiermark muß hier aber ein Unterschied gemacht werden, da es zu beiden Begriffen gesetzliche Regelungen gibt, nämlich § 13 StJWG für die Kinder- und Jugendanwaltschaft und §§ 13a und 13b StJWG für den Kinder- und Jugendanwalt. Diese Zweigleisigkeit der Regelungen ist österreichweit einmalig. In den anderen Bundesländern gibt es die gesetzlichen Regelungen entweder unter dem Begriff Kinder- und Jugendanwaltschaft (in Niederösterreich, Oberösterreich und Salzburg) oder unter dem Begriff Kinder- und Jugendanwalt (in Wien, Vorarlberg, Kärnten und Burgenland). Weiters existiert in der Steiermark ein Jugendwohlfahrtsbeirat (§§ 11, 12 StJWG), dessen Aufgabenbereich Überschneidungen zu den Aufgaben des Kinder- und Jugendanwaltes aufweist.
In der Steiermark besteht seit der Novelle des StJWG (LGBl 1994/20) eine Zweigleisigkeit zwischen Kinder- und Jugendanwaltschaft und Kinder- und Jugendanwalt, deren Aufgaben sich - wie bereits erwähnt - ebenfalls teilweise schneiden:
Mit der Kinder- und Jugendanwaltschaft gemäß §13 StJWG beruft der Gesetzgeber die Landesregierung und die Bezirksverwaltungsbehörden zur Beratung von Minderjährigen, Erziehungsberechtigten und gesetzlichen
Vertretern in allen Angelegenheiten, die die Stellung des Minderjährigen und die Aufgaben des Erziehungsberechtigten betreffen sowie zur Hilfestellung bei Meinungsverschiedenheiten über die Pflege und Erziehung. Es geht also um Beratung und Hilfe in Einzelfällen. Die Personen, die diese Beratung und Hilfe anbieten sollen, sind vor allem die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter in den Jugendämtern als Organe des Jugendwohlfahrtsträgers.
Diese Kompetenz zu Beratung und Hilfe in Einzelfällen hat auch der Kinder- und Jugendanwalt, der dieses Service aber unter besonderen Bedingungen anbieten kann: Er ist im Gegensatz zur Kinder- und Jugendanwaltschaft in Erfüllung seiner Aufgaben weisungsfrei und kann anonym in Anspruch genommen werden. Der Jugendwohlfahrtsträger als Kinder- und Jugendanwaltschaft hat auch behördliche Aufgaben, im besonderen übt er eine Kontrollfunktion aus, weshalb die Hemmschwelle, die Beratungs- und Servicefunktion in Anspruch zu nehmen, ungleich höher ist, da nicht garantiert werden kann, daß Sachverhalte, die bei dieser Beratung ans Licht kommen, und die ein Einschreiten der Behörde verlangen würden, nicht über den Dienstweg letztendlich zu einer Behördenreaktion führen, die nicht im subjektiven Interesse des Beratenen liegt. Schließlich muß der Jugendwohlfahrtsträger gemäß § 2 Abs 1 StJWG eingreifen, wenn das Wohl des Minderjährigen nicht mehr gewährleistet ist.
4.2. Der Jugendwohlfahrtsbeirat
Der Jugendwohlfahrtsbeirat wiederum, der in den §§11 und 12 StJWG geregelt ist, hat unter anderem eine Aufgabe, die sich mit den allgemeinen Aufgaben des Kinder- und Jugendanwaltes überschneidet, nämlich eingebrachte Gesetzesentwürfe auf die Interessen der Kinder und Jugendlichen hin zu prüfen. Gemäß § 11 Abs 1 StJWG hat der Jugendwohlfahrtsbeirat ausschließlich beratende Funktion, was ja in der Natur eines Beirates liegt, der wie folgt definiert wird:
„Beiräte sind kollegiale Gremien zur Beratung der Verwaltung. Sie haben keine Entscheidungsgewalt, sondern lediglich entscheidungs- vorbereitende Funktionen in Form von Begutachtung und Empfehlung. (...) Beiräte dienen der Legitimation von Verwaltungsentscheidungen durch Sachverstand und Interessensausgleich.“77
Das StJWG regelt nicht näher, ob der Jugendwohlfahrtsbeirat und seine Mitglieder bei der Erfüllung ihrer Aufgaben nach § 12 StJWG irgendwelchen Aufträgen oder Weisungen unterliegen, abgesehen vom Kinder- und Jugendanwalt, der gemäß §13a Abs 3 bei der Erfüllung seiner Aufgaben weisungsfrei ist (Vgl.. 4.3.1.4.).
Dieselbe Situation besteht in der Salzburger JWO, wo in den §§ 11, l2 Salzburger JWO ein Jugendwohlfahrtsbeirat eingerichtet wird, dessen Aufgabenkatalog allerdings umfangreicher als in der Steiermark ausgefallen ist, wobei festzuhalten ist, daß die Aufgaben, die dem Jugendwohlfahrtsbeirat in der Steiermark zukommen, nur demonstrativ aufgezählt sind. Zur Frage der Weisungsbindung der Mitglieder des Salzburger Jugendwohlfahrtsbeirates gibt es ein Gutachten von Berka. Er kommt zum Ergebnis, daß sich der Jugendwohlfahrtsbeirat bei seiner Tätigkeit von den Zielen und Grundsätzen der öffentlichen Jugendwohlfahrt leiten zu lassen hat, eine sachgerechte Erfüllung seines Auftrages aber eine weitgehende fachliche Autonomie erfordert. Dies ist eine Bedingung, damit sich seine fachliche Kompetenz entfalten und ein Ausgleich der im Beirat repräsentierten Interessen erzielt werden kann. Deshalb erscheint eine strikte Bindung an Weisungen vorgesetzter Dienststellen in sachlicher Hinsicht als problematisch. Es ist allerdings zwischen einer Bindung des Beirats und seiner Mitglieder an Weisungen der Landesregierung und der Frage, ob die einzelnen Beiratsmitglieder an Weisungen oder Aufträge jener Personen und Einrichtungen gebunden werden können, die sie nominieren oder denen sie angehören, zu unterscheiden.78 Bezüglich der Bindung einzelner Beiratsmitglieder an Weisungen und Aufträge der sie nominierenden Personen kommt Berka zum Ergebnis, daß diese Mitglieder ein freies Mandat wahrnehmen und daher rechtlich an solche Aufträge nicht gebunden werden können. Lediglich die dem Beirat in dienstlicher Funktion angehörenden Mitglieder aus dem Bereich des Amtes der Landesregierung und des Magistrats Salzburg können dazu verpflichtet werden, einen bestimmten Behördenstandpunkt im Beirat zu vertreten.
Gegenüber der Landesregierung ist der Jugendwohlfahrtsbeirat ein organisatorisch zugeordnetes Hilfsorgan, das dazu bestimmt ist, der entscheidungsbefugten Behörde Fachwissen zur Verfügung zu stellen, weshalb eine sachgerechte Erfüllung der dem Beirat übertragenen Aufgaben nicht möglich wäre, wenn die beratene Behörde das Ergebnis in nahezu unbegrenzter Form durch Weisungen beeinflussen könnte. Berka kommt daher zum Schluß, daß das Verfassungsrecht keine Grundlage für Weisungen der Landesregierung an den Beirat bietet, da die in Art 20 Abs 1 B-VG angeordnete Geltung des Weisungsprinzips nur für typische Teilbereiche der staatlichen Tätigkeit gilt, weshalb die organisatorischen Besonderheiten der Verwaltung durch Beiräte zu berücksichtigen sind.79
Der Kinder- und Jugendanwalt selbst ist gemäß §11 Abs 2 Z 6 StJWG Mitglied des Jugendwohlfahrtsbeirates. Es ist anzunehmen, daß bei der Begutachtung eines Gesetzesentwurfes die Empfehlung mehrerer sachverständiger Beiratsmitglieder mehr Gewicht hat, als die einzelne Expertenmeinung des Kinder- und Jugendanwaltes. Von Vorteil ist für den Kinder- und Jugendanwalt die Kompetenz zur Begutachtung von Gesetzesentwürfen auch außerhalb des Jugendwohlfahrtsbeirates, da er eine abweichende Meinung zur Empfehlung des Beirates in Form einer eigenen Begutachtung gemäß § 13b Abs 1 lit c abgeben kann. Meiner Ansicht nach ist das Ergebnis des Gutachtens von Berka auch auf die Rechtslage in der Steiermark übertragbar, wenn auch eine diesbezügliche Untersuchung nicht Inhalt dieser Arbeit ist. Jedenfalls erscheint es im Lichte der möglichen Verpflichtung von Behördenvertretern, einen Behördenstandpunkt einzunehmen, sinnvoll, daß der Kinder- und Jugendanwalt auch eigenständig Gesetze begutachten kann, da das Ergebnis der Begutachtung des Jugendwohlfahrtsbeirates nur ein Kompromiß der im Beirat vertretenen Meinungen sein kann, während der Kinder- und Jugendanwalt in seiner eigenständigen Begutachtung ausschließlich die Bedürfnisse und Rechte der Kinder und Jugendlichen zu berücksichtigen hat.
Die Kompetenz des Kinder- und Jugendanwaltes zur Begutachtung von Rechtsvorschriften geht außerdem weiter, da sie nicht nur auf Gesetzesentwürfe beschränkt ist.
4.3. Der steiermärkische Kinder- und Jugendanwalt
Selbst wenn es hier hauptsächlich um die landesgesetzlichen Bestimmungen der Steiermark geht, sollen einzelne Regelungen mit den Regelungen in anderen Bundesländern verglichen werden. Es wird jedoch keinesfalls ein umfassender Vergleich angestrebt, sondern nur eine Auswahl, wobei vor allem auf die Unterschiedlichkeit der Regelungen Bedacht genommen werden soll.80
4.3.1. Ausgestaltung
Die Wahrnehmung jugendanwaltschaftlicher Aufgaben wird im § 5 Abs 3 Z 8 StJWG der Landesregierung ausdrücklich als nichtbehördliche Aufgabe, die sie unbeschadet der Zuständigkeit der Bezirksverwaltungsbehörde zu erfüllen hat zugewiesen. Durch die §§ 13a und 13b StJWG wird der Steiermärkische Kinder- und Jugendanwalt eingerichtet.
4.3.1.1. Organisation
Der Kinder- und Jugendanwalt wird gemäß § 13a Abs 1 beim Amt der Steiermärkischen Landesregierung eingesetzt. Er untersteht gemäß §13a Abs 2 dienstrechtlich der Landesregierung und ist gemäß § 13a Abs 3 bei der Erfüllung seiner Aufgaben an keine Weisungen gebunden.
4.3.1.2. Bestellung, Amtsdauer und Abberufung
Gemäß § 13a Abs 2 ist der Kinder- und Jugendanwalt von der Landesregierung jeweils für die Dauer von fünf Jahren nach öffentlicher Ausschreibung zu bestellen. Außer dem Erfordernis einer öffentlichen Ausschreibung wird im StJWG nichts über das Bestellungsverfahren ausgesagt. Lediglich in den Erläuterungen zur Regierungsvorlage gibt es noch einen Hinweis auf das Bestellungsverfahren:
„Die Auswahl einer geeigneten Person soll mit Hilfe eines „Hearing“ erfolgen. Von einer Jury, bestehend aus Fachleuten verschiedener Disziplinen, wird ein entsprechender Vorschlag an die Landesregierung weitergeleitet, welche die endgültige Entscheidung trifft.“81
Konkret geregelt ist das Bestellungsverfahren in der Salzburger Jugendwohlfahrtsordnung in § 13 Abs 2, wo festgelegt wird, daß nach der öffentlichen Ausschreibung eine öffentliche Anhörung der Bewerber vor dem Jugendwohlfahrtsbeirat stattzufinden hat. Dieser hat der Landesregierung vom Ergebnis dieses Hearing zu berichten, wobei er auch Vorschläge für die Bestellung erstatten kann.
„Die Durchführung eines öffentlichen Hearing vor dem Jugendwohlfahrtsbeirat ist sehr zielführend, weil durch die Zulassung der Öffentlichkeit eine gewisse Transparenz und Nachvollziehbarkeit einer wichtigen Personalentscheidung bewirkt wird. Durch die Einbindung des Jugendwohlfahrtsbeirates, dessen Mitglieder größtenteils von der Verwaltung unabhängige Experten sind, wird für eine möglichst lose Verbindung des Kinder- und Jugendanwaltes, der ja eine weitreichende Unabhängigkeit genießen soll, zur Landesregierung gesorgt.“82
Die Salzburger Regelung zeigt also eine Möglichkeit auf, in welcher Form der Gedanke eines öffentlichen Hearing, der ja auch in der Regierungsvorlage auftritt, in konkreter Form verwirklicht werden kann.
In den Erläuterungen zur Regierungsvorlage wurden beim zukünftigen Kinder- und Jugendanwalt umfassende interdisziplinäre Kenntnisse und Fähigkeiten vorausgesetzt. In der Stellenausschreibung wurden neben allgemeinen Voraussetzungen auch folgende Qualifikationen gefordert:
„...eine einschlägig abgeschlossene Ausbildung im Bereich der Human- oder Gesellschaftswissenschaften: zum Beispiel: Pädagogik, Psychologie, Jus, Sozialarbeit usw. (ideal wäre eine Kombination der genannten Ausbildungen) und Fachkenntnisse im Bereich der Rechtsvorschriften und Verfahrensabläufe bei Verwaltungsbehörden und Gerichten sowie Erfahrung im Umgang mit
Institutionen und Entscheidungsträgern; Wissen über zwischenmenschliche Entwicklungs- und Kommunikationsprozesse und Kompetenz im Umgang mit Konflikten; Wissen um bzw. Interesse für gesellschaftlich relevante Entwicklungen und deren Reflexionen in bezug auf die Tätigkeit. Bevorzugt werden Bewerber/innen, die zusätzlich Berufserfahrung in der pädagogischen oder sozialen Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Familien und Erfahrungen in der Öffentlichkeitsarbeit und im Umgang mit den Medien nachweisen können.“83
Die hier geforderten Qualifikationen zeigen, daß es eine gewisse Schwierigkeit ist, die Aufgaben, die der Kinder- und Jugendanwalt zu erfüllen hat, einem bestimmten Ausbildungserfordernis zuzuordnen. Juristen ohne zusätzliche Qualifikationen dürften wohl nur schwer in der Lage sein, die Interessen von Minderjährigen fachgerecht zu ermitteln und diese dann in die Erwachsenenwelt zu übersetzen. Andererseits fehlen aber Sozialarbeitern oder Psychologen die nötigen rechtlichen Kenntnisse, um entsprechend beraten zu können. Dieses Problem, worüber auch in Deutschland diskutiert wird, führte zur Forderung nach einer multiprofessionellen Expertengruppe, bestehend aus Berufen wie
a) Jurist/Juristin
b) Psychologe/Psychologin
c) diplomierter Heilpädagoge/Heilpädagogin
d) Sozialarbeiter/Sozialarbeiterin
e) Pädiater/Pädiaterin
f) Sekretär/Sekretärin84
Auch innerhalb von Österreich gibt es verschiedene Versuche, den umfassenden Qualifikationserfordernissen gerecht zu werden. Was sich vor allem in den unterschiedlichen personellen Ausstattungen der einzelnen Kinder- und Jugendanwaltschaften widerspiegelt (Vgl. 4.3.1.3.).
Die Amtsdauer des Kinder- und Jugendanwaltes beträgt 5 Jahre. Das StJWG macht keine Aussage, ob und wie oft der Kinder- und Jugendanwalt wiederbestellt werden kann. Daher ist anzunehmen, daß eine Bestellung für jeweils weitere fünf Jahre, nach öffentlicher Ausschreibung, wie es §13 a Abs 2 StJWG vorsieht, möglich ist.
Gemäß § 13a Abs 6 endet das Amt des Kinder- und Jugendanwaltes durch Verzicht, Tod oder Abberufung durch die Landesregierung. Die Landesregierung hat den Kinder- und Jugendanwalt abzuberufen, wenn in seiner Person Umstände eintreten, die ihn für dieses Amt als nicht mehr geeignet erscheinen lassen. Wie bereits in Kapitel 3.2.1. erwähnt, war in der Regierungsvorlage noch eine demonstrative Aufzählung der Abberufungsgründe vorgesehen, auf die letztlich aber verzichtet wurde. Die Formulierung ist sehr vage und unbestimmt, da sie nicht erkennen läßt, welche Art von „Umständen“ vorliegen müssen, damit eine Abberufung möglich ist.
Da der Kinder- und Jugendanwalt in § 13a Abs 2 dienstrechtlich aber ausdrücklich der Landesregierung unterstellt ist, kann eine Abberufung daher nur unter Anwendung der entsprechenden Regelungen des steiermärkischen Landesvertragsbedienstetengesetzes erfolgen, wobei im Vertragsbediensteten-gesetz die Entlassungsgründe wiederum demonstrativ aufgezählt werden. Die Entlassungsgründe des Vertragsbedienstetengesetzes sind insbesondere: wenn sich nachträglich herausstellt, daß der Vertragsbedienstete die Aufnahme in das Dienstverhältnis durch unwahre Angaben erschlichen hat; er sich einer besonders schweren Verletzung der Dienstpflichten schuldig macht; er seinen Dienst in wesentlichen Belangen erheblich vernachlässigt oder sich weigert seine Dienstverrichtungen ordnungsgemäß zu versehen.85 Aus diesem Grund stellt sich die Frage nach der Sinnhaftigkeit der Regelung des § 13a Abs 2.
4.3.1.3. Ausstattung
Die Personal- und Sachausstattung verdient besonderes Augenmerk, da die Verwirklichung der im Gesetz gestellten Aufgaben in bedeutendem Ausmaß davon abhängt. Gleichzeitig ist die Ausstattung auch ein besonders sensibles Thema, da hier Kosten entstehen.
Zur Sachausstattung gibt es im Gesetz keinerlei Hinweise. Lediglich aufgrund der Aufgaben und der Funktion des Kinder- und Jugendanwaltes kann man auf eine gewisse Sachausstattung, die notwendig ist, schließen: Jedenfalls benötigt der Kinder- und Jugendanwalt ein geeignetes Büro, das, um die Inanspruchnahme mit möglichst wenig Schwellenangst zu ermöglichen, nicht ein Büro unter vielen in einem Verwaltungsgebäude sein sollte.
Da der Kinder- und Jugendanwalt den Auftrag hat, bei Meinungsverschiedenheiten zwischen Kindern und Jugendlichen einerseits und den Behörden andererseits zu vermitteln und zu beraten, kann er seine Vermittlerrolle auch durch eine räumliche Trennung zu den Behörden klarer zum Ausdruck bringen. Außerdem sollte das Büro aber auch recht zentral gelegen und nicht nur mit dem Auto erreichbar sein, da ja Kinder und Jugendliche die Möglichkeit haben sollen, den Kinder- und Jugendanwalt alleine, ohne allzu großen Aufwand aufzusuchen. In Kärnten beispielsweise befindet sich das Büro der Kinder- und Jugendanwältin ca. 10 Minuten außerhalb des Stadtzentrums. Die Hemmschwelle, die Kinder- und Jugendanwältin aufzusuchen ist durch die Distanz größer, weshalb man sagen kann, daß sich die ungünstige Lage des Büros negativ auf die Arbeit der Kinder- und Jugendanwältin auswirkt.86
Außerdem muß das Büro, um die Aufgaben zu erfüllen mit einem Mindestmaß an Kommunikationstechnologie, wie zum Beispiel Fax und Kopiergerät, ausgestattet sein. Das Büro des steiermärkischen Kinder- und Jugendanwaltes erfüllt diese Bedingungen.87 Weiters hat der Kinder- und Jugendanwalt den Auftrag, die Öffentlichkeit zu informieren, was entsprechende Mittel voraussetzt, um Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben.
Bezüglich der Sachausstattung finden sich nur in Salzburg, Tirol, Niederösterreich, Wien und Oberösterreich Regelungen: Die Salzburger Jugendwohlfahrtsordnung besagt in § 13 Abs 5, daß das Land der Kinder- und Jugendanwaltschaft die zur ordnungsgemäßen und wirkungsvollen Besorgung ihrer Aufgaben erforderlichen Mittel zur Verfügung zu stellen hat. Im Bericht des Verfassungs- und Verwaltungsausschusses des Salzburger Landtages wird vorgeschlagen, die Kinder- und Jugendanwaltschaft aus psychologischen Gründen räumlich von anderen Behörden und Ämtern zu trennen.88 Im Tiroler JWG wird in § 6a Abs 3 festgelegt, daß die Landesregierung die für die Besorgung der Aufgaben des Kinder- und Jugendanwaltes erforderlichen Sach- und Geldmittel zu Verfügung zu stellen hat. In Wien wird im § 10 Abs 2 WrJWG (in der Fassung der Novelle LGBl 5/1994) festgelegt, daß das Amt der Landesregierung für die Bereitstellung der personellen und sachlichen Erfordernisse zu sorgen hat. In Nieder- und Oberösterreich hat die Landesregierung dafür zu sorgen, daß der Zugang insbesondere für Kinder und Jugendliche leicht möglich ist.89 Diese Regelung spricht auch eher für eine räumliche Trennung von anderen Behörden und Ämtern, um die Schwellenangst möglichst niedrig zu halten.
Zur Frage der Personalausstattung gibt das StJWG nur spärliche Informationen: § 13b Abs 4 besagt, daß der Kinder- und Jugendanwalt zur Erfüllung seiner Aufgaben die Mitarbeit externer Fachkräfte in Anspruch nehmen kann. Somit ist zumindest klar, daß der Kinder- und Jugendanwalt nicht völlig allein seine Aufgaben wahrnehmen soll, andererseits wird damit aber auch ausgesagt, daß er grundsätzlich seine Aufgaben alleine zu erfüllen hat und nicht in einem multiprofessionellen Team, wie das oft gefordert wird. In den Erläuterungen zur Regierungsvorlage wird zu § 13b Abs 4 ausgeführt, daß der Kinder- und Jugendanwalt, weil er ja in sehr vielen verschiedenen Bereichen aktiv sein soll, in speziellen Fachfragen die Mitarbeit entsprechender Fachkräfte in Anspruch nehmen können soll und daß dies entsprechende Budgetmittel voraussetzt.90 Es ist also vorgesehen, daß dem Kinder- und Jugendanwalt Mittel zur Verfügung gestellt werden, um externe Fachkräfte in Anspruch zu nehmen. Da der Steiermärkische Kinder- und Jugendanwalt diese Kompetenz besitzt, scheint es auf der Hand zu liegen, daß er die externen Fachkräfte selbst aussucht und im Rahmen der budgetären Möglichkeiten einsetzt. In der Realität ist das in der Steiermark aber nicht der Fall. Einerseits besitzt der Kinder- und Jugendanwalt nicht die Budgethoheit und kann daher nicht über die nötigen Mittel verfügen, andererseits steht das Amt der steiermärkischen Landesregierung auf dem Standpunkt, daß dann, wenn der Kinder- und Jugendanwalt zum Beispiel einen Psychologen mittels eines freien Dienstvertrages für eine bestimmte Stundenzahl pro Monat beschäftigt, in Wirklichkeit kein freier Dienstvertrag, sondern ein Arbeitsvertrag entsteht, den er nicht abschließen kann, da die Personalhoheit beim Amt der steiermärkischen Landesregierung liegt. So entsteht die paradoxe Situation, daß der Kinder- und Jugendanwalt einerseits durch § 13b Abs 4 StJWG ermächtigt ist, die Mitarbeit geeigneter externer Fachkräfte in Anspruch zu nehmen, dies in der Realität aber nicht kann, da er über vorhandene Mittel nicht frei verfügen kann, und die Beschäftigung dieser Mitarbeiter überdies einen Arbeitsvertrag bedingen würde, den er nicht abschließen kann. Der freie Dienstvertrag unterscheidet sich vom Arbeitsvertrag vor allem durch das Fehlen der persönlichen Abhängigkeit und ist frei von Beschränkungen des persönlichen Verhaltens. Maßgeblich für die Beurteilung, ob ein freier Dienstvertrag oder ein Arbeitsvertrag vorliegt, ist, inwieweit der Verpflichtete in den Organismus des Betriebs eingegliedert und weisungsgebunden ist.91 Um die Frage, ob die externen Mitarbeiter des Kinder- und Jugendanwaltes aufgrund eines freien Dienstvertrages oder eines Arbeitsvertrages beschäftigt sind, zu beantworten, wird bei jedem Einzelnen zu überprüfen sein, wieweit er weisungsgebunden und in den Organismus des Betriebes eingegliedert ist. Ein Psychologe, der in einem Einzelfall vom Kinder- und Jugendanwalt mit der Erstellung eines Gutachtens betraut wird, wird sicher die Kriterien eines freien Dienstvertrages erfüllen. Derselbe Psychologe, der 10 Stunden pro Woche dem Kinder- und Jugendanwalt bei der laufenden Erfüllung seiner Aufgaben zur Seite steht und daher eng mit ihm zusammenarbeitet, wird eher aufgrund eines Arbeitsvertrages beschäftigt sein. Das bedeutet, daß der Kinder- und Jugendanwalt externe Mitarbeiter nur im Einzelfall in Anspruch nehmen kann, beispielsweise um eine Expertenmeinung zu einem bestimmten Problem einzuholen. So wichtig und vorteilhaft die Möglichkeit, in Einzelfällen externe Fachkräfte in Anspruch nehmen zu können auch ist, wäre es doch auch sehr sinnvoll, dem Kinder- und Jugendanwalt Fachkräfte, deren Qualifikation zur Ausbildung des Kinder- und Jugendanwaltes eine Ergänzung und Erweiterung darstellt, bei der Erfüllung seiner Aufgaben zur Seite zu stellen (Vgl. 4.3.1.2.).
Bei der personellen Ausstattung der Kinder- und Jugendanwaltschaft in anderen Bundesländern zeigt sich, daß es auch in Österreich hierzu durchaus verschiedene Ansätze gibt, weshalb hier die Personalausstattung in den einzelnen Bundesländern verglichen werden soll:92
Abbildung in dieser93 Leseprobe nicht enthalten94
Außer im Burgenland, in Tirol und in Vorarlberg sind überall Juristen und Juristinnen in der Kinder- und Jugendanwaltschaft tätig. In jeweils vier Bundesländern werden darüber hinaus noch Psychologen/innen und Sozialarbeiter/innen beschäftigt. Allen Bundesländern gemeinsam ist die Beschäftigung einer Sekretärin. Es zeigt sich, daß die Bundesländer, die mehr Personal beschäftigen, auf die Kombination Jurist und Psychologe (Psychotherapeut) setzen. Darüber hinaus werden in Wien, Niederösterreich und Salzburg noch Sozialarbeiter beschäftigt. Etwas aus dem Rahmen fällt hier Tirol, wo kein Jurist arbeitet und nun eine Sozialpädagogin als zweite Fachkraft eingesetzt werden soll. In den vier Bundesländern, in denen nur der Kinder- und Jugendanwalt und die Sekretärin beschäftigt werden, sind zwei Juristen (Stmk, K) und zwei psychologisch ausgebildete Mitarbeiter (Bgld, Vlbg) tätig.
Besonders hervorgehoben werden soll hier die personelle Ausstattung in Salzburg, die als vorbildlich gilt:
„Das Team der KiJA95 Salzburg ist von folgenden Faktoren geprägt, die sich nach unserer eigenen Einschätzung positiv auswirken:
(1) Zahl der MitarbeiterInnen: Die personelle Ausstattung mit 5 Dienstposten ermöglicht es der KiJA Salzburg, die umfassenden Aufgaben, der Information, Beratung, Vermittlung von Hilfsangeboten, Öffentlichkeitsarbeit und Interessensvertretung für Kinder und Jugendliche („Querschnittsaufgabe“) gut zu erfüllen. Auch intensive Beratungen können ohne längere Wartezeiten angeboten werden. In Einzelfällen ist es auch möglich, Jugendliche - falls zur Erfüllung der Aufgaben erforderlich - zu Ämtern oder anderen Einrichtungen der Jugendwohlfahrt o.ä. zu begleiten.
Durch Beiziehung von ExpertInnen und Aushilfskräften (insbesondere bei projektbezogenen Arbeiten) wird das KiJA Team bei Bedarf ergänzt.
(2) Interdisziplinäres Arbeiten: Die MitarbeiterInnen der KiJA haben unterschiedliche Qualifikationen und Berufserfahrungen. Dies ermöglicht einerseits eine kompetente, fachspezifische Beratungstätigkeit (juristisch, psychologisch, sozialpädagogisch,...), andererseits auch ein interdisziplinäres Arbeiten in Einzelfällen und bei konzeptuellen Aufgaben, Gesetzesbegutachtungen u.ä.“96
Interessant ist in diesem Zusammenhang auch die gesetzliche Bestimmung des §10 Abs 1 WrJWG (LGBl 5/1994):
§ 10 Abs 1 WrJWG
Zur besonderen Wahrung der Interessen von Kindern und Jugendlichen ist beim Amt der Wiener Landesregierung eine Kinderund Jugendanwaltschaft einzurichten. Sie besteht aus der Kinderund Jugendanwältin, dem Kinder- und Jugendanwalt sowie der erforderlichen Zahl von Mitarbeitern.
Damit wird unabhängig von der Qualifikation festgelegt, daß in Wien immer ein Mann und eine Frau der Kinder- und Jugendanwaltschaft vorstehen.
Im Tätigkeitsbericht 94/95 der Kinder- und Jugendanwaltschaft Wien findet sich kein Hinweis darauf, weshalb eine Kinder- und Jugendanwältin und ein Kinder- und Jugendanwalt eingesetzt werden. Aus sachlicher Sicht spricht allerdings einiges für die Sinnhaftigkeit einer solchen Regelung, wenn man zum Beispiel bedenkt, daß bei der Einzelfallarbeit ein wesentlicher Teil mit Gewalt gegen Kinder (349 Fälle im Beobachtungszeitraum) zu tun hat.97 Von diesen Fällen wiederum handelt es sich zu einem Großteil um Fälle der sexuellen Gewalt gegen Kinder (sexueller Mißbrauch; 240 Fälle), von der Mädchen weitaus stärker als Buben betroffen sind und die einen besonders sorgfältigen und sensiblen Umgang mit den Betroffenen verlangen. Gerade in diesen schwierigen Fällen kann es für Ratsuchende eine große Erleichterung sein, selbst entscheiden zu können, ob sie sich einem Mann oder einer Frau anvertrauen wollen.
4.3.1.4. Weisungsfreistellung
Durch die Verfassungsbestimmung des § 13a Abs 3 wird der Kinder- und Jugendanwalt bei der Erfüllung seiner Aufgaben weisungsfrei gestellt. Dies scheint gegen das Weisungsprinzip des Art 20 Abs 1 B-VG zu verstoßen, welches besagt, daß unter der Leitung der obersten Organe des Bundes und der Länder alle Verwaltungsorgane an die Weisungen der ihnen vorgesetzten Stellen gebunden sind, sofern verfassungsgesetzlich nichts anderes bestimmt wird.
„Nach der Vorstellung von der Universalität des Weisungsprinzips müßte es einen Weisungszusammenhang zu einem obersten Organ des Bundes oder des Landes überall geben, wo Geschäfte der Verwaltung im Sinne des B-VG (Vollziehung außerhalb der Gerichtsbarkeit ) besorgt werden.“98
Da Ausnahmen zum Weisungsprinzip gemäß Art 20 Abs 1 B-VG nur verfassungsgesetzlich vorgesehen werden können, stellte sich die Frage, ob unter dem Begriff „verfassungsgesetzlich“ nur Regelungen der Bundesverfassung oder auch Regelungen der Landesverfassungen zu verstehen sind. Der Verfassungsgerichtshof entschied hierzu in seinem Erkenntnis vom 17.Juni 1980 (VfSlg 8833/1980). Anlaßfall war die Salzburger Krankenanstaltsordnung 1975, die eine weisungsfreie Schiedskommission einrichtete. Durch historische Interpretation des Textes des Art 20 Abs 1 B-VG kam der Verfassungsgerichtshof zum Ergebnis, daß verfassungsgesetzlich hier sowohl als bundes-, als auch als landesverfassungsgesetzlich zu verstehen ist. Daraus folgt also, daß Durchbrechungen des Weisungsprinzips auch im Landesrecht verfassungsgesetzlich vorgesehen werden können. Somit verstößt diese Regelung nicht gegen Art 20 Abs 1 B-VG.
Die Weisungsfreiheit wurde so geregelt, weil die Aufgaben, mit denen der Kinder- und Jugendanwalt betraut ist, letztlich nur dann sinnvoll erfüllt werden können, wenn er weisungsfrei gestellt ist. Die Weisungsfreistellung ist notwendig, um politische Einflußnahmen auf die Tätigkeit des Kinder- und Jugendanwaltes hintanzuhalten und die Unabhängigkeit von der restlichen Verwaltung zu sichern. Auch in anderen Bereichen des Verwaltungsrechts wurde die Weisungsfreistellung eingeführt, um Interessensvertreter (ZB. die Umweltanwälte als Vertreter von Umweltinteressen) vor politischer Einflußnahme zu schützen.99
Da sich die Weisungsfreistellung nur auf die Erfüllung der Aufgaben bezieht, ist der Kinder- und Jugendanwalt, was organisatorische und dienstrechtliche Belange angeht, voll weisungsgebunden, was zu Problemen führen könnte.
Im Tätigkeitsbericht der oberösterreichischen Kinder- und Jugendanwaltschaft 1994 wird unter der Überschrift „Schwachstellen“, ein Beispiel der Problematik der fachlichen Weisungsfreiheit versus dienstrechtlicher Weisungsgebundenheit aufgezeigt:
„Aufgrund des guten Einvernehmens und der Unterstützung der KiJA durch den Leiter der Abteilung Jugendwohlfahrt, kann in den meisten Fragen eine einvernehmliche Lösung erzielt werden, dennoch soll diese Problemstellung anhand eines Beispieles aufgezeigt werden: Aus fachlichen Gesichtspunkten (Psychohygiene, Erhaltung eines professionellen Beratungsstandards,...) ist eine begleitende (verpflichtende) Supervision, der in der Beratung und Krisenintervention tätigen Mitarbeiterinnen der KiJA dringend erforderlich. Da das Amt der o.ö. Landesregierung, aufgrund einer internen Regelung die Übernahme der Kosten von Supervision nur für Psychologen/innen und Sozialarbeiter/innen vorsieht, wird eine Kostenübernahme aus dem Budget der KiJA für Mitarbeiterinnen mit einer anderen Ausbildung (z.B. Juristin) unter Berufung auf die dienstrechtliche Komponente dieser Entscheidung abgelehnt.“100
Die Weisungsfreistellung des Kinder- und Jugendanwaltes bei der Erfüllung seiner Aufgaben hat sich in ganz Österreich durchgesetzt. Allerdings gibt es doch Unterschiede hinsichtlich der Reichweite der Weisungsfreistellung. Am weitesten geht dabei die Regelung in § 13 Abs 4 Salzburger JWO, die bestimmt, daß der Kinder- und Jugendanwalt an keine Weisungen gebunden ist und die ihm nachgeordneten Bediensteten ausschließlich an seine Weisungen gebunden sind. Es wird hier einerseits die Weisungsfreistellung nicht auf die Erfüllung der Aufgaben beschränkt, andererseits das Personal dem Kinder- und Jugendanwalt unterstellt. Diese Regelung wird in Salzburg noch ergänzt durch § 13 Abs 5 JWO, wo dem Kinder- und Jugendanwalt bei der Auswahl des Personals ein Mitspracherecht eingeräumt wird. Alle anderen Bundesländer schränken die Weisungsfreistellung auf die Erfüllung der Aufgaben der Kinder- und Jugendanwälte ein, wobei in Tirol und Oberösterreich die dem Kinder- und Jugendanwalt nachgeordneten Bediensteten nur an seine Weisungen gebunden sind und in Niederösterreich die gesamte Kinder- und Jugendanwaltschaft an keine Weisungen gebunden ist.
Fraglich ist allerdings, ob die Weisungsfreistellung ausreicht, um dem steiermärkischen Kinder- und Jugendanwalt die nötige Unabhängigkeit zu sichern, da ja beispielsweise über den Umweg der fehlenden Kompetenz, das zur Verfügung stehende Budget unabhängig zu verwalten, eine Einflußnahme auf seine Tätigkeit versucht werden könnte.
4.3.1.5. Leichter Zugang, Anonymität und Vertraulichkeit der Inanspruchnahme
§ 13a Abs 5 legt fest, daß der Kinder- und Jugendanwalt vertraulich und anonym in Anspruch genommen werden kann. Zur Erleichterung des Zugangs hat er insbesondere außerhalb von Graz Sprechtage abzuhalten. Mit dieser Bestimmung werden mehrere grundlegende Merkmale der Ombudsmannfunktion festgelegt (Vgl. 2.3.3.); nämlich leichter Zugang und vertrauliche und anonyme Beratung.
Die Bestimmung ist allerdings nur für die besonderen Aufgaben des Kinder- und Jugendanwaltes relevant, die in § 13b Abs 2 geregelt sind, nämlich bei der Beratung und Hilfe in Einzelfällen. Durch die Möglichkeit der vertraulichen und anonymen Beratung sinkt die Hemmschwelle von Ratsuchenden, die Hilfe des Kinder- und Jugendanwaltes in Anspruch zu nehmen. Vertraulich heißt auch, daß der Kinder- und Jugendanwalt Informationen, die er im Rahmen seiner Tätigkeit erhalten hat, ohne Einverständnis des Ratsuchenden nicht weitergeben darf. Diese Regelung ist vor allem dann relevant, wenn der Kinder- und Jugendanwalt im Rahmen seiner Tätigkeit von Sachverhalten erfährt, die, wenn sie den Behörden bekannt werden würden, zu deren Einschreiten führen würden, sei es durch eine Anzeige, sei es durch ein Eingreifen der öffentlichen Jugendwohlfahrt.
Um den Kinder- und Jugendanwalt überhaupt in Anspruch nehmen zu können, ist es wichtig, daß der Zugang zu ihm möglichst leicht gestaltet wird.
Deshalb ist in § 13a Abs 5 auch festgelegt, daß der Kinder- und Jugendanwalt insbesondere außerhalb von Graz Sprechtage abzuhalten hat. Die Abhaltung von Sprechtagen außerhalb der Landeshauptstadt ist außerdem noch in den Landesgesetzen von Oberösterreich, Niederösterreich, Vorarlberg und Tirol vorgesehen. Dies ist zweifellos ein Schritt in die Richtung eines leichten Zuganges, aber bei weitem nicht alles, was getan werden kann, um den Zugang zu erleichtern. Wo und in welchem Umfeld sich das Büro des Kinder- und Jugendanwaltes befindet, entscheidet maßgeblich über die Schwierigkeit des Zuganges (Vgl. 4.3.1.3.). Eine weitere Erleichterung des Zuganges stellt die österreichweit einheitliche Telefonnummer der Kinder- und Jugendanwälte dar, nämlich die Vorwahl der jeweiligen Landeshauptstadt und die Nummer 1708. Weiters erleichtert es den Zugang, wenn direkter Kontakt mit Kindern, Jugendlichen und Eltern aufgenommen wird, die ja in der Einzelfallarbeit beraten werden sollen. Dazu benötigt der Kinder- und Jugendanwalt einen gewissen Bekanntheitsgrad, den er durch Öffentlichkeitsarbeit erlangt (Vgl. 4.3.2.3.). Beispiele wie der direkte Kontakt hergestellt werden kann, sind der Besuch von Schulen, die Organisation von Veranstaltungen, wie zum Beispiel ein Spielfest, ein Informationsstand auf der Berufsinformationsmesse und auf der Sozialmesse sowie die Teilnahme an Veranstaltungen anderer Organisationen.101
4.3.1.6. Politische Kontrolle
Gemäß § 13b Abs 5 hat der Kinder- und Jugendanwalt mindestens einmal jährlich einen Tätigkeitsbericht zu erstellen, der von der Landesregierung dem Landtag vorzulegen ist.
Inhaltliche Anforderungen an den Tätigkeitsbericht werden im Gesetz nicht gestellt. Allerdings findet sich in den Erläuterungen zur Regierungsvorlage der Hinweis, daß der Tätigkeitsbericht auch themenbezogene Schlußfolgerungen und Empfehlungen enthalten kann.102
Eine weitergehende gesetzliche Regelung gibt es hierzu im § 14 Abs 2 der Salzburger Jugendwohlfahrtsordnung, wo außer der Möglichkeit, Schlußfolgerungen zu ziehen und Empfehlungen zu geben, noch eine Vorgehensweise im Falle der Aufzeigung von Mißständen bei Landesbehörden oder bei sonstigen Einrichtungen, die der Aufsicht des Landes unterliegen, oder bei Trägern der freien Jugendwohlfahrt festgelegt wird. In diesem Fall sind die jeweiligen Teile des Berichtes nämlich von der Landesregierung den Betroffenen zur Stellungnahme zu übermitteln.
Da der Kinder- und Jugendanwalt in Erfüllung seiner Aufgaben an keine Weisungen gebunden ist, erfüllt die Pflicht, einen Bericht über seine Tätigkeit abzugeben, die Funktion der Kontrolle seiner Arbeit. In Niederösterreich und Oberösterreich muß der Kinder- und Jugendanwalt einen Rechenschaftsbericht ablegen, was, von der Wortwahl her, den Kontrollaspekt verstärkt. Da der Tätigkeitsbericht aber nicht genehmigt, sondern nur von der Landesregierung dem Landtag vorgelegt werden muß, kann auf die inhaltliche Arbeit des Kinder- und Jugendanwaltes kein Einfluß genommen werden, was ja die Weisungsfreistellung ad absurdum führen würde, da dies eine maßgebliche Beeinflussung des Kinder- und Jugendanwaltes bei der Erfüllung seiner Aufgaben darstellen würde.
Eine weitere Funktion dieses Berichtes ergibt sich aus den Aufgaben des Kinder- und Jugendanwaltes, insbesondere aus der Regelung des § 13b Abs 1 lit b, wo festgelegt wird, daß der Kinder- und Jugendanwalt die Öffentlichkeit über Angelegenheiten, die für Kinder und Jugendliche von besonderer Bedeutung sind, zu informieren hat (Vgl.. 4.3.2.3.). Mit dem Tätigkeitsbericht kann der Kinder- und Jugendanwalt diese Aufgabe zumindest für eine interessierte Fachöffentlichkeit wahrnehmen.
Eine dritte Funktion des Berichtes ergibt sich aus der Möglichkeit, themenbezogene Schlußfolgerungen und Empfehlungen abzugeben.103 Hier ist es dem steiermärkischen Kinder- und Jugendanwalt möglich Mißstände aufzuzeigen, wie dies in der Salzburger Jugendwohlfahrtsordnung vorgesehen ist, und die entsprechenden Schlußfolgerungen daraus zu ziehen.
4.3.2. Allgemeine Aufgaben
Der § 13 b mit der Überschrift „Allgemeine und besondere Aufgaben des Steiermärkischen Kinder- und Jugendanwaltes“ gibt im Abs 1 eine genaue Aufzählung der Aufgaben des Kinder- und Jugendanwaltes. In den Erläuterungen zur Regierungsvorlage wird zum § 13 b unter der Überschrift „Allgemein“ folgendes festgestellt:
„Die eigentliche Aufgabe des Kinder- und Jugendanwaltes ist die politische Funktion der Interessensvertretung von Kindern und Jugendlichen. Dies bedeutet, daß er sich um generelle Angelegenheiten, die die Stellung des Kindes in der Gesellschaft betreffen annehmen soll.“104
Aus diesem Grund wird auch an dieser Stelle ( 4.3.2.1. Rechte und Interessen von Kindern vertreten) eine allgemeine Aufgabe behandelt, die gesetzlich aber an anderer Stelle, nämlich unter § 13a Abs 1 2.Satz geregelt ist und erst durch die Parteienverhandlungen in den Text aufgenommen wurde.
Interessanterweise bieten die Erläuterungen der Regierungsvorlage zu § 13b eine andere Gliederung der Aufgaben des Kinder- und Jugendanwaltes.105 Dort wird nämlich nicht nach allgemeinen und besonderen Aufgaben,
Aufnahme von mehr Kinder- und Jugendfreundlichkeit in Bauordnung und Planungspraxis in: Bericht 94/95 Kinder- und Jugendanwaltschaft Wien, 32 104 RV 47 BlgStmkLT 12. GP, 4 sondern nach dem Inhalt der Aufgaben unterschieden und es werden drei Bereiche festgelegt:
A. Themenorientierte Arbeit
B. Informations- und Kontaktarbeit
C. Öffentlichkeitsarbeit
Diese drei Bereiche werden genauer definiert und lassen sich unter die einzelnen Punkte des § 13 b oder unter die Aufgabe „Rechte und Interessen von Kindern und Jugendlichen vertreten“ subsumieren.
Weiters gibt die Regierungsvorlage unter der Bezeichnung „Themenorientierte Arbeit“ aber Bereiche vor, in denen der Kinder- und Jugendanwalt besonders aktiv sein soll. Damit wird auch schon vorweggenommen in welchen politischen Bereichen der Kinder- und Jugendanwalt seine Tätigkeit entfalten soll, um seine Aufgaben wahrzunehmen.
„Bereiche in denen er besonders aktiv sein sollte:
a) Jugendliche und Jugendschutz: Gewalt gegen Kinder, sexueller Mißbrauch, Suchtgiftgefährdung, Gefährdung durch den Umgang mit Spielautomaten, besondere Situation von Kindern ausländischer Mitbürger, familienfremd untergebrachte Kinder usw.
b) Erziehungsfragen: Der Kinder- und Jugendbeauftragte soll sich auch um Erziehungsfragen im Bereich der Kindergärten und Schulen kümmern.
c) Gesundheitspolitik: Hier geht es vor allem um Maßnahmen der Vorbeugung und der kindgemäßen Krankenhausversorgung.
d) Wohnpolitik: Die Planung müßte mehr kindgerechte Wohnqualität und ausreichende Spielmöglichkeiten im Wohnungsumfeld aufweisen.
e) Medienpolitik: Das Problem der Gewalt im Fernsehen und in den Videos ist hier wohl die vordringlichste Aufgabe. Pädagogisch wertvolle Kinder- und Jugendsendungen gibt es kaum.
f) Umweltpolitik: Schadstoffgrenzen orientieren sich an den Belastbarkeitsnormen der Erwachsenen, die Belastungsfähigkeit der Kinder sollte jedoch an erster Stelle stehen. Insgesamt geht es um das Bemühen, die Schädigung von Kindern stärker und effizienter abzubauen.
g) Verkehrspolitik: Nach wie vor sterben Kinder im Straßenverkehr oder tragen lebenslange Behinderungen davon.
h) Kulturelle Angebote: Initiierung ausreichender kultureller Angebote für Kinder- und Jugendliche.
i) Kommunalpolitik: Erarbeiten kommunaler Mitbestimmungsmodelle für Kinder und Jugendliche.“106
Es wird vom Kinder- und Jugendanwalt also erwartet, in diesen Bereichen der Politik seine Aufgaben wahrzunehmen. Zu den allgemeinen Aufgaben gemäß § 13a Abs 1 und § 13b Abs 1 gehören:
- Die Rechte und Interessen von Kindern und Jugendlichen zu vertreten
- Anregung zur Schaffung von besseren Lebensbedingungen für Kinder und Jugendliche zu geben
- Die Öffentlichkeit über Angelegenheiten, die für Kinder und Jugendliche von besonderer Bedeutung sind zu informieren
- Die Begutachtung von Gesetzen, Verordnungen und sonstigen Rechtsvorschriften unter Berücksichtigung der Bedürfnisse und Rechte der Kinder und Jugendlichen
- Einbringung der Interessen der Kinder und Jugendlichen bei Planungs- und Forschungsaufgaben, die auch die Lebensbedingungen der Kinder und Jugendlichen betreffen
4.3.2.1. Rechte und Interessen von Kindern vertreten
In §13a Abs 1 2.Satz wird festgelegt, daß der Kinder- und Jugendanwalt die Aufgabe hat, die Rechte und Interessen von Kindern und Jugendlichen zu vertreten.
Diese Aufgabe ist im StJWG nicht unter den Aufgaben des § 13b, sondern schon vorher, im §13a geregelt, der sich sonst eher mit der Ausgestaltung des Steiermärkischen Kinder- und Jugendanwaltes befaßt. Die Tatsache, daß dieser Satz auch erst im Rahmen der Parteienverhandlungen eingefügt wurde und nicht schon in der Regierungsvorlage vorhanden war und außerdem im Regelungssystem „aus der Reihe fällt“, läßt eine besondere Bedeutung vermuten. Von der Formulierung her ist dieser Satz eine Generalklausel, die einen gewissen Ermessensspielraum offenläßt, auch wenn die Aufgaben dann in § 13b konkretisiert werden. Aus den stenographischen Berichten läßt sich aus der Wortmeldung von Abg. Mag. Bleckmann, die sich auf diesen Gesetzestext bezieht, entnehmen, daß damit dem Kinder- und Jugendanwalt die Möglichkeit gegeben werden soll, selbst gewisse Schwerpunkte zu setzen und sein Aufgabenbereich nicht eingeschränkt werden soll.107 Daraus folgt auch, daß der Aufgabenkatalog des § 13b nicht taxativ alle Aufgaben anführt, auch wenn dies die Formulierung vermuten läßt, sondern als demonstrative Aufzählung zu verstehen ist.
Gleichzeitig wird durch diese Formulierung der Aufgabenbereich des Kinderund Jugendanwaltes auch in gewissem Maß unbestimmt.
Die Möglichkeit selbst einzelne Schwerpunkte zu setzen, ermöglicht es dem Kinder- und Jugendanwalt auch, einzelne Aufgaben des § 13b mit mehr Vehemenz als andere wahrzunehmen. Er ist also frei in der Entscheidung, welche ihm zugeteilten Aufgaben er in welchem Maß wahrnimmt. Als Einschränkung dieser Entscheidungsfreiheit ist aber doch die Zielsetzung der Gesetzesnovelle zu sehen (Vgl.. 3.2.1.1.), die den Kinder- und Jugendanwalt eher zur Wahrnehmung gesamtgesellschaftlicher Anliegen von Kindern und Jugendlichen anhält, die in § 13b Abs 1 als allgemeine Aufgaben ihren Niederschlag im StJWG gefunden haben. Das heißt, daß die Möglichkeit zur freien Schwerpunktsetzung bei der Erfüllung der gesetzlich definierten Aufgaben dort endet, wo die Wahrnehmung der allgemeinen Aufgaben vernachlässigt wird. Das bedeutet, daß der Kinder- und Jugendanwalt, sollte er sich ausschließlich der Einzelfallhilfe widmen, jedenfalls seine Befugnis zur freien Schwerpunktsetzung überschreitet. Eine weitere Einschränkung ist ebenfalls der Regierungsvorlage zu entnehmen, da in den Erläuterungen zu § 13b Abs 1 bei der näheren Beschreibung der Aufgaben des Kinder- und Jugendanwaltes festgehalten wird, daß der Kinder- und Jugendanwalt keine Aufgaben übernehmen darf, die in die Zuständigkeit des Jugendamtes oder der Gerichte fallen.
„Es soll kein „übergeordnetes Jugendamt“ geschaffen werden, d.h. der Kinder- und Jugendbeauftragte108 soll nicht zusätzlich Aufgaben übernehmen, die ohnedies in erster Linie von den Behörden wahrzunehmen sind.“109
Trotzdem stellt sich nun aber die Frage, ob der Kinder- und Jugendanwalt ermächtigt ist, Aufgaben wahrzunehmen, die nicht unter die allgemeinen und besonderen Aufgaben des § 13b subsumierbar sind. Der Formulierung und der Absicht des Gesetzgebers nach ist dies wohl zu bejahen. Der Kinder- und Jugendanwalt kann sich seine Aufgaben soweit selbst definieren, als er die Rechte und Interessen von Kindern und Jugendlichen vertritt. Da diese Formulierung aber unbestimmt ist, soll hier der Versuch unternommen werden, Anhaltspunkte für eine Erweiterung der Aufgaben des Kinder- und Jugendanwaltes aufzuzeigen. Der Versuch der Erweiterung wird von zwei Seiten her unternommen. Einerseits soll durch einen Vergleich der landesgesetzlichen Regelungen in anderen Bundesländern untersucht werden, ob es Regelungen gibt, die weiter führen als in der Steiermark und andererseits soll in der Literatur, die sich mit den Aufgaben von Kinder- und Jugendbeauftragten befaßt, nach weiteren Aufgaben gesucht werden, die unter die Formulierung „Rechte und Interessen von Kindern und Jugendlichen vertreten“ subsumierbar sind. Es soll also insbesondere aufgezeigt werden, welche Aufgaben eine Konkretisierung der Formulierung „Rechte und Interessen von Kindern vertreten“ umfassen kann; Bereiche, die nicht mehr mit der Interessensvertretung in Einklang zu bringen sind, sollen hier nicht konstruiert werden. Es ist aber auch möglich, daß der steiermärkische Kinder- und Jugendanwalt noch andere Aufgaben wahrnimmt, die hier keine Aufzählung finden, sich aber trotzdem unter „Rechte und Interessen von Kindern und Jugendlichen vertreten“ einordnen lassen.
Wie schon unter Kapitel 2.3. ausgeführt, lassen sich die Modelle der Interessensvertretung für Kinder nach deren Zielrichtung, nämlich der Interessensvertretung im gesellschaftspolitischen Bereich und der Interessensvertretung im Verfahren, unterscheiden. Die Interessensvertretung im Verfahren zur Abgrenzung der Aufgaben des Kinder- und Jugendanwaltes heranzuziehen, ist hier nicht sinnvoll, da der Kinder- und Jugendanwalt nur durch entsprechende Gesetzesänderungen die Interessen von Kindern und Jugendlichen im Verfahren wahrnehmen kann, was zu einer Betrachtung de lege ferenda führen würde, die ihren Platz in Kapitel 5.3.2. haben soll, obgleich es auch in Österreich in Salzburg und Niederösterreich derartige Ansätze gibt.
Zielführender ist hier die Betrachtung der Interessensvertretung von Kindern und Jugendlichen im gesellschaftspolitischen Bereich, in die zum Beispiel das norwegische Modell gehört, oder die Aufgaben des Kinder- und Jugendbeauftragte bei Salgo. Demnach kann unter der Formulierung „Rechte und Interessen von Kindern vertreten“ insbesondere auch folgendes verstanden werden, was nicht ausdrücklich im StJWG geregelt ist (Vgl. auch 2.3.1 und 2.3.3.):
- Gewährleistung, daß die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Interessen des Kindes befolgt werden
- Vorschläge von Maßnahmen, die Konflikte zwischen Kindern und Gesellschaft lösen oder vermeiden110
- Die Kindesanwaltschaft soll Repräsentant von Kindern und Jugendlichen in Verwaltung und Politik sein111
- umfassende politische Tätigkeit insbesondere in den Bereichen Kinder- Jugend- und Familienpolitik, aber auch in den Bereichen Gesundheits- Schul- und Verkehrswesen, Bauwesen und Raumordnung112 (diese politische Tätigkeit findet sich aber auch in der Regierungsvorlage, Vgl. 4.3.2.)
Der Vergleich mit den verschiedenen Landesgesetzen zeigt, daß der Steiermärkische Kinder- und Jugendanwalt bereits ziemlich umfassende Aufgaben hat, sich aber dennoch einiges finden läßt, was unter „Rechte und Interessen von Kindern vertreten“ subsumierbar ist und nicht schon im StJWG seinen Platz gefunden hat. Auch hier gilt, daß beim Vergleich nur Aufgaben, für deren Erfüllung nicht unbedingt eine eigene gesetzliche Bestimmung nötig ist, wie zum Beispiel Empfehlungen abgeben, betrachtet werden und nicht Aufgaben, wie zum Beispiel Vertretung der Interessen von Kindern und Jugendlichen in bestimmten Verwaltungsverfahren, wie dies in Salzburg und Niederösterreich zu den Aufgaben der Kinder- und Jugendanwaltschaft gehört (Vgl. 2.3.3.) und dort in den Landesgesetzen geregelt ist. Aus dieser Betrachtung ergeben sich folgende Aufgaben, deren Erfüllung unter die allgemeine Aufgabe „Rechte und Interessen von Kindern vertreten“ subsumierbar ist :
- Abgabe von Empfehlungen, soweit sie sich auf die Interessen von Kindern und Jugendlichen beziehen (§ 10 Abs 6 Z 3 WrJWG)
- als Mittler zwischen den Einrichtungen der Jugendwohlfahrt, den Eltern bzw. Elternteilen, der Schule, dem Kindergarten und den Kindern und Jugendlichen zu wirken (§ 7 Z 3 NÖJWG)
- Durchführung von Informationsveranstaltungen über Angelegenheiten, die für Kinder und Jugendliche von besonderer Bedeutung sind (§ 7 Z 4 NÖJWG)
- Beobachtung der Verwaltungspraxis auf dem Gebiet der Jugendwohlfahrt (§ 7 Z 5 NÖJWG)
- Anregung von Gesetzesbestimmungen, Verordnungen und sonstigen Rechtsvorschriften aus der Sicht der Kinder und Jugendlichen (§ 7 Z 6 NÖJWG )
- Anregung besonderer Kontrollen von Einrichtungen der freien Jugendwohlfahrt bei Mißständen (§ 7 Z 8 NÖJWG)
- im Interesse von Minderjährigen bei Gerichten, Verwaltungsbehörden und sonstigen Einrichtungen vorstellig zu werden (§ 14 Abs 1 lit c Salzburger JWO)
Weiters kann noch die Mitarbeit in der ständigen Konferenz der Kinder- und Jugendanwaltschaften Österreichs (vgl.4.3.2.7.) unter diese allgemeine Aufgabe eingeordnet werden, da sie die Interessen der Kinder und Jugendlichen auf Bundesebene vertritt, wie zum Beispiel durch Teilnahme an parlamentarischen Ausschüssen.113
Es zeigt sich, daß durch die Formulierung „ Rechte und Interessen von Kindern und Jugendlichen vertreten“ der Kinder- und Jugendanwalt in der Lage ist, bei Bedarf seinen Aufgabenbereich gehörig zu erweitern.
4.3.2.2. Anregung zur Schaffung von besseren Lebensbedingungen für Kinder und Jugendliche
Diese allgemeine Aufgabe, die in § 13b Abs 1 lit a festgelegt ist, ist durch die Verwendung des Wortes „Anregung“, ohne festzulegen wer angeregt werden soll, sehr weit gefaßt. Potentielle Adressaten dieser Anregungen werden sicherlich Politiker, Entscheidungsträger, Organe der Jugendwohlfahrt und der Schulbehörden, Personen, die mit Kindern und Jugendlichen im beruflichen Zusammenhang zu tun haben, Bauträger bei öffentlichen Gebäuden,... aber auch die Gesellschaft als Ganzes ( als „Öffentlichkeit“) sein. Wo auch immer der Kinder- und Jugendanwalt Möglichkeiten sieht, die Lebensbedingungen von Kindern und Jugendlichen zu verbessern, ist er dazu aufgerufen dies anzuregen.
Als Adressat dieser Anregungen kommt jede natürliche und juristische Person in Frage, da vom Gesetz her keine Einschränkung des Adressatenkreises vorgesehen ist.
In der Salzburger JWO gibt es mit § 14 Abs 3 lit d eine ähnliche Bestimmung, nach der der Kinder- und Jugendanwalt an alle Dienststellen der Gebietskörperschaften mit Empfehlungen für kindgerechte Verhaltensweisen und mit Vorschlägen zur Verbesserung der allgemeinen Lebensbedingungen und Entwicklungschancen von Kindern und Jugendlichen herantreten kann. Es wurde bei dieser Bestimmung zwar der Adressatenkreis eingeschränkt, aber in Verbindung mit dem 2. Satz der Bestimmung, ein Modus festgelegt, wie auf derartige Empfehlungen zu reagieren ist. Dieser besagt, daß die Behörden des Landes und der Gemeinden sowie die Träger der freien Jugendwohlfahrt verpflichtet sind, innerhalb einer Frist von acht Wochen den an sie gerichteten Empfehlungen nachzukommen oder andernfalls eine schriftliche Begründung, weshalb sie den Empfehlungen nicht nachgekommen sind, abzugeben.
Da auf Anregungen des steiermärkischen Kinder- und Jugendanwaltes nicht auf irgendeine Art und Weise reagiert werden muß, wird diese Aufgabe oft in Verbindung mit der Aufgabe, die Öffentlichkeit zu informieren erfüllt werden, um einen gewissen Druck auszuüben und eine entsprechende Bewußtseinsbildung in der Öffentlichkeit zu ermöglichen.
4.3.2.3. Öffentlichkeit informieren
Gemäß § 13b Abs 1 lit b hat der Kinder- und Jugendanwalt die Aufgabe, die Öffentlichkeit über Angelegenheiten, die für Kinder und Jugendliche von besonderer Bedeutung, sind zu informieren. In den Erläuterungen zur Regierungsvorlage ist dazu unter „Öffentlichkeitsarbeit“ folgendes festgehalten:
„Der Kinder- und Jugendbeauftragte muß grundsätzlich die Gelegenheit haben, in der Öffentlichkeit zu allen gesellschaftlichen Belangen, die die Interessen der Kinder und Jugendlichen betreffen, Stellungnahmen abgeben zu können. Er hat vor allem die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen in der Öffentlichkeit offensichtlich zu machen.“114
Damit hat der Kinder- und Jugendanwalt die Möglichkeit, eine Lobbyfunktion für die Rechte und Interessen von Kindern auszuüben und die Öffentlichkeit für die Anliegen der Kinder und Jugendlichen zu sensibilisieren und zu mobilisieren.115 Der Kinder- und Jugendanwalt steht schon aufgrund seiner Funktion als Vertreter der Rechte und Interessen von Kindern und Jugendlichen in der Öffentlichkeit und kann seine allgemeinen Aufgaben nur dann hinreichend erfüllen, wenn seine Anregungen und Empfehlungen auch in der Öffentlichkeit Gehör finden. Deshalb ist Öffentlichkeitsarbeit eigentlich keine eigenständige Aufgabe, sondern immer im Zusammenhang mit den allgemeinen Aufgaben des Kinder- und Jugendanwaltes zu betrachten und danach zu beurteilen, wie gut es dem Kinder- und Jugendanwalt gelingt, die Anliegen und Interessen von Kindern, Informationen, Anregungen, Empfehlungen und Forderungen in der Öffentlichkeit zu vermitteln.
Gleichzeitig kann er mittels themenbezogener Öffentlichkeitsarbeit auch den Bekanntheitsgrad und die Akzeptanz des Kinder- und Jugendanwaltes in der Öffentlichkeit erhöhen, - eine Bedingung für die Ausübung der Ombudsmannfunktion (Vgl.2.3.3.).
Die Bestimmung des § 13b Abs 1 lit b deutet durch die Verwendung des Plurals (Kinder und Jugendliche) zwar darauf hin, daß die Information der Öffentlichkeit über Angelegenheiten, die eine größere Zahl von Kindern und Jugendlichen betreffen, erfolgen soll, dennoch kann auch ein Einzelfall, der exemplarisch für andere Fälle ist, unter Berufung auf diese Regelung in die Öffentlichkeit gebracht werden. Dabei sind die Möglichkeiten des Kinder- und Jugendanwaltes allerdings durch den Datenschutz und die Vertraulichkeit der Inanspruchnahme (§ 13a Abs 5) begrenzt.
Theoretisch könnte sich die Information der Öffentlichkeit auch auf die Aufdeckung von Mißständen in der Verwaltung beziehen, was aber der Absicht des Gesetzgebers widersprechen würde, da der Kinder- und Jugendanwalt damit auch eine Kontrollfunktion gegenüber der Verwaltung ausüben würde. In den Erläuterungen zur Regierungsvorlage wird dem Kinder- und Jugendanwalt in einem solchen Fall vielmehr nahegelegt, bei der gemeinsamen Problemlösung mitzuwirken.116
Diese Kontrollfunktion fällt außerdem in die Kompetenz der Volksanwaltschaft.
4.3.2.4. Begutachtung von Gesetzen und sonstigen Rechtsvorschriften
Gemäß § 13b Abs 1 lit c hat der Kinder- und Jugendanwalt Gesetze, Verordnungen und sonstige Rechtsvorschriften unter Berücksichtigung der Bedürfnisse und Rechte der Kinder und Jugendlichen zu begutachten. Bei dieser Regelung stellt sich nun die Frage, was unter dem Begriff „sonstige Rechtsvorschriften“ zu verstehen ist. Aus den Erläuterungen zur Regierungsvorlage lassen sich keine Hinweise entnehmen, woran bei dieser Bestimmung konkret gedacht wurde.
Die Begriffe „Rechtsvorschrift“ und „Rechtsnorm“ werden synonym verwendet.117
„Die Rechtsnorm ist eine Norm eines Rechtssystems. Sie kann eine individuelle oder eine generelle Norm sein; sie kann unbedingtes oder bedingtes Sollen (...) statuieren.“118
Das heißt, es kommen grundsätzlich alle Rechtsnormen, die im Bereich der Landesgesetzgebung liegen, zur Begutachtung in Betracht. Dies würde aber sehr weit und zu sachlich unsinnigen Ergebnissen führen, da dann auch Bescheide, Entscheidungen in Verwaltungsverfahren nach Landesgesetzen, Weisungen und Erlässe der Begutachtung des Kinder- und Jugendanwaltes unterliegen würden, sofern die Bedürfnisse und Rechte von Kindern und Jugendlichen davon betroffen sind.
Da im Gesetzestext auch nur generelle Rechtsnormen genannt werden und es außerdem die Intention des Gesetzgebers war, einen Kinder- und Jugendanwalt vor allem für die Wahrnehmung der generellen Interessen von Kindern und Jugendlichen zu schaffen, kann man daraus schließen, daß unter sonstigen Rechtsvorschriften generelle Rechtsnormen zu verstehen sind, die nicht Gesetz oder Verordnung sind.
Dies sind einerseits verwaltungsinterne Normen mit generellem Adressatenkreis (Erlässe), die eine Sonderform der Weisung darstellen und andererseits Vereinbarungen im Bundesstaat (Gliedstaatsverträge), die gemäß Art 15a B-VG zwischen Bund und Ländern sowie unter den Ländern über die Angelegenheiten ihres jeweiligen Wirkungsbereiches abgeschlossen werden können und daher bei der Bewältigung von sogenannten Gemeinschaftsaufgaben im Bundesstaat eine besondere Rolle spielen.119 Der Kinder- und Jugendanwalt hat also das Recht außer Gesetzen und Verordnungen auch Erlässe und Gliedstaatsverträge zu begutachten und dazu Stellungnahmen abzugeben.
Im NÖJWG existiert in § 7 Z 6 beinahe wortwörtlich dieselbe Regelung, lediglich die Anregung von Gesetzen, Verordnungen und sonstigen Rechtsvorschriften ist hier noch zusätzlich vorgesehen. Da die Kinder- und Jugendanwaltschaft dort schon seit März 1992 besteht und bereits zwei Tätigkeitsberichte vorliegen, wurde der Versuch unternommen, aus den Berichten zu eruieren, wie das Begutachtungsrecht in der Praxis gehandhabt wird: 1992 und 1993 wurde zu 22 Landesgesetzen und neun Bundesgesetzen120 Stellung genommen.121 1994 nahm die Kinder- und Jugendanwaltschaft zu sieben Landesgesetzen und einem Bundesgesetz Stellung.122 In keinem der beiden Berichte findet sich irgendein Hinweis auf Stellungnahmen zu „sonstigen Rechtsvorschriften“.
In den Landesgesetzen von Wien, Salzburg und Tirol gibt es ebenfalls Bestimmungen, die die Begutachtung von Gesetzen und Verordnungen regeln, von „sonstigen Rechtsvorschriften“ ist dort nicht die Rede.
4.3.2.5. Einbringung der Interessen von Kindern und Jugendlichen
Gemäß § 13b Abs 1 lit d gehört es zu den Aufgaben des Kinder- und Jugendanwaltes, die Interessen der Kinder und Jugendlichen bei Planungs- und Forschungsaufgaben, die auch die Lebensbedingungen der Kinder und Jugendlichen betreffen, einzubringen. Dies bedeutet, daß der Kinder- und Jugendanwalt im Bereich der Landesverwaltung bei derartigen Planungs- und Forschungsaufgaben schon im Projektstadium einbezogen werden soll. Durch die rechtzeitige Einbeziehung schon vor einer allfälligen Verwirklichung können die Interessen von Kindern und Jugendlichen von Anfang an berücksichtigt und Fehlplanungen vermieden werden. Der Kinder- und Jugendanwalt soll also als Sachverständiger für Interessen von Kindern und Jugendlichen gehört und seine Empfehlungen berücksichtigt werden, wobei er im Idealfall von den zuständigen Stellen hinzugezogen wird. Ansonsten besteht für ihn aber auch die Möglichkeit, sich bei Planungs- und Forschungsaufgaben, die auch die Lebensbedingungen von Kindern und Jugendlichen betreffen, hinzuziehen zu lassen, indem er auf seine Rechte und Aufgaben verweist.
4.3.2.6. Koordination verschiedener Aktivitäten
§ 13b Abs 1 lit e bestimmt, daß der Kinder- und Jugendanwalt verschiedene Aktivitäten öffentlicher und freier Jugendwohlfahrtsträger zum Wohle der Kinder und Jugendlichen zu koordinieren hat.
Bedingung für die Wahrnehmung der Koordinationsfunktion ist, daß beim Kinder- und Jugendanwalt, bildlich gesprochen, alle Fäden zusammenlaufen. Das bedeutet, daß er Ansprechpartner für Minderjährige, Eltern, öffentliche und freie Jugendwohlfahrtsträger und kindorientierte Institutionen sein soll.123 Aufgrund der Fülle von Informationen, die er dabei erhält, liegt es auf der Hand, daß er verschiedene Aktivitäten koordiniert, um Überschneidungen zu vermeiden, beziehungsweise sogar initiiert und koordiniert, wie zum Beispiel fachspezifische Veranstaltungen und Arbeitskreise. Durch diese Koordinationsfunktion kann die Arbeit verschiedener Jugendwohlfahrtsträger hoffentlich effizienter gestaltet werden, da der Austausch von Wissen und Erfahrungen sowie die Abstimmung von Aktivitäten aufeinander allen Beteiligten hilfreich ist.
4.3.2.7. Mitarbeit in der Ständigen Konferenz der Kinder- und Jugendanwaltschaften Österreichs
Die Mitarbeit in der Ständigen Konferenz der Kinder- und Jugendanwaltschaften Österreichs ist zwar im StJWG nicht geregelt, sie läßt sich aber unter die allgemeine Bestimmung „Rechte und Interessen von Kindern und Jugendlichen vertreten“ einordnen (Vgl. 4.2.3.1.). Die Ständige Konferenz der Kinder- und Jugendanwaltschaften Österreichs wurde 1993 gegründet, als sich alle damals schon im Amt befindlichen Kinder- und Jugendanwälte mit dem Ziel des Erfahrungsaustausches und der Koordination der Aktivitäten zusammenschlossen.124 Es wurde beschlossen, daß die Kinder- und Jugendanwälte und Kinder- und Jugendanwältinnen aller Bundesländer und der Kinderbeauftragte der Stadt Graz Mitglieder der Ständigen Konferenz sind. Inzwischen hat sich die Ständige Konferenz eine Geschäftsordnung gegeben und formuliert ihre Ziele und Aufgaben folgendermaßen:
„Die Ziele und Aufgaben der Ständigen Konferenz sind:
- Förderung der gemeinsamen Anliegen und Interessen der Kinder- und JugendanwältInnen
- Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendanwaltschaften · Koordination von Aktivitäten
- Erarbeitung von Vorschlägen, Anregungen, Stellungnahmen, insbesondere zu Themen bundesweiter Bedeutung
- Informations- und Erfahrungsaustausch
- Fortbildung der MitarbeiterInnen der Kinder- und Jugendanwaltschaften
- Zusammenarbeit mit Wissenschaft und Forschung
- Zusammenarbeit mit Organisationen, die sich der Anliegen von Kindern und Jugendlichen annehmen
- Internationale Zusammenarbeit“125
Außer der themenbezogenen Arbeit, die 1994/95 insbesondere die Einführung der einheitlichen Telefonnummer 1708 und die Erstellung eines umfassenden Konzepts zu einem Opferschutzgesetz umfaßte, gibt die Kinder- und Jugendanwaltschaft Salzburg im Auftrag der Ständigen Konferenz der Kinder- und Jugendanwaltschaften Österreichs ein Magazin mit dem Titel „Kids & Teens“ heraus. Dieses Magazin erscheint vierteljährlich in einer Auflage von 6000 Stück, mit dem Ziel, die Kinder- und Jugendanwaltschaften mit ihrer Arbeit sowie als Ansprechpartner für kinder- und jugendpolitische Themen in Österreich bekannt zu machen.126
Die Tätigkeit der Ständigen Konferenz der Kinder- und Jugendanwaltschaften Österreichs ist umso wichtiger, als es auf Bundesebene keine Kinder- und Jugendanwaltschaft, die auf einer gesetzlichen Grundlage beruht, gibt.
Es wurde zwar 1991 beim Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie eine Kinder- und Jugendanwaltschaft des Bundes geschaffen, nachdem die Ausführungsgesetze der Länder verspätet erlassen wurden. Allerdings umfaßt der Aufgabenbereich der Kinder- und Jugendanwaltschaft des Bundes die öffentliche Vertretung des Gedankens der gewaltlosen Erziehung, das Hinwirken auf eine kinderfreundliche Gesellschaft, die Zusammenarbeit mit den Kinder- und Jugendanwaltschaften der Länder sowie den Einrichtungen der öffentlichen und freien Jugendwohlfahrt und die Entgegennahme von Beschwerden von Kindern und Jugendlichen sowie deren Erziehungsberechtigten wegen behaupteter Verletzung der Rechte der Kinder und Jugendlichen. Diese Einrichtung ist zwar ein Schritt in die richtige Richtung und als politische Absichtserklärung zu sehen, hat aber den Nachteil, daß sie auf keinerlei gesetzlicher Grundlage beruht, und daher jederzeit wieder abgeschafft werden kann und nicht weisungsfrei ist.127
4.3.3. Besondere Aufgaben
Die besonderen Aufgaben des Kinder- und Jugendanwaltes sind im § 13b Abs 2 StJWG geregelt und sind, im Gegensatz zur generellen Interessensvertretung (§ 13b Abs 1), folgende Formen der Einzelfallhilfe, zu welcher der Kinder- und Jugendanwalt berufen wird:
§ 13b Abs 2 StJWG:
Darüber hinaus hat der Kinder- und Jugendanwalt folgende besondere Aufgaben zur Wahrung des Wohles von Kindern und Jugendlichen:
a) Kinder und Jugendliche, Erziehungsberechtigte und gesetzliche Vertreter in allen Angelegenheiten zu beraten, welche die Stellung der Kinder und Jugendlichen und die Aufgabe der Erziehungsberechtigten betreffen;
b) bei Meinungsverschiedenheiten und Auseinandersetzungen zwischen Erziehungsberechtigten und Kindern und Jugendlichen über die Pflege und Erziehung zu helfen;
c) bei Meinungsverschiedenheiten und Auseinandersetzungen zwischen Erziehungsberechtigten oder Kindern und Jugendlichen einerseits und Behörden oder sonstigen Einrichtungen der Jugendwohlfahrtsbehörde andererseits zu vermitteln und zu beraten;
d) er kann die Organe des Jugendwohlfahrtsträgers befassen, wenn ihm bekannt wird, daß wegen Gefährdung von Kindern und Jugendlichen Maßnahmen der Pflege und Erziehung erforderlich sein könnten. Das befaßte Organ ist verpflichtet, den Kinder- und Jugendanwalt über die getroffenen Maßnahmen zu informieren.
Die Regelungen des § 13b Abs 2 lit a - c überschneiden sich mit den Aufgaben der Kinder- und Jugendanwaltschaft nach § 13 StJWG (Vgl. 4.1.) und entsprechen überdies der gesetzlichen Regelung des § 10 JWG. Wie schon in Kapitel 4.1. geklärt, kann der Kinder- und Jugendanwalt aber auch die Einzelfallhilfe unter besonderen Bedingungen anbieten, da er weisungsfrei ist und anonym und vertraulich in Anspruch genommen werden kann. Nach der Absicht des Gesetzgebers soll der Kinder- und Jugendanwalt diese Aufgaben erst in zweiter Linie wahrnehmen, da es seine eigentliche Aufgabe ist, sich um generelle Angelegenheiten, welche die Stellung des Kindes in der Gesellschaft betreffen, zu kümmern (Vgl. 4.3.2.). Dennoch nimmt die Einzelfallhilfe, wie es Erfahrungen aus anderen Bundesländern zeigen, einen nicht unwesentlichen Platz ein und erfordert überdies ein hohes Maß an Kompetenz in Theorie und Praxis der Einzelfallhilfe (darunter fallen psychologische und pädagogische Kenntnisse, Kommunikationstheorie, Casework als Methode, Moderationstechniken,...). Diese Anforderungen fanden in der Steiermark ihren Niederschlag in den Qualifikationserfordernissen, wie sie in der Stellenausschreibung gefordert wurden. Aus den Erläuterungen zur Regierungsvorlage ist ersichtlich, daß man sich der Problematik, diese Aufgaben zu erfüllen, durchaus bewußt war und daher besonders für diesen Bereich die Inanspruchnahme von externen Fachkräften vorsah.128 Allen besonderen Aufgaben gemeinsam ist, daß sie zur „Wahrung des Wohles von Kindern und Jugendlichen“ zu erfolgen haben.
4.3.3.1. Beratung bezüglich der Stellung von Kindern und die Aufgaben der Erziehungsberechtigten
Gemäß § 13b Abs 2 lit a StJWG hat der Kinder- und Jugendanwalt Kinder und Jugendliche, Erziehungsberechtigte und gesetzliche Vertreter in allen Angelegenheiten zu beraten, welche die Stellung der Kinder und Jugendlichen und die Aufgabe der Erziehungsberechtigten betreffen. Diese Form der Beratung hat vor allem das Ziel, über die (Rechts-)Stellung von Kindern und Jugendlichen aufzuklären, Informationen über die Aufgaben der Eltern zu erteilen und bei Spezialfragen, die der Kinder- und Jugendanwalt nicht sofort beantworten kann, Informationen zu geben, wer in solchen Fällen weiterhelfen kann.
Um diese Aufgabe zu erfüllen, muß der Kinder- und Jugendanwalt jedenfalls umfassende Kenntnisse auf dem Gebiet des Familienrechts haben, weiters sind Kenntnisse in den Gebieten Erbrecht, Strafrecht, Jugendstrafrecht, Jugendschutz, Jugendwohlfahrtsrecht und soziale Infrastruktur nötig.
4.3.3.2. Hilfe bei Meinungsverschiedenheiten zwischen Kindern und Erziehungsberechtigten
In vielen Fällen ist in der Einzelfallhilfe die Rechtsauskunft zuwenig. Vielmehr wird es der Regelfall sein, daß sich Einzelpersonen dann an den Kinder- und Jugendanwalt wenden, wenn sie sich in ihren subjektiven Rechten verletzt fühlen oder Hilfe aus anderen Gründen suchen. Daher greifen hier die Regelungen des § 13b Abs 2 lit b und c, die dem Kinder- und Jugendanwalt die Aufgabe übertragen, bei Meinungsverschiedenheiten zu helfen und zu vermitteln. § 13b Abs 2 lit b regelt die Hilfe bei Meinungsverschiedenheiten und Auseinandersetzungen zwischen Erziehungsberechtigten und Kindern und Jugendlichen über die Pflege und Erziehung. Beratung in diesem Bereich ist eigentlich Familienberatung und sollte am Standard und an den Methoden von Familienberatungsstellen gemessen werden.
Die eigentliche Beratung wird der Kinder- und Jugendanwalt kaum übernehmen können, da es ihm hierzu einerseits an Zeit fehlen wird, da er ja sehr umfassende Aufgaben hat und Familienberatung oft über mehrere Monate hin regelmäßig nötig ist, bis eine zufriedenstellende Veränderung im System erreicht werden kann. Andererseits wird er auch nicht für jeden derartigen Fall eine externe Fachkraft in Anspruch nehmen können, die diese Beratung übernimmt. Außerdem ist der Kreis derer, die in seine Beratungskompetenz fallen, eingeschränkt und daher ein Hindernis, mit einem Familiensystem zu arbeiten. Schließlich hat der Kinder- und Jugendanwalt ja nur Kinder und Jugendliche sowie deren Erziehungsberechtigte zu beraten, was bedeutet, daß andere Personen (ZB. Lebensgefährten der Erziehungsberechtigten) von dieser Beratungskompetenz nicht erfaßt sind, was schon bei der entsprechenden Regelung des Grundsatzgesetzes kritisiert wurde.129
Seine Aufgabe wird es daher vor allem sein, die Situation, in der sich Ratsuchende befinden, abzuschätzen und sie dann an geeignete Beratungsstellen zu vermitteln.
4.3.3.3.Vermittlung bei Meinungsverschiedenheiten zwischen Erziehungsberechtigten oder Kindern und Jugendlichen einerseits und Behörden andererseits
Die Vermittlung bei Meinungsverschiedenheiten und Auseinandersetzungen zwischen Erziehungsberechtigten oder Kindern und Jugendlichen einerseits und Behörden oder sonstigen Einrichtungen der Jugendwohlfahrtsbehörde andererseits, wie sie in § 13b Abs 2 lit c festgelegt wird, berührt ein sehr sensibles Thema. Diese Regelung befindet sich in einem Spannungsverhältnis zwischen der Vermittlungsaufgabe und der Absicht des Gesetzgebers, weder ein „übergeordnetes Jugendamt“ noch ein „Kontrollorgan“ der Verwaltung zu schaffen.130 Der Kinder- und Jugendanwalt wird nur äußerst schwer eine neutrale Vermittlerposition einnehmen können, da er allzu leicht in Verdacht kommen wird, die Interessen dessen, der ihn hinzuzog, zu vertreten. Sollte er von Kindern, Jugendlichen oder deren
Erziehungsberechtigten um Hilfe ersucht worden sein, kann sich der Organwalter, der in diesen Konflikt verwickelt ist, nur allzu leicht kontrolliert fühlen. Im umgekehrten Fall könnten Kinder, Jugendliche und Erziehungsberechtigte annehmen,. daß der Kinder- und Jugendanwalt die Jugendwohlfahrtsbehörde unterstützt. Vermittlung kann aber nur unter der Bedingung der Neutralität und ohne Machtverhältnisse, wie sie einem Kontrollorgan immanent sind, erfolgreich sein. Diese Bestimmung zeigt auch, wie wichtig es ist, daß das Büro des Kinder- und Jugendanwaltes von anderen Ämtern und Behörden räumlich getrennt ist, um auch durch diese Trennung die Unabhängigkeit des Kinder- und Jugendanwaltes ersichtlich zu machen, die ihn zur Übernahme einer Vermittlerrolle befähigt.
4.3.3.4. Befassung von Organen des Jugendwohlfahrtsträgers
§ 13b Abs 2 lit d besagt, daß der Kinder- und Jugendanwalt die Organe des Jugendwohlfahrtsträgers befassen kann, wenn ihm bekannt wird, daß wegen Gefährdung von Kindern und Jugendlichen Maßnahmen der Pflege und Erziehung erforderlich sein könnten. Das befaßte Organ ist verpflichtet, den Kinder- und Jugendanwalt über die getroffenen Maßnahmen zu informieren. Hier zeigt sich wieder eine Ausformung des zentralen Anliegens des Jugendwohlfahrtsrechts, das Kindeswohl zu schützen. Wenn das Kindeswohl gefährdet ist und Maßnahmen (geregelt vor allem in §§ 35ff StJWG „Hilfen zur Erziehung“) erforderlich sein könnten, liegt es im Ermessen des Kinder- und Jugendanwaltes, die Organe des Jugendwohlfahrtsträgers zu befassen. Die Pflicht des befaßten Organs, den Kinder- und Jugendanwalt über die getroffenen Maßnahmen zu informieren, verstärkt seine Schutzfunktion. Der Kinder- und Jugendanwalt ist aber nicht verpflichtet, immer die Organe des Jugendwohlfahrtsträgers zu befassen, was ja der Möglichkeit, ihn vertraulich in Anspruch zu nehmen, widersprechen würde.
4.3.4. Das Recht auf Akteneinsicht
Gemäß § 13b Abs 3 hat der Kinder- und Jugendanwalt in Erfüllung der Aufgaben des § 13b Abs 2 das Recht auf Akteneinsicht. Daraus läßt sich schließen, daß dem Kinder- und Jugendanwalt weder in Erfüllung der Aufgabe des § 13a Abs 1, „die Rechte und Interessen von Kindern zu vertreten“ dieses Recht zukommt, noch bei der Erweiterung seines Aufgabenkreises (Vgl. 4.3.2.1.). Ebensowenig hat er das Recht der Akteneinsicht in Erfüllung der Aufgaben des § 13b Abs 1, was vor allem bei Erfüllung der Aufgabe, die Interessen von Kindern und Jugendlichen bei Planungs- und Forschungsaufgaben einzubringen (§ 13b Abs 1 lit d), von Bedeutung wäre. Allerdings wäre es auch verfassungsrechtlich bedenklich, wenn ihm dort das Recht auf Akteneinsicht zukäme, da ihm dieses Recht dann auch beispielsweise in einem laufenden Planungsverfahren zustünde. Dies käme der Schaffung einer beschränkten Parteistellung gleich, was vom Parteibegriff des AVG abweicht und nur im Rahmen des Art 11 Abs 2 B-VG zulässig ist131, nämlich bei Erforderlichkeit einer abweichenden Regelung, wofür sich im Fall des Kinder- und Jugendanwaltes jedoch kaum ein Anhaltspunkt ergibt.132
Von den Aufgaben des § 13b Abs 2, wo dem Kinder- und Jugendanwalt das Recht auf Akteneinsicht zukommt, wird dies vor allem bei Erfüllung der Vermittlungsaufgabe zwischen Behörden sowie Kindern und Jugendlichen und Erziehungsberechtigten (§ 13b Abs 2 lit c), relevant sein. Sollte der Kinder- und Jugendanwalt das Recht auf Akteneinsicht auch im Fall des §13b Abs 2 lit d nach der Befassung der Organe des Jugendwohlfahrtsträgers anwenden, kann er damit eine Kontrollfunktion ausüben, die ihm rechtlich zusteht, aber nicht in der Absicht des Gesetzgebers lag (Vgl. 4.3.2.3.)133
Das Recht des Kinder- und Jugendanwaltes auf Akteneinsicht besteht noch im § 26 Abs 7 Vlbg L-JWG und in der § 14 Abs 3 lit b Salzburger JWO. Dabei ist dem Vorarlberger Kinder- und Jugendanwalt von den mit den Aufgaben der Jugendwohlfahrt befaßten Behörden und Einrichtungen die erforderliche Akteneinsicht zu gewähren. Die Salzburger Regelung verweist auf § 17 AVG und läßt der Salzburger Kinder- und Jugendanwaltschaft das Recht auf Akteneinsicht in jenen Verwaltungsverfahren zukommen, die aufgrund landesgesetzlicher Vorschriften durchzuführen sind und die Interessen von Kindern und Jugendlichen betreffen.
Dies ist wegen der hier geschaffenen „beschränkten Parteistellung“ ebenfalls verfassungsrechtlich bedenklich, da eine Abweichung vom Parteibegriff - wie bereits ausgeführt - nur im Rahmen des Art 11 Abs 2 B-VG zulässig ist.134
4.3.5. Auskunftspflicht der Organe des Landes und der Gemeinden
Gemäß § 13a Abs 4 haben alle Organe des Landes und der Gemeinden den Kinder- und Jugendanwalt bei der Besorgung seiner Aufgaben zu unterstützen und auf Verlangen die erforderlichen Auskünfte zu erteilen.
Im Gegensatz zum Recht auf Akteneinsicht ist die Auskunftspflicht nicht eingeschränkt, sondern gilt in Besorgung aller Aufgaben des Kinder- und Jugendanwaltes. Die Auskunftspflicht ist auch nicht auf mit Aufgaben der Jugendwohlfahrt befaßte Behörden beschränkt (wie zum Beispiel im Vlbg L- JWG § 26 Abs 7), sondern umfaßt alle Organe des Landes und der Gemeinden. Es ist fraglich, ob nicht die Amtshilfepflicht des Art 22 B-VG, die besagt, daß alle Organe des Bundes, der Länder und der Gemeinden im Rahmen ihres gesetzmäßigen Wirkungsbereiches zur wechselseitigen Hilfeleistung verpflichtet sind, dieselbe Funktion erfüllt, ja möglicherweise sogar über die Regelung des § 13a Abs 4 hinausgeht, da dort ja nur Landes- und Gemeindeorgane verpflichtet werden.
Da der Kinder- und Jugendanwalt organisatorisch der Landesregierung unterstellt ist, kann er sich zur Erlangung von Auskünften und Unterstützung auf die Amtshilfepflicht berufen.135
Weitergehende Regelungen bezüglich der Auskunftspflicht bestehen in den Landesgesetzen von Wien, Niederösterreich und Oberösterreich. Am weitesten geht dabei die Regelung des § 10 Abs 8 WrJWG, wo die Wiener Landes- und Gemeindebehörden sowie die Träger der freien Jugendwohlfahrt zur Unterstützung und Auskunftserteilung den Kinder- und Jugendanwälten gegenüber verpflichtet werden.
Eingeschränkt ist die Pflicht zur Unterstützung und Auskunftserteilung nur dadurch, daß sie zur Erfüllung der Aufgaben der Kinder- und Jugendanwälte notwendig und erforderlich sein müssen. Gleichzeitig wird in § 10 Abs 8
2.Satz festgelegt, daß in diesen Angelegenheiten gesetzliche Verschwiegenheitspflichten gegenüber den Kinder- und Jugendanwälten nicht wirksam sind.
5. Erste Erfahrungen und politische Forderungen des steiermärkischen Kinderund Jugendanwaltes
5.1. Erste Erfahrungen
Der steiermärkische Kinder- und Jugendanwalt nahm am 1.2.1995 seine Arbeit auf. Als Mitarbeiterinnen stehen ihm eine Sekretärin und eine Pädagogin beziehungsweise Konfliktreglerin zur Seite.136 Das Büro befindet sich in der Stempfergasse 8/3 in Graz. Für heuer steht ein Budget von ÖS 630.000.- zur Verfügung. Dieser Betrag beinhaltet sämtlichen Sach- und Büroaufwand. Bis zu einem Rechnungsbetrag von ÖS 5000.- kann der Kinder- und Jugendanwalt Anschaffungen in Eigenverantwortung tätigen.
In inhaltlicher Hinsicht zeigten erste Erfahrungen, daß die Bezeichnung „Anwalt“ bei Ratsuchenden Bedarf und hohe Erwartungen weckt. Es stellte sich heraus, „...daß der Kinder- und Jugendanwalt kraft seiner gesetzlichen Kompetenz gerade in jenen Situationen angerufen wird, in welchen eine Konfliktlösung durch andere Einrichtungen entweder fehlgeschlagen oder auch nicht möglich ist.“137
Das erste Arbeitsjahr war bestimmt durch die Positionierung des Kinder- und Jugendanwaltes und die Schwerpunktsetzung. In diesem Zeitraum hat der Kinder- und Jugendanwalt 576 Einzelfälle bearbeitet, die im Schnitt ca. 3 Kontakte erforderten. Die häufigsten Anlässe für die Inanspruchnahme des Kinder- und Jugendanwaltes waren Probleme im Zusammenhang mit Scheidungssituationen und Besuchsrechtsregelungen, gefolgt von gewalttätigen Übergriffen innerhalb der Familie (Mißhandlung, sexueller Mißbrauch), schulische Schwierigkeiten, allgemeine Rechtsfragen und strafrechtliche Belange, Konflikte zwischen Eltern und Kindern allgemeiner Natur, sowie Kinderbetreuung und Fremdunterbringung von Kindern.138 Manchmal reichte schon eine telefonische Auskunft; andere Fälle gestalteten sich sehr arbeitsintensiv. Der Kinder- und Jugendanwalt hielt in den Bezirken Sprechtage ab, wobei er auch in verschiedene Schulen ging und dort seine Aufgaben den Kindern und Jugendlichen vorstellte.
5.2. Die Arbeitsschwerpunkte
Auf Grund der Fülle der Aufgaben verbunden mit geringer Personalausstattung war es für den Kinder- und Jugendanwalt unumgänglich, Arbeitsschwerpunkte zu definieren. Andernfalls wäre effiziente Arbeit nicht möglich gewesen. Er setzte sich dabei vor allem folgende Arbeitsschwerpunkte:
- Einzelfallarbeit (Aufgaben nach § 13b Abs 2 StJWG)
- Koordination und Vernetzung (Aufgabe nach § 13 b Abs 1 lit e StJWG), durch Mitarbeit, Leitung und Initiierung verschiedener Arbeitskreise
- Novelle des steiermärkischen Jugendschutzgesetzes (Leitung eines Arbeitskreises, der Vorschläge für eine Novellierung macht)
- Öffentlichkeitsarbeit (durch Presseaussendungen, Erstellung von
Informationsmaterial, themenorientierte Multiplikatorenarbeit...)
Weiters entwickelte der Kinder- und Jugendanwalt ein Arbeitskonzept mit den Schwerpunkten: Klientenzentrierte Einzelfallarbeit, Themenorientierte Multiplikatorenarbeit, Öffentlichkeitsarbeit, Gemeinwesenarbeit, Gesetzesbegutachtung.139
Der Kinder- und Jugendanwalt ist auch Mitherausgeber eines Buches zum Themenbereich „Kindsein in der Steiermark“.140 Außerdem arbeitet der Kinder- und Jugendanwalt auf Bundesebene in der Ständigen Konferenz der Kinder- und Jugendanwaltschaften Österreichs mit.
5.3. Politische Forderungen des steiermärkischen Kinder- und Jugendanwaltes
Nach einem Jahr Tätigkeit und den dabei gemachten Erfahrungen hat der Kinder-und Jugendanwalt eine Anzahl von Forderungen, Verbesserungsvorschlägen und Visionen, welche die Ausgestaltung seiner Funktion und/oder eine Verbesserung der Rechte von Kindern bringen würden. Die Erfüllung seiner Forderungen ist zum einen Teil notwendig, um seine Aufgaben zu erfüllen (Personalausstattung), zum anderen Teil wäre es zur Erfüllung seiner jetzigen Aufgaben nicht unmittelbar notwendig, würde aber eine Erweiterung seiner Möglichkeiten und Befugnisse bringen (Parteistellung, Weisungsfreiheit). Drittens würden seine Forderungen eine Verbesserung der Rechtsstellung von Kindern bewirken (Rechtsvertretung in Gerichtsverfahren).141
5.3.1. Verbesserung der Personalausstattung
Die größte Schwierigkeit, mit welcher der Kinder- und Jugendanwalt zu kämpfen hat, ist die mangelnde Personalausstattung. Es ist ihm nicht möglich, mit den vorhandenen Ressourcen alle ihm durch das StJWG gestellten Aufgaben zu erfüllen. Er kann daher nur einzelne Aufgabenbereiche (Vgl.5.1.) unter Vernachlässigung anderer Aufgabenbereiche bearbeiten. Es ist ihm zwar aufgrund seiner Möglichkeit, Schwerpunkte zu setzen, gestattet, einzelne Aufgabenbereiche intensiver als andere wahrzunehmen, wenn die Wahrnehmung einzelner Aufgaben aber aufgrund mangelnder Personalausstattung bedingt, daß andere Aufgaben aus dem gesetzlichen Aufgabenkatalog nicht mehr wahrgenommen werden können, besteht die Gefahr, daß die diesbezüglichen, sehr ambitionierten Regelungen des StJWG zu einer politischen Absichtserklärung verkommen. Um die Mangelhaftigkeit der Personalausstattung zu dokumentieren, soll hier die Personalausstattung der Steiermark und von Salzburg (da die Personalausstattung einerseits als vorbildlich gelten kann; andererseits in der Salzburger JWO ein ähnlich umfassender Aufgabenbereich vorgesehen ist) sowie die Zahl der Minderjährigen in diesen beiden Bundesländern gegenübergestellt werden:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten142
Daraus ist ersichtlich, daß in Salzburg für weniger als die Hälfte der Kinder das doppelte an Personal zur Verfügung steht. Dies wirkt sich für den steiermärkischen Kinder- und Jugendanwalt vor allem durch eine Überlastung bei der Einzelfallbearbeitung aus, weshalb er eine Personalaufstockung auf wenigstens vier volle Dienstposten fordert.
5.3.2. Parteistellung im Verwaltungsverfahren
Wie bereits in Kapitel 2.3.3. erwähnt, gibt es in einzelnen Landesgesetzen, nämlich in Salzburg und Niederösterreich, Regelungen, die dem Kinder- und Jugendanwalt in bestimmten Verfahren Parteistellung einräumen. Grundsätzlich ist die Begründung der Parteistellung eine Angelegenheit des materiellen Rechts und hat durch den zur Regelung der Sachmaterie zuständigen Gesetzgeber zu erfolgen, weshalb der Landesgesetzgeber grundsätzlich befugt ist, dem Kinder- und Jugendanwalt die Parteistellung einzuräumen, allerdings nur für Verfahren aufgrund von Landesgesetzen.143 Mit der Parteistellung nach § 8 AVG sind folgende Rechte verbunden: Akteneinsicht (§17 AVG), Gehör (§§ 37, 43 Abs 2 u 3, § 45 Abs 3 § 65 AVG), Ablehnung eines nichtamtlichen Sachverständigen (§ 53 Abs 1 AVG), Verkündung oder Zustellung des Bescheids (§ 62 Abs 2 u 3 AVG), Erhebung ordentlicher Rechtsmittel (§§ 57, 63 AVG), Erhebung außerordentlicher Rechtsmittel (§§ 69, 70 AVG) und Geltendmachung der Entscheidungspflicht (§ 73 AVG).144
Im NÖJWG wird der Kinder- und Jugendanwaltschaft in § 8 Abs 1 zugesprochen, Parteistellung in Verfahren nach dem NÖJWG zu beanspruchen, soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist. In der Salzburger JWO wird der Kinder- und Jugendanwaltschaft in § 14 Abs 3 zugestanden, Parteistellung in Verwaltungsverfahren aufgrund der Salzburger JWO, des Salzburger Tagesbetreuungsgesetzes, oder aufgrund landesgesetzlicher Vorschriften über folgende Vorhaben zu beanspruchen, soweit dies zur Erfüllung der Aufgaben erforderlich ist:
§ 14 Abs 3 lit a Z 1 - 3 Salzburger JWO
1. Errichtung und wesentliche Änderung von Bauten, die überwiegend von Kindern und Jugendlichen in größerer Zahl benützt werden oder benützt werden sollen, wie ZB. Kinder- und Jugendheime;
2. Errichtung oder Erweiterung eines Privatkindergartens;
3. Errichtung, Betrieb oder wesentliche Änderung von
Krankenanstalten
Würde dem steiermärkischen Kinder- und Jugendanwalt die Parteistellung wie in Salzburg bei den oben genannten Vorhaben eingeräumt, brächte dies eine Verbesserung seiner Stellung. Er hätte dann nicht nur das Recht, bei Planungs- und Forschungsaufgaben, die auch die Lebensbedingungen von Kindern und Jugendlichen betreffen (§ 13b Abs 1 lit d StJWG), mitzuwirken, sondern er hätte auch in einem wesentlichen Bereich der Verwirklichung konkreter Projekte Verfahrensrechte.
5.3.3. Möglichkeit der Bescheidbeschwerde
Mit der Parteistellung steht auch die Möglichkeit eine Bescheidbeschwerde beim VwGH gemäß Art 131 Abs 1 B-VG zu erheben in Zusammenhang. Im NÖJWG ist dies im § 8 Abs 2 geregelt, wonach der Kinder- und Jugendanwaltschaft, soweit ihr Parteistellung zukommt, das Recht der Bescheidbeschwerde gemäß Art 131 Abs 2 B-VG zusteht. In der Salzburger JWO gibt es dazu keine Regelung. Zur Frage, ob die Salzburger Kinder- und Jugendanwaltschaft durch die Einräumung eines Rechts auf Parteistellung befugt ist, eine Bescheidbeschwerde gemäß Art 131 Abs 1 B- VG zu erheben, stellt Roth unter Berufung auf ein unveröffentlichtes Gutachten von Berka zu diesem Thema fest:
„Nach der Rechtsprechung des VwGH gibt die gesetzliche Zuerkennung einer Parteistellung im Verwaltungsverfahren der Organpartei nur die Berechtigung, eine Beschwerde an den VwGH wegen Verletzung der ihr zustehenden Verfahrensrechte zu erheben. Mangels eigener subjektiver Rechte besteht hingegen keine Beschwerdeberechtigung zur Durchsetzung materieller Rechtspositionen.“145
Analog dazu hätte der steiermärkische Kinder- und Jugendanwalt, selbst wenn ihm Parteistellung in bestimmten Verwaltungsverfahren eingeräumt würde, als Organpartei nicht die Möglichkeit eine Bescheidbeschwerde gemäß Art 131 Abs 1 B-VG zur Durchsetzung materieller Rechtspositionen zu erheben.
Um dem steiermärkischen Kinder- und Jugendanwalt die Möglichkeit der Bescheidbeschwerde einzuräumen, müßte also eine Regelung, vergleichbar mit § 8 Abs 2 NÖJWG erlassen werden, mit der dem Kinder- und Jugendanwalt für die Verfahren, in denen ihm Parteistellung zukommt, auch die Möglichkeit der Bescheidbeschwerde gemäß Art 131 Abs 2 B-VG eingeräumt wird (sog. Amtsbeschwerde zur Wahrung objektiven Rechts).
5.3.4. Probleme im Bereich Weisungsgebundenheit - Weisungsfreistellung
Zu welchen Problemen die Weisungsfreistellung nur in Erfüllung der Aufgaben bei gleichzeitiger Weisungsgebundenheit in dienstrechtlicher und organisatorischer Hinsicht führen kann, wurde bereits anhand eines Beispiels aus dem Tätigkeitsbericht der oberösterreichischen Kinder- und Jugendanwaltschaft aufgezeigt ( Vgl. 4.3.1.4.). Aus diesem Grund ist auch die Einführung der Weisungsfreistellung im organisatorischen Bereich ein Vorschlag des Kinder- und Jugendanwaltes.
Schwerer wiegt aber, daß der Kinder- und Jugendanwalt zwar gemäß § 13a Abs 3 mittels Verfassungsbestimmung bei der Erfüllung seiner Aufgaben an keine Weisungen gebunden ist, aber keine Regelung existiert, die sich auf seine Mitarbeiter bezieht. Dies läßt den Schluß zu, daß seine Mitarbeiter voll der Weisungsgebundenheit unterliegen. Somit könnten vorgesetzte Organe des Landes direkt in die inhaltliche Arbeit der Mitarbeiter des Kinder- und Jugendanwaltes eingreifen. Aus diesem Grund besteht die Forderung nach einer Regelung, die inhaltlich beispielsweise der Regelung des Tiroler Jugendwohlfahrtsgesetzes entspricht:
§ 6a Abs 11 Tiroler JWG:
(Landesverfassungsbestimmung) Der Kinder- und Jugendanwalt ist bei der Besorgung seiner Aufgaben nach den Abs 9 und 10 an keine Weisungen gebunden. Gegenüber den beim Kinder- und Jugendanwalt verwendeten Bediensteten ist hinsichtlich der Besorgung der Aufgaben nach den Abs 9 und 10 ausschließlich der Kinder- und Jugendanwalt weisungsberechtigt.
5.3.5. Rechtsvertretung von Kindern im Gerichtsverfahren
Da in Obsorge- und Besuchsrechtsstreitigkeiten im Rahmen von Scheidungen, aber auch in anderen Verfahren die Kinder betreffen, auf die Interessen von Kindern und Jugendlichen nicht ausreichend Rücksicht genommen wird, fordert der Kinder- und Jugendanwalt, eine Aufwertung von Kindern und Jugendlichen in solchen Verfahren vorzunehmen. Derzeit sind diese Verfahren seiner Ansicht nach durch überlange Dauer, Konfliktverschärfung und eine destruktiv, lebensfremde und kinderfeindliche Spruchpraxis charakterisiert, da Kinder sich den Interessen der Eltern unterzuordnen haben und von Mitbestimmung ausgeschlossen sind. Aus diesem Grund ist die Anpassung der Gesetzeslage an die UN-Konvention über die Rechte des Kindes notwendig:
„Zu diesem Zweck ist eine Aufwertung von Kindern und Jugendlichen von Objekten zu Subjekten des Verfahrens vorzunehmen, sodaß diese in all jenen Verfahren, die ihre unmittelbaren Lebensinteressen betreffen Parteistellung erhalten.
Entsprechend dem Alter und dem Reifegrad wäre sowohl die Eigenvertretung als auch eine Vertretung durch entsprechend ausgebildete unabhängige Verfahrenshelfer denkbar. Damit wäre nicht nur im Ehescheidungs- und Besuchrechtsverfahren, sondern auch im Strafverfahren nach Mißhandlungen und sexuellen Übergriffen eine kinder- und jugendgerechte Unterstützung als notwendige Ergänzung bereits bestehender Angebote gewährleistet.“146
6. Resümee
Mit den Regelungen der Landes-Jugendwohlfahrtsgesetze im Allgemeinen und den steiermärkischen Regelungen im Besonderen wurde eine Form der institutionalisierten Vertretung der Interessen von Kindern und Jugendlichen geschaffen, die auch im internationalen Vergleich als vorbildlich gelten kann. Lediglich auf Bundesebene besteht noch politischer Handlungsbedarf, eine Regelung zu schaffen, die eine, mit den Möglichkeiten der Kinder- und Jugendanwälte in den Bundesländern vergleichbare Institutionalisierung der Interessensvertretung von Kindern und Jugendlichen für den Kompetenzbereich des Bundes bringt.
Die gesetzlichen Bestimmungen im Steiermärkischen Jugendwohlfahrtsgesetz, stehen den, so oft als vorbildlich bezeichneten Regelungen in der Salzburger Jugendwohlfahrtsordnung147, was die Vielfalt der Aufgaben betrifft, um nichts nach. Der größte Unterschied bei den gesetzlichen Bestimmungen der beiden Bundesländer liegt in der Parteistellung im Verwaltungsverfahren aufgrund von bestimmten Landesgesetzen, die der Salzburger Kinder- und Jugendanwaltschaft zugestanden wurden, nicht aber dem Steiermärkischen Kinder- und Jugendanwalt.
Problematischer ist in der Steiermark die konkrete Umsetzung der gesetzlichen Bestimmungen, da wegen der mangelnden Personalausstattung viele Aufgaben nicht zufriedenstellend wahrgenommen werden können. So droht ein ehrgeiziges und, auch im Vergleich mit den meisten Jugendwohlfahrtsgesetzen der anderen Bundesländer weitreichendes Regelungswerk, wegen zwei bis drei fehlender Dienstposten nur teilweise umgesetzt zu werden. Verständlicherweise ist es in Zeiten des Sparens und des Versuches, im Verwaltungsbereich Dienstposten abzubauen nicht gerade erfolgversprechend, für den Kinder- und Jugendanwalt eine bessere Personalausstattung zu fordern, auch wenn ohne die Verbesserung der Personalausstattung die gesetzlichen Bestimmungen der §§ 13a und 13b StJWG relativiert werden. Der politische Wille hat in der Steiermark zwar zu einer umfassenden Regelung im StJWG gereicht, nicht aber soweit, auch Bedingungen zu schaffen, die eine ebenso umfassende Erfüllung der Aufgaben ermöglichen würden.
Die Forderungen des Steiermärkischen Kinder- und Jugendanwaltes, welche die Ausgestaltung seiner Funktion betreffen (Parteistellung im Verwaltungsverfahren, Bescheidbeschwerde, Weisungsfreistellung) sind, wie bereits bestehende Regelungen in anderen Landesgesetzen zeigen, nach entsprechender politischer Willensbildung verwirklichbar und würden auch eine Aufwertung seiner Funktion bringen, selbst wenn die Verwirklichung seiner Forderungen nicht Bedingung für die zukünftige Verwirklichung seiner Aufgaben ist.
Der Steiermärkische Kinder- und Jugendanwalt hat durch seinen Auftrag, vor allem auf der gesellschaftspolitischen Ebene zu wirken, die Möglichkeit, an einer Sensibilisierung der Öffentlichkeit und der Politik für Rechte und Interessen von Kindern und Jugendlichen und für Anliegen des Kinderschutzes maßgeblich mitzuwirken. Letztlich kann eine Verbesserung der Stellung von Kindern und Jugendlichen in allen gesellschaftlichen Bereichen nicht allein durch Gesetze, sondern nur in Verbindung mit einer entsprechenden Änderung des Verhaltens gegenüber Kindern und Jugendlichen soziale Realität werden. Der Kinder- und Jugendanwalt soll einerseits auf die Abschaffung von bestehenden Mißständen drängen und im Einzelfall helfen. Andererseits sollen seine Forderungen, Anregungen und Empfehlungen auch in die Zukunft weisen und Vorschläge in die öffentliche Diskussion einbringen, die zwar der parteilichen Vertretung der Interessen von Kindern und Jugendlichen gerecht werden, nicht aber zwangsläufig in kurzer Zeit umgesetzt werden können, weil kein breiter Konsens darüber besteht. Hier wäre zum Beispiel die Forderung nach Rechtsvertretung von Kindern im Gerichtsverfahren zu nennen (Vgl. 5.3.5.).
Literaturverzeichnis:
ADAMOVICH/FUNK, Allgemeines Verwaltungsrecht [3] ,1987 ARIES, Geschichte der Kindheit, 1978
ARNOLD/WÜSTENDÖRFER, Kinderbeauftragte auf kommunaler Ebene Arbeitsschwerpunkte und Organisationsmodelle, Sozialmagazin 2/1995, 18ff
BERKA, Zur Weisungsbindung des Salzburger Jugendwohlfahrtsbeirates, 1995 (Rechtsgutachten)
BRAMBÖCK/HUTTER/HAGEN/PAUMGARTNER, Wege zum kinderzentrierten Verfahren - vom Verfahrensobjekt zum Verfahrenssubjekt, in: BMUJF (Hrsg.), Expertenbericht zum UN-Übereinkommen über die Rechte des Kindes 1993, 132ff
BRAUCHLI, Das Kindeswohl als Maxime des Rechts, 1982 ENT-FRISCHENGRUBER, Jugendwohlfahrtsrecht, 1992
HASLINGER, Bewirkt die UN-Konvention über die Rechte des Kindes einen neuen völkerrechtlichen oder menschenrechtlichen Status des Kindes in Österreich? in: BMUJF (Hrsg.), Expertenbericht zum UN- Übereinkommen über die Rechte des Kindes 1993, 18ff
HASLINGER, Die völkerrechtliche Stellung des Kindes in Österreich, in: Lehner (Hrsg.), Kinder- und Jugendrecht 1993, 327ff
JÄGER, Was können die Kinder- und Jugendanwaltschaften leisten?, in: BMUJF (Hrsg.), Expertenbericht zum UN Übereinkommen über die Rechte des Kindes 1993, 185ff
KOZIOL-WELSER, Bürgerliches Recht [10] II, 1996
LUTHIN, Anmerkung zur Entscheidung des Amtsgerichtes Mönchengladbach- Rheydt vom 23.11.1985, FamRZ 1986, 391
MOTTL, Das Kind: Rechtssubjekt oder nur Spielball familiärer Auseinandersetzungen, in: BMUJF (Hrsg.), Expertenbericht zum UN- Übereinkommen über die Rechte des Kindes 1993, 87ff
PAUMGARTNER, Das Salzburger Modell, Kinder- und Jugendanwaltschaft in Salzburg, in: Sozialarbeit in Österreich, 28.Jg. Nr. 100, 1993, 38f
PAUMGARTNER, Die rechtliche Betreuung des Kindes, in: Salzburg Diskussion 1991, 36ff
PICHLER, Internationale und nationale Entwicklungen der Rechte des Kindes, in: Salzburg Diskussion 1991, 19ff
POSTMAN, Das Verschwinden der Kindheit, 1983
PROHASKA, Die Neuorientierung des Jugendwohlfahrtsrechts, ÖAV 1981, 5ff PRÓNAY, Das Bild des Kindes und seine Auswirkungen auf die Rechtsordnung, in: Österreichische Juristenkommission (Hrsg.), Kritik und Fortschritt im Rechtsstaat 18.Tagung der österreichischen Juristenkommission von 9. bis 11. Mai 1991, 1994, 53ff
PRÓNAY, Der Kinder- und Jugendanwalt, in: Lehner (Hrsg.), Kinder- und Jugendrecht 1993, 349ff
RAGGER, Jugendwohlfahrtsrecht und Verfassungsgerichtshof, Graz 1994 (Diplomarbeit)
ROSENMAYR, Anmerkungen zu den Grundrechten Minderjähriger, in: Österreichische Juristenkommission (Hrsg.), Kritik und Fortschritt im Rechtsstaat. 18.Tagung der österreichischen Juristenkommission von 9. bis 11. Mai 1991, 1994, 35ff
ROTH, Der Kinder- und Jugendanwalt - Eine neue Einrichtung im Dienste des Kinderschutzes in Österreich, Graz 1993 (Diplomarbeit)
SALGO, Die Funktion eines Kinder- und Jugendbeauftragten im internationalen Vergleich, in: Materialien zur Heimerziehung 4/1990, 4ff
SALGO, Der Anwalt des Kindes. Die Vertretung von Kindern in zivilrechtlichen Kindesschutzverfahren. Eine vergleichende Studie, 1996
SCHWARZ/LÖSCHNIGG, Arbeitsrecht [5] , 1995
SELLITSCH, Arbeitskonzept des „Kinder- und Jugendanwaltes“ für das Bundesland Steiermark, 1995
SELLITSCH, Kinder- und Jugendanwalt - Die Interessensvertretung für Kinder und Jugendliche ist gefragt, Eine Zwischenbilanz nach 100 Tagen, 1995 (Presseaussendung)
SELLITSCH, Rechtsvertretung in Gerichtsverfahren, in: Steirische Plattform für eine kinderfreundliche Gesellschaft & Kinder- und Jugendanwalt der Steiermark (Hrsg), Buntbuch Kinder in der Steiermark, Ideen und Informationen für eine kinderfreundliche Gesellschaft, 1996 SIMITIS/ZENZ, Familie und Familienrecht I, 1975
STEINDORFF, Der Kinder- und Jugendanwalt in Frankreich - eine Idee auf dem Vormarsch, in: Salgo, Der Anwalt des Kindes. Die Vertretung von Kindern in zivilrechtlichen Kindesschutzverfahren - eine vergleichende Studie, 1993, 184ff
STOCKART-BERNKOPF, Jugendwohlfahrtsgesetz 1989, ÖAV 1989, 55ff
STOLZ, Umwelt-, Natur- und Landschaftsschutzanwälte im österreichischen
Recht - Möglichkeiten und Grenzen einer „mediatisierten
Bürgerbeteiligung“, in: Zenkl (Hrsg.) Bürger initiativ - Probleme und Modelle der Mitbestimmung 1990, 148ff
WALTER-MAYER, Grundriß des Besonderen Verwaltungsrechts [2] , 1987
WALTER-MAYER, Grundriß des österreichischen Bundesverfassungsrechts [8] , 1996
WALTER-MAYER, Grundriß des österreichischen Verwaltungsverfahrensrechts [6] , 1995
WELK, Der Anwalt des Kindes - Konsequenz heutigen Verständnisses von Kindeswohl 1990 (Diplomarbeit, Graz)
WEINBERGER, Norm und Institution. Eine Einführung in die Theorie des Rechts, 1988
WILK, „Kindsein“ in Österreich am Ende des 20. Jh. Einige soziologische Überlegungen, in: Lehner (Hrsg.), Kinder- und Jugendrecht 1993, 361 ff
WINTER, Zum Entwurf eines neuen Jugendwohlfahrtsgesetzes, ÖAV 1987, 124ff
WINTERSBERGER, Sind Kinder eine Minderheitsgruppe? Diskriminierung von Kindern gegenüber Erwachsenen, in: BMJUF (Hrsg.) Expertenbericht zum UN-Übereinkommen über die Rechte des Kindes 1993, 35ff WIMMER-PUCHINGER/REISEL/LEHNER/ZEUG/GRIMM, Gewalt gegen Kinder. Wissenschaftliche Analyse der sozialen und psychischen Bedingungen von gewalthaften Erziehungsstilen als Basis für Strategien von kurz- und langfristigen Präventivmaßnahmen, im Auftrag des BMUJF, 1991
TÄTIGKEITSBERICHTE:
Bericht 94/95 Kinder- und Jugendanwaltschaft Wien, 1995 Kinder und Jugendanwaltschaft Salzburg 1. Tätigkeitsbericht, 1.12.1993 - 31.12.1994, 1995
Sieben Monate Kinder- und Jugendanwaltschaft Salzburg - Eine Zwischenbilanz, 1994
Tätigkeitsbericht der Kinder- und Jugendanwaltschaft des Landes Kärnten 1994, 1995
Tätigkeitsbericht der Kinder- und Jugendanwaltschaft des Landes Kärnten 1.1.1993 - 31.12.1993, 1994
Tätigkeitsbericht 1994, O.ö. Kinder- und Jugendanwaltschaft, 1995
Tätigkeitsbericht der NÖ Kinder- und Jugendanwaltschaft 1992 und 1993, 1994
Tätigkeitsbericht der NÖ Kinder- und Jugendanwaltschaft 1994, 1995
[...]
1 LG 16.10.1990 LGBl. 93/1990, in der Fassung der Novellen LGBl. 20/1994, 71/1994 und 81/1995
2 Vgl. Arnold/Wüstendörfer, Kinderbeauftragte auf kommunaler Ebene. Arbeitsschwerpunkte und Organisationsmodelle, Sozialmagazin 2/1995, 19
3 Vgl. Salgo, Der Anwalt des Kindes. Die Vertretung von Kindern in zivilrechtlichen Kindesschutzverfahren. Eine vergleichende Studie, 1996
4 BG 15.3.1989 BGBl. 161/1989
5 Der Steiermärkische Kinder- und Jugendanwalt nahm erst am 1.2.1995 seine Arbeit auf. Die Steiermark war damit vor Tirol das vorletzte Bundesland, in dem die Interessensvertretung für Kinder und Jugendliche institutionalisiert wurde.
6 Roth, Der Kinder- und Jugendanwalt - eine neue Einrichtung im Dienste des Kinderschutzes in Österreich, Graz 1993 (Diplomarbeit)
7 Wilk, „Kindsein“ in Osterreich am Ende des 20. Jh. Einige soziologische Überlegungen, in: Lehner (Hrsg.), Kinder- und Jugendrecht 1993, 361
8 Vgl. z.B.: Wimmer-Puchinger/Reisel/Lehner/Zeug/Grimm, Gewalt gegen Kinder. Wissenschaftliche Analyse der sozialen und psychischen Bedingungen von gewalthaften Erziehungsstilen als Basis für Strategien von kurz- und langfristigen Präventivmaßnahmen, im Auftrag des BMUJF 1991
9 Vgl. Aries, Die Geschichte der Kindheit, 1978
10 Vgl. Postman, Das Verschwinden der Kindheit, 1983
11 Vgl. Wilk, „Kindsein“, 363f
12 Wilk, „Kindsein“, 372f
13 Wintersberger, Sind Kinder eine Minderheitsgruppe? Diskriminierung von Kindern gegenüber Erwachsenen, in: BMUJF (Hrsg.) Expertenbericht zum UN-Übereinkommen über die Rechte des Kindes 1993, 35
14 Vgl. Wintersberger, Sind Kinder eine Minderheitsgruppe?19, 36ff
15 Wintersberger, Sind Kinder eine Minderheitsgruppe?, 42 8
16 Vgl. Weinberger, Norm und Institution. Eine Einführung in die Theorie des Rechts, 1988, 39
17 Prónay, Das Bild des Kindes und seine Auswirkung auf die Rechtsordnung. in: Österreichische Juristenkommission (Hrsg.), Kritik und Fortschritt im Rechtsstaat. 18.Tagung der österreichischen Juristenkommission von 9. bis 11. Mai 1991, 1994, 56
18 Vgl.. Brauchli, Das Kindeswohl als Maxime des Rechts, 1982, 121
19 Mottl, Das Kind: Rechtssubjekt oder nur Spielball familiärer Auseinandersetzungen, in: BMUJF (Hrsg.), Expertenbericht zum UN-Übereinkommen über die Rechte des Kindes, 1993, 95
20 Walter-Mayer, Grundriß des Besonderen Verwaltungsrechts [2]
21 Vgl. Haslinger, Bewirkt die UN-Konvention über die Rechte des Kindes einen neuen völkerrechtlichen oder menschenrechtlichen Status des Kindes in Österreich? in: BMUJF (Hrsg.), Expertenbericht zum UN-Übereinkommen über die Rechte des Kindes, 1993, 25
22 Vgl. Haslinger, Die völkerrechtliche Stellung des Kindes in Österreich, in: Lehner (Hrsg.), Kinder- und Jugendrecht, 1993, 342
23 Haslinger, UN-Konvention, 22f
24 Prónay, Bild des Kindes, 57
25 Haslinger, UN-Konvention, 18
26 Vgl. Haslinger, Völkerrechtliche Stellung , 345
27 Vgl. Haslinger, UN-Konvention, 19
28 zum Beispiel: Internationales Übereinkommen zur Bekämpfung des Mädchenhandels (RGBl 1913/26), Übereinkommen über das auf Unterhaltsverpflichtungen gegenüber Kindern anzuwendende Recht (BGBl 1961/293), Europäisches Übereinkommen über die Rechtsstellung der unehelichen Kinder (BGBl 1980/314)
29 Vgl. Rosenmayr, Anmerkungen zu den Grundrechten Minderjähriger, in: Österreichische Juristenkommission (Hrsg.), Kritik und Fortschritt im Rechtsstaat. 18. Tagung der österreichischen Juristenkommission von 9. bis 11. Mai 1991, 1994, 49ff
30 RV 171 BlgNR 17.GP, 17
31 Vgl. Ent-Frischengruber, Jugendwohlfahrtsrecht, 1992,5 16
32 Vgl. RV 92 BlgStmkLT 11.GP, 28
33 Vgl. Bramböck/Hutter/Hagen/Paumgartner, Wege zum kinderzentrierten Verfahren - vom Verfahrensobjekt zum Verfahrenssubjekt, in: BMUJF(Hrsg.), Expertenbericht zum UN-Übereinkommen über die Rechte des Kindes 1993, 139
34 Vgl. Koziol-Welser, Bürgerliches Recht [10] II, 1996, 280
35 Salgo, Anwalt des Kindes, 36
36 Council of Europe Doc 4376, 3 Oct 1979, p5
37 Roth, Kinder- und Jugendanwalt, 17
38 Welk, Der Anwalt des Kindes - Konsequenz heutigen Verständnisses von Kindeswohl 1990, (Diplomarbeit, Graz), 48
39 Vgl. Arnold/Wüstendörfer, Kinderbeauftragte, 19
40 Vgl. Salgo, Anwalt des Kindes, 58; Dort findet sich auch das prägnante Zitat: „The history of American freedom is, in no small measure, the history of procedure“ von Justice Frankfurter in Malinowski v. New York, 324 U.S. (1945) 401/414 (seperate opinion)
41 Salgo, Anwalt des Kindes, 58f
42 Vgl. Salgo, Anwalt des Kindes, 72ff
43 Vgl. Salgo, Anwalt des Kindes, 190ff; Roth, Kinder- und Jugendanwalt, 18f
44 Steindorff, Der Kinder- und Jugendanwalt in Frankreich - eine Idee auf dem Vormarsch, in: Salgo, Der Anwalt des Kindes. Die Vertretung von Kindern in zivilrechtlichen Kindesschutzverfahren. Eine vergleichende Studie, 1996, 356
45 Steindorff, Kinder- und Jugendanwalt in Frankreich, 384f
46 Vgl. Simitis/Zenz, Familie und Familienrecht I, 1975, 57f
47 Vgl. Luthin, Anmerkung zur Entscheidung des Amtsgerichtes MönchengladbachRheydt vom 23.11.1985, FamRZ 1986,391
48 Vgl. Salgo, Anwalt des Kindes, 459ff
49 Vgl. Prónay, Der Kinder- und Jugendanwalt, in: Lehner (Hrsg.), Kinder- und Jugendrecht 1993, 352; ebenso: Jäger, Was können die Kinder- und Jugendanwaltschaften leisten?, in: BMUJF(Hrsg.), Expertenbericht zum UNÜbereinkommen über die Rechte des Kindes 1993, 193
50 Paumgartner, Die rechtliche Betreuung des Kindes, in: Salzburg Diskussion 1991, 40 28
51 Vgl. Salgo, Die Funktion eines Kinder- und Jugendbeauftragten im internationalen Vergleich, in: Materialien zur Heimerziehung 4/1990, 5ff
52 Vgl. Ent-Frischengruber, Jugendwohlfahrtsrecht, 1992, 18 29
53 Vgl. Pichler, Internationale und nationale Entwicklungen der Rechte des Kindes, in: Salzburg Diskussion 1991, 24f
54 Vgl. LGBl für Wien 5/1994, LGBl für die Steiermark 20/1994, LGBl für Tirol 11/1995
55 Diese Vorhaben sind laut § 14 Abs 3 lit Z 1 - 3:
1. Errichtung und wesentliche Änderung von Bauten die überwiegend von Kindern oder Jugendlichen in größerer Zahl benützt werden oder benützt werden sollen, wie Z B. Kinder- und Jugendheime
2. Errichtung oder Erweiterung eines Privatkindergartens
3. Errichtung, Betrieb oder wesentliche Änderung von Krankenanstalten
56 Vgl. Ent-Frischengruber, Jugendwohlfahrtsrecht, III
57 Vgl. Stockart-Bernkopf, Jugendwohlfahrtsgesetz 1989, ÖAV 1989, 55 33
58 BG 15.3.1989 BGBl 161
59 Vgl. Ragger, Jugendwohlfahrtsrecht und Verfassungsgerichtshof , Graz 1994 (Diplomarbeit), 43 ff
60 LG 16.10.1990 LGBl 1991/93
61 Vgl. Prohaska, Die Neuorientierung des Jugendwohlfahrtsrechts, ÖAV 1981, 6 35
62 Vgl. RV 171 BlgNR 17.GP, 20f
63 Winter, Zum Entwurf eines neuen Jugendwohlfahrtsgesetzes, ÖAV 1987, 125
64 Vgl. Jäger, Kinder- und Jugendanwaltschaften, 186
65 Vgl. Ent-Frischengruber, Jugendwohlfahrtsrecht, 18
66 Vgl. Pichler, Entwicklungen der Rechte des Kindes; Paumgartner, Betreuung des Kindes; Prónay, Kinder- und Jugendanwalt, 349
67 Vgl. Roth, Kinder- und Jugendanwalt, 21f
68 RV 92 BlgStmkLT 11.GP,5f
69 Vgl. RV 171 BlgNR 17.GP, 20f
70 RV 92 BlgStmkLT 11.GP, 33
71 Vgl. RV 47 BlgStmkLT 12.GP
72 Vgl. RV 47 BlgStmkLT 12.GP, 3
73 RV 47 BlgStmkLT 12. GP, §13a Abs 6: Die Landesregierung hat die Bestellung des Kinder- und Jugendbeauftragten zu widerrufen, wenn in seiner Person Umstände eintreten, die ihn für dieses Amt als nicht mehr geeignet erscheinen lassen. Dies sind insbesondere:
a) strafrechtliche Tatbestände, die ihn für die Erfüllung seiner Aufgaben ungeeignet erscheinen lassen,
b) dauernde Dienstunfähigkeit
c) grobe Vernachlässigung seiner Pflichten
d) wiederholte Überschreitung seines Zuständigkeitsbereiches
74 Vgl. StBer 29.Sitzung StmkLT 12.GP, 2069
75 RV 47 BlgStmkLT 12.GP, 3
76 Vgl. Jäger, Kinder- und Jugendanwaltschaften leisten, 185ff
77 Adamovich/Funk, Allgemeines Verwaltungsrecht [3], 1987, 329
78 Vgl. Berka, Zur Weisungsbindung des Salzburger Jugendwohlfahrtsbeirates, 1995 (Rechtsgutachten), 20
79 Vgl. Berka, Weisungsbindung, 21f
80 Einen genauen Vergleich der einzelnen landesgesetzlichen Bestimmungen stellte ja bereits Roth in seiner Diplomarbeit, Der Kinder- und Jugendanwalt, 1993, an.
81 RV 47 BlgStmkLT 12.GP, 3
82 Roth, Kinder- und Jugendanwalt, 32
83 Grazer Zeitung 1994, Stück 26, Nr.299
84 Vgl. Salgo, Anwalt des Kindes, 471ff
85 Vgl. Schwarz/Löschnigg, Arbeitsrecht [5] 1995, 598
86 Vgl. Tätigkeitsbericht der Kinder- und Jugendanwaltschaft des Landes Kärnten 1994, 1995, 4
87 Als Beispiel für eine weniger befriedigende Lösung soll hier der Tätigkeitsbericht der Kinder- und Jugendanwaltschaft des Landes Kärnten 1994, 4 zitiert werden: „An der räumlichen Beengtheit hat sich seit dem letzten Bericht trotz mehrmaliger Urgenzen nach wie vor nichts verändert. Viel mehr hat sich die Situation insofern verschlechtert, als in der Behindertenanwaltschaft, die mit uns in Bürogemeinschaft ist, mittlerweile fünf Personen (!) arbeiten. Ein ungestörtes Arbeiten im Sekretariat - vor allem seien hier die Telefonate mit Ratsuchenden erwähnt - ist aufgrund der personellen Überbesetzung der zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten oftmals kaum möglich.“
88 Vgl. 466 Blg StenProt Salzburger LT 10.GP, 6
89 Vgl. § 6 Abs 3 NÖJWG und § 10 Abs 4 O.ö. JWG
90 Vgl. 47 BlgStmkLT 12.GP, 5
91 Vgl. Schwarz/Löschnigg, Arbeitsrecht [5], 136
92 Vgl. Tätigkeitsbericht der NÖ Kinder- und Jugendanwaltschaft 1994, 6 (Tirol kommt in dieser Auflistung noch nicht vor, da es in Tirol 1994 noch keinen Kinder- und Jugendanwalt gab. Eine entsprechende Änderung des Tiroler JWG erfolgte erst mit LGBl 11/1995. darüber hinaus sagt diese Auflistung auch nichts darüber aus, in welchem Ausmaß die Mitarbeiter beschäftigt werden.
93 DSA = Diplomsozialarbeiter/Diplomsozialarbeiterin
94 laut telefonischer Auskunft des Kinder- und Jugendanwaltes Tirol, wobei die Sozialpädagogin erst eingestellt werden wird (Stand: 07.05.1996)
95 KiJA = Kinder- und Jugendanwaltschaft
96 Kinder- und Jugendanwaltschaft Salzburg: 1. Tätigkeitsbericht, 1.12.1993 - 31.12.1994, 1995, 4
97 Vgl. Bericht 94/95 Kinder- und Jugendanwaltschaft Wien 1995, 6ff
98 Adamovich/Funk, Allgemeines Verwaltungsrecht [3], 130 59
99 Für den Bereich des Umweltanwaltes vgl. Stolz, Umwelt- Natur- und Landschaftsschutzanwälte im österreichischen Recht - Möglichkeiten und Grenzen einer „mediatisierten Bürgerbeteiligung“, in: Zenkl (Hrsg.) Bürger initiativ - Probleme und Modelle der Mitbestimmung 1990, 158f
100 Tätigkeitsbericht 1994 O.ö. Kinder- und Jugendanwaltschaft, 1995, 5
101 Vgl. Tätigkeitsbericht 1994, O.ö. Kinder- und Jugendanwaltschaft, 1995, 30ff; Tätigkeitsbericht der Kinder- und Jugendanwaltschaft des Landes Kärnten 1993, 1994, 29ff; Tätigkeitsbericht der NÖ Kinder- und Jugendanwaltschaft 1992 und 1993, 1994, 42ff; Tätigkeitsbericht der NÖ Kinder- und Jugendanwaltschaft 1994, 1995, 38ff; Kinder- und Jugendanwaltschaft Salzburg 1. Tätigkeitsbericht, 1995,10ff; Sieben Monate Kinder- und Jugendanwaltschaft Salzburg - Eine Zwischenbilanz, 1994, 10ff
102 RV 47 BlgStmkLT 12. GP, 5
103 Beispiele für themenbezogene Schlußfolgerungen und Empfehlungen: Kontakt zur Herkunftsfamilie bei Fremdunterbringung (individuelle und flexible Lösungen sollten gefunden werden, Vorschlag, einen konzeptorientierten Erfahrungsaustausch zu initiieren) in: Kinder- und Jugendanwalt schaft Salzburg, 1. Tätigkeitsbericht, 19;
105 vgl. RV 47 BlgStmkLT 12. GP, 4
106 RV 47 BlgStmkLT 12. GP, 4
107 StBer 29.Sitzung StmkLT 12.GP, 2069 „Abg. Mag. Bleckmann: (...) Es ist uns auch gelungen, einige Punkte in dieses Gesetz hineinzureklamieren, die mir persönlich auch sehr wichtig sind. Es ist einerseits eine Generalklausel hineingekommen, daß eben der Kinder- und Jugendanwalt die Aufgabe hat, die Rechte und Interessen von Kindern und Jugendlichen zu vertreten. Daß wir also den Aufgabenbereich nicht völlig eingeschränkt haben auf gewisse, einzeln herausgenommene Punkte, sondern der Kinder- und Jugendanwalt wird sich selbst für gewisse Schwerpunkte entscheiden müssen, für die er sich dann einsetzt und die ihm dann wichtig sind, und das ist mit dieser Generalklausel dann auch gegeben, daß er wirklich die Möglichkeit hat, für das zu entscheiden, was ihm selbst auch wichtig ist.(...)“
108 Die Begriffe Kinder- und Jugendbeauftragter und Kinder- und Jugendanwalt werden oft synonym verwendet. So war auch in der Regierungsvorlage zur Novelle des StJWG LGBl 1994/20 vom Kinder- und Jugendbeauftragten die Rede.
109 RV 47 BlgStmkLT 12. GP, 5
110 Vgl. Welk, Anwalt des Kindes, 48
111 Vgl. Pichler, Entwicklungen der Rechte des Kindes, 24
112 Vgl. Paumgartner, Betreuung des Kindes, 42f 72
113 Vgl. Tätigkeitsbericht der NÖ Kinder- und Jugendanwaltschaft 1994, 9 73
114 RV 47 BlgStmkLT 12.GP, 5
115 Vgl. Roth, Kinder- und Jugendanwalt ,62
116 Vgl. RV 47 BlgStmkLT 12.GP, 5 wo eine Kontrollfunktion explizit mit folgender Begründung abgelehnt wird: „Diese Sichtweise hat insofern keine Zukunft mehr, als sich immer mehr die Erkenntnis durchsetzt, daß die gemeinsame Lösung von Problemen langfristig mehr bringt und somit dauerhafter ist. Moderne Konfliktlösung beruht auf dem Prinzip, daß jeder „Konfliktpartner“ dabei gewinnen soll. Der Kinder- und Jugendbeauftragte wird mehr erreichen können, wenn er ebenfalls nach diesem Prinzip arbeitet.“
117 Vgl. z.B. Walter-Mayer, Grundriß des österreichischen Bundesverfassungsrechts [8], 1996, Rz 9
118 Weinberger, Norm und Institution, 85
119 Vgl. Adamovich/Funk, Allgemeines Verwaltungsrecht [3], 248ff
120 Aufgrund welcher Rechtsgrundlage die Begutachtung von Bundesgesetzen erfolgte, geht aus dem Tätigkeitsbericht nicht hervor, aufgrund des NÖJWG kann kein Begutachtungsrecht für Bundesgesetze abgeleitet werden, da eine derartige Regelung nicht in die Kompetenz des Landesgesetzgebers fällt.
121 Vgl. Tätigkeitsbericht der NÖ Kinder- und Jugendanwaltschaft 1992/1993, 8f
122 Vgl. Tätigkeitsbericht der NÖ Kinder- und Jugendanwaltschaft 1994, 37 78
123 Vgl. RV 47 BlgStmkLT 12.GP, 4
124 Vgl. Roth, Kinder- und Jugendanwalt,63
125 Bericht 94/95 Kinder- und Jugendanwaltschaft Wien, 40
126 Vgl. Bericht 94/95 Kinder- und Jugendanwaltschaft Wien, 41 81
127 Vgl. Roth, Kinder- und Jugendanwalt, 65f
128 Vgl. RV 47 BlgStmkLT 12.GP, 5
129 Vgl. Winter, Entwurf, 125
130 Vgl. RV 47 BlgStmkLT 12.GP, 5
131 Vgl. Walter-Mayer, Grundriß des österreichischen Verwaltungsverfahrensrechts [6], 1995, Rz 126f
132 Vgl. Roth, Kinder- und Jugendanwalt, 50f
133 Vgl. RV 47 BlgStmkLT 12.GP, 5 87
134 Vgl. Roth, Kinder- und Jugendanwalt, 51; ebenso für den Bereich der Umweltanwälte: Stolz, Umwelt- Natur- und Landschaftsschutzanwälte, 161f: „(...) in anderen als den in Abs 1 und 2 genannten, auf Grund landesgesetzlicher Vorschriften durchzuführender umweltrelevanten Verwaltungsverfahren soll der Landesumweltanwaltschaft auf schriftlichen Antrag lediglich das Recht auf Akteneinsicht, auf Teilnahme an mündlichen Verhandlungen sowie auf Stellungnahme zum geplanten Vorhaben zukommen. Die solcherart geschaffene „beschränkte Parteistellung“ erscheint dem Verfassungsdienst des Bundeskanzleramtes im Hinblick auf die Bedarfsgesetzgebungskompetenz des Art 11 Abs 2 B-VG mE zu Recht als bedenklich.“
135 Vgl. Roth, Kinder- und Jugendanwalt, 43ff 89
136 Derzeit übt Dr. Sellitsch (Jurist) das Amt des Kinder- und Jugendanwaltes aus. Seine Mitarbeiterinnen sind Fr. Sohar (Sekretariat) und Fr. Mag. Kleinhappel (im Rahmen einer Nebentätigkeit im Umfang von 20 Wochenstunden).
137 Sellitsch, Kinder- und Jugendanwalt - Die Interessensvertretung für Kinder und Jugendliche ist gefragt - Eine Zwischenbilanz nach 100 Tagen, 1995 (Presseaussendung)
138 Vgl. Sellitsch, Kinder- und Jugendanwalt
139 Vgl. Sellitsch, Arbeitskonzept des „Kinder- und Jugendanwaltes“ für das Bundesland Steiermark, 1995
140 Steirische Plattform für eine kinderfreundliche Gesellschaft & Kinder- und Jugendanwalt der Steiermark (Hrsg.), Buntbuch Kinder in der Steiermark, Ideen und Informationen für eine kinderfreundliche Gesellschaft, Ein Handbuch zum Nachschlagen und Nachdenken, 1996
141 Diese Auflistung der politischen Forderungen des Kinder- und Jugendanwaltes erh ebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die hier verarbeiteten Informationen stammen aus persönlichen Gesprächen mit Dr. Sellitsch. Weitere Informationen können dem Tätigkeitsbericht für 1995 entnommen werden, der zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Arbeit noch nicht vorlag. Außerdem soll hier ausdrücklich darauf hingewiesen werden, daß die politischen Forderungen nur aus der Perspektive des Kinder- und Jugendanwaltes betrachtet werden und daher auf ebenfalls sachlich zu argumentierende entgegengesetzte Meinungen in dieser Arbeit nicht eingegangen wird.
142 Anzahl der Minderjährigen gemäß der Bevölkerungsstatistik auf Grund der Volkszählung 1991
143 Vgl. Walter-Mayer, Verwaltungsverfahrensrecht, Rz 126
144 Vgl. Walter-Mayer, Verwaltungsverfahrensrecht, Rz 114 95
145 Roth, Kinder- und Jugendanwalt, 55; ebenso für den Bereich der Umweltanwälte: Stolz, Umwelt- Natur- und Landschaftsschutzanwälte, 163: „ Eine solche Beschwerdemöglichkeit muß als sog. Amtsbeschwerde zur Wahrung objektiven Rechts gem Art 131 Abs 2 B-VG in den einschlägigen Landesgesetzen verankert werden. Dies vor allem deshalb, weil der VwGH in einem Leiterkenntnis betreffend die NÖ Umweltanwaltschaft ausgesprochen hat, daß ihr keine subjektiven Rechte im Verwaltungsverfahren zukommen, was aber allein die Erhebung einer „normalen“ Bescheidbeschwerde nach Art 131 Abs 1 Z1 B-VG rechtfertigen würde (VwGH 29.2.1988, 87/10/0011...)“
146 Sellitsch, Rechtsvertretung in Gerichtsverfahren, in: Steirische Plattform für eine kinderfreundliche Gesellschaft & Kinder- und Jugendanwalt der Steiermark (Hrsg.), Buntbuch Kinder in der Steiermark, Ideen und Informationen für eine kinderfreundliche Gesellschaft, 1996, 26; zur Frage der Vertretung im Verfahren allgemein: Vgl. 2.3.2.
Häufig gestellte Fragen zum Sprach-Preview
Was beinhaltet dieser Sprach-Preview?
Dieser Sprach-Preview enthält das Inhaltsverzeichnis, die Ziele, die Hauptthemen, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter des Dokuments.
Worum geht es in der Einleitung?
Die Einleitung beschreibt die Entstehung dieser Arbeit im Kontext der Arbeit des Steiermärkischen Kinder- und Jugendanwalts ab 1995 und die Novellierung des Steiermärkischen Jugendwohlfahrtsgesetzes 1994. Es wird auch auf die unterschiedlichen Begrifflichkeiten (Kinder- und Jugendanwalt, Kinder- und Jugendbeauftragter, etc.) eingegangen und die Intention der Arbeit umrissen.
Welche Themen werden im Kapitel über die Entstehung der Forderung nach einer Kinder- und Jugendanwaltschaft behandelt?
Dieses Kapitel thematisiert die Stellung des Kindes in der Gesellschaft und in der Rechtsordnung, die UN-Konvention über die Rechte der Kinder und das Kind im Jugendwohlfahrtsrecht. Es werden auch Modelle der Interessensvertretung für Kinder vorgestellt.
Welche Modelle der Interessensvertretung für Kinder werden unterschieden?
Es werden zwei Hauptmodelle unterschieden: Interessensvertretung im gesellschaftspolitischen Bereich und Interessensvertretung im Verfahren.
Was wird im Kapitel über die Entwicklung des Steiermärkischen Jugendwohlfahrtsgesetzes behandelt?
Dieses Kapitel beschreibt die Entwicklung von der Bundesgesetzgebung (JWG 1989) bis zu den Novellen des Steiermärkischen Jugendwohlfahrtsgesetzes, insbesondere die Novelle von 1994, die den Kinder- und Jugendanwalt/die Kinder- und Jugendanwältin einführte.
Wie ist der Kinder- und Jugendanwalt im steiermärkischen Jugendwohlfahrtsgesetz geregelt?
Dieses Kapitel behandelt die Ausgestaltung des Amtes des Kinder- und Jugendanwalts, seine Organisation, Bestellung, Amtsdauer, Ausstattung, Weisungsfreistellung und Aufgaben. Es wird auch auf das Verhältnis zur Kinder- und Jugendanwaltschaft (gemäß § 13 StJWG) und zum Jugendwohlfahrtsbeirat eingegangen.
Welche politischen Forderungen hat der steiermärkische Kinder- und Jugendanwalt?
Die politischen Forderungen umfassen die Verbesserung der Personalausstattung, die Parteistellung im Verwaltungsverfahren, die Möglichkeit der Bescheidbeschwerde, die Weisungsfreistellung im organisatorischen Bereich und die Rechtsvertretung von Kindern im Gerichtsverfahren.
Was ist die ständige Konferenz der Kinder- und Jugendanwaltschaften Österreichs?
Es wird die Einrichtung des Kinder- und Jugendanwaltes im Grundsatzgesetz als zu einschränkend kritisiert, da der Jugendwohlfahrtsträger nur zur Beratung und Auskunft in jugendwohlfahrtsrechtlichen Angelegenheiten berufen wurde.
Was ist das Ergebnis des Resümees?
Abschließend wird die Bedeutung der gesetzlichen Bestimmungen im Steiermärkischen Jugendwohlfahrtsgesetz hervorgehoben. In diesem Zusammenhang wird insbesondere der Bedarf an Verbesserungen und Erfüllung der Forderungen von Kindern und Jugendlichen genannt, durch zum Beispiel, Parteistellung im Verwaltungsverfahren, Bescheidbeschwerde und Weisungsfreistellung.
Welche Bereiche werden unter themenorientierte Arbeit in den Erläuterungen der Regierungsvorlage besonders hervorgehoben?
Folgende Bereiche werden besonders hervorgehoben: Jugendliche und Jugendschutz, Erziehungsfragen, Gesundheitspolitik, Wohnpolitik, Medienpolitik, Umweltpolitik, Verkehrspolitik, kulturelle Angebote, Kommunalpolitik
Welche besonderen Aufgaben nimmt der Kinder- und Jugendanwalt wahr?
Es werden die besonderen Aufgaben zur Wahrung des Wohles von Kindern und Jugendlichen genannt: Beratung bezüglich der Stellung von Kindern und die Aufgaben der Erziehungsberechtigten, Hilfe bei Meinungsverschiedenheiten zwischen Kindern und Erziehungsberechtigten, Vermittlung bei Meinungsverschiedenheiten zwischen Erziehungsberechtigten oder Kindern und Jugendlichen einerseits und Behörden andererseits, Befassung von Organen des Jugendwohlfahrtsträgers.
Was sagt das Recht auf Akteneinsicht aus?
Es wird gesagt, dass der Kinder- und Jugendanwalt aufgrund des Recht auf Akteneinsicht in Erfüllung der Aufgaben von § 13b Abs 2 StJWG die Vermittlungsaufgabe zwischen Behörden sowie Kindern und Jugendlichen und Erziehungsberechtigten wahrnehmen kann.
Details
- Titel
- Der steiermärkische Kinder- und Jugendanwalt
- Hochschule
- Karl-Franzens-Universität Graz
- Autor
- Christian Haider (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 1996
- Seiten
- 112
- Katalognummer
- V96415
- ISBN (eBook)
- 9783638090919
- Dateigröße
- 597 KB
- Sprache
- Deutsch
- Anmerkungen
- Ich hab diese Arbeit auf der juristischen Fakultät im Verwaltungsrecht verfasst, bin aber von meiner ersten Ausbildung her Sozialarbeiter und könnte mir vorstellen, daß vor allem Sozialpädagogen an der der Beschreibung dieser Einrichtung Interesse haben könnten. Es handelt sich dabei nämlich um eine ArtKinder- und Jugendbeauftragten.
- Schlagworte
- Kinder- Jugendanwalt Graz
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 0,99
- Arbeit zitieren
- Christian Haider (Autor:in), 1996, Der steiermärkische Kinder- und Jugendanwalt, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/96415
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-