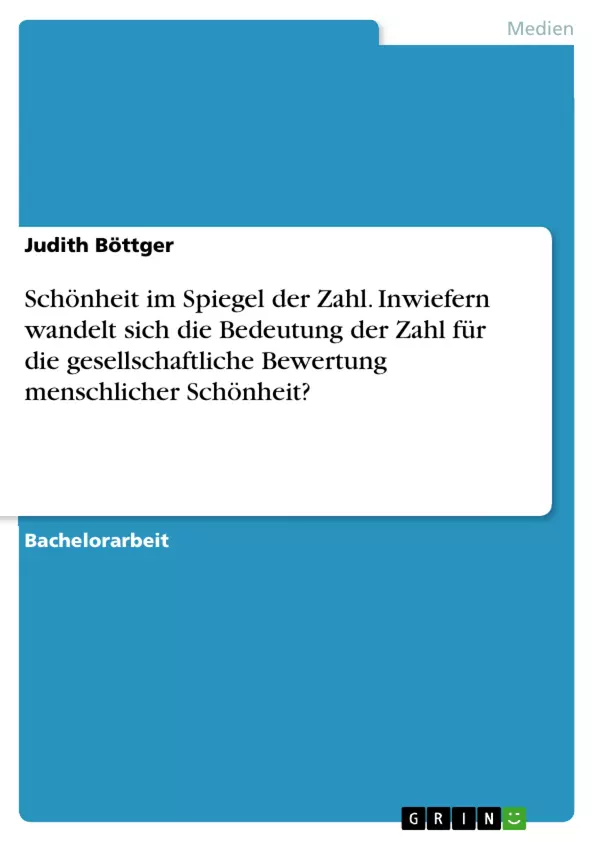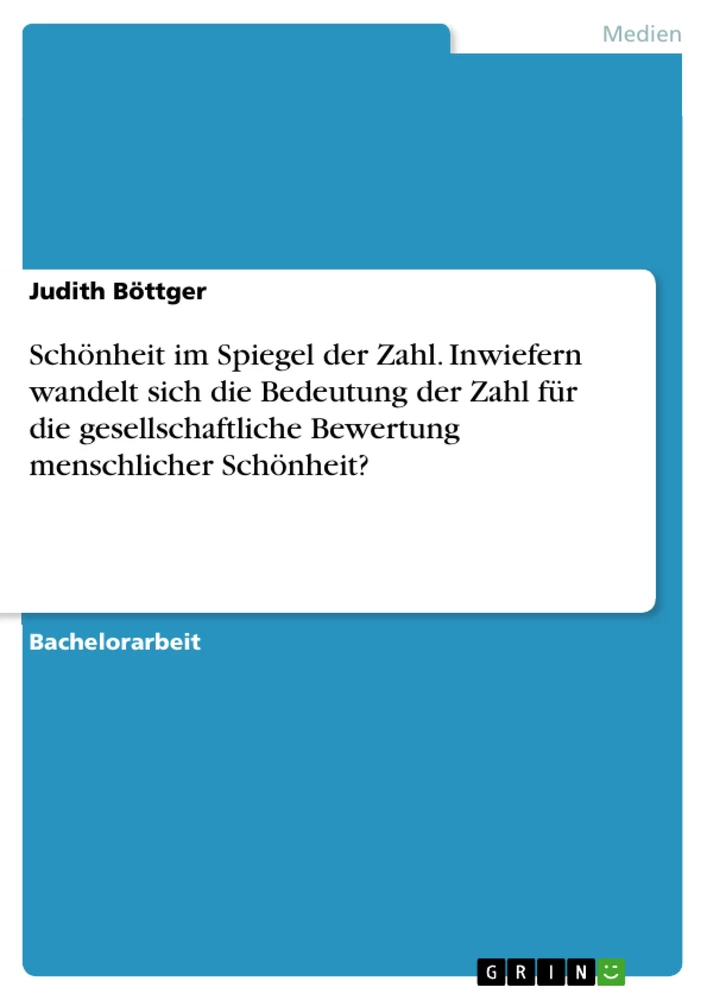
Schönheit im Spiegel der Zahl. Inwiefern wandelt sich die Bedeutung der Zahl für die gesellschaftliche Bewertung menschlicher Schönheit?
Bachelorarbeit, 2019
54 Seiten, Note: 1,3
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Abstract
- 1. Einleitung
- 2. Eine kleine Geschichte der Schönheit
- 3. Zählen statt Erzählen - Objektivität von Zahlen
- 4. Die geordnete Welt der Antike
- 4.1. Pythagoras und die Ordnung der Welt
- 4.2. Polyklets Kanon
- 4.3. Vitruv und die Architektur des Körpers
- 5. Proportion in der Renaissance
- 5.1. Das antike Vorbild
- 5.2. Albrecht Dürer als Kunsttheoretiker
- 5.3. Proportionslehre
- 6. Ganz normale Schönheit im 19. Jahrhundert
- 6.1. Adolphe Quetelet und der L'homme moyen
- 6.2. Francis Galton und der schöne Durchschnitt
- 7. Bewertung und Optimierung im 20. Jahrhundert
- 7.1. Attraktivitätsforschung
- 7.2. Technologien des Selbst
- 8. Digitale Schönheit im 21. Jahrhundert
- 8.1. Das Schönheitsideal Sozialer Medien
- 8.2. Errechnete Schönheit
- 9. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die wandelnde Rolle von Zahlen bei der gesellschaftlichen Bewertung menschlicher Schönheit in verschiedenen Epochen. Das zentrale Anliegen besteht darin, aufzuzeigen, wie Zahlen als vermeintlich objektives Mittel zur Definition und Konstruktion von Schönheitsidealen in unterschiedlichen historischen Kontexten eingesetzt wurden und welche Macht ihnen dabei zugeschrieben wurde.
- Die historische Entwicklung der Verwendung von Zahlen zur Definition von Schönheit
- Die Rolle von Zahlen in der Konstruktion von Schönheitsidealen
- Die vermeintliche Objektivität von Zahlen und ihre Auswirkungen auf die Wahrnehmung von Schönheit
- Der Einfluss verschiedener Disziplinen (Kunst, Wissenschaft, Soziologie) auf die Definition von Schönheit
- Die Bedeutung von Zahlen in der heutigen, digital geprägten Gesellschaft im Kontext von Schönheit
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt mit einer persönlichen Anekdote über die eigene Erfahrung mit Körperbild und Zahlen in Bezug auf Schönheit ein und legt den Fokus der Arbeit fest: die Untersuchung des sich wandelnden Einflusses von Zahlen auf die gesellschaftliche Bewertung von Schönheit. Es wird die These aufgestellt, dass Zahlen ein zentrales Mittel zur Definition von Gesetzmäßigkeiten der Schönheit sind, und der methodische Ansatz der Arbeit skizziert. Die Arbeit konzentriert sich auf die westliche Kultur und die Schönheit des menschlichen Körpers. Der Begriff der Schönheit wird vereinfacht als visuell ausgelöstes Wohlgefallen definiert.
2. Eine kleine Geschichte der Schönheit: Dieses Kapitel beleuchtet die Variabilität und Subjektivität des Schönheitsbegriffs. Es wird die Schwierigkeit einer universellen Definition von Schönheit herausgestellt und der Ansatz, die Arbeit an prägnanten Beispielen aus der Geschichte zu orientieren, begründet. Es wird ein kurzer Überblick über den historischen Diskurs um Schönheit gegeben, um den Kontext für die anschließende Analyse des Einflusses von Zahlen zu schaffen.
3. Zählen statt Erzählen - Objektivität von Zahlen: Dieses Kapitel analysiert den Grund für das weitverbreitete Vertrauen in Zahlen und deren vermeintliche Objektivität. Es wird untersucht, wie diese vermeintliche Objektivität dazu führt, dass Zahlen im Diskurs um Schönheit eine zentrale Rolle spielen. Dies dient als Grundlage für die folgenden Kapitel, welche die Anwendung von Zahlen in verschiedenen historischen Kontexten untersuchen.
4. Die geordnete Welt der Antike: Dieses Kapitel untersucht die Anwendung mathematischer Prinzipien und Proportionen in der Antike als Grundlage für die Definition von Schönheit. Es werden die Ansätze von Pythagoras, Polyklet (Kanon) und Vitruv analysiert und ihre Bedeutung für die Konstruktion von Schönheitsidealen im antiken Griechenland und Rom herausgestellt. Die Kapitelteil untersucht, wie Zahlen zur Schaffung einer vermeintlich harmonischen und "geordneten" Vorstellung von Schönheit eingesetzt wurden.
5. Proportion in der Renaissance: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Renaissance und die Weiterentwicklung der antiken Ideen zur Proportion und Schönheit. Im Zentrum steht die Proportionslehre Albrecht Dürers und deren Einfluss auf die künstlerische und wissenschaftliche Betrachtung des menschlichen Körpers und Schönheitsidealen. Der Bezug zu den antiken Vorbildern wird hergestellt, und die Weiterentwicklung der mathematischen Konzepte zur Definition von Schönheit wird untersucht.
6. Ganz normale Schönheit im 19. Jahrhundert: Dieses Kapitel analysiert die Entwicklung der Schönheitsdiskurse im 19. Jahrhundert mit dem Fokus auf die Arbeiten von Adolphe Quetelet und Francis Galton. Es geht um die Konzepte des "L'homme moyen" und des "schönen Durchschnitts" und deren Einfluss auf die Entstehung statistischer Methoden zur Erfassung und Bewertung von Schönheit. Die Bedeutung der Quantifizierung von Schönheit und die damit verbundenen Implikationen werden untersucht.
7. Bewertung und Optimierung im 20. Jahrhundert: Dieses Kapitel befasst sich mit der Entwicklung der Schönheitsbewertung und -optimierung im 20. Jahrhundert. Es analysiert den Einfluss der Attraktivitätsforschung und der aufkommenden Technologien des Selbst auf das Verständnis von Schönheit und den Einsatz von Zahlen zur Optimierung des eigenen Aussehens. Die Entwicklung von objektiven Maßen für Attraktivität und deren soziale Konsequenzen werden diskutiert.
8. Digitale Schönheit im 21. Jahrhundert: Dieses Kapitel untersucht die aktuelle Rolle von Zahlen in der digitalen Welt im Kontext von Schönheit. Es wird der Einfluss sozialer Medien und künstlicher Intelligenz auf die Definition und Bewertung von Schönheit analysiert, insbesondere die Rolle von Algorithmen, Likes und Followern in der Konstruktion von Schönheitsidealen und die zunehmende Quantifizierung von Schönheit. Die Erzeugung von „errechneter Schönheit“ wird thematisiert.
Schlüsselwörter
Schönheit, Zahlen, Schönheitsideal, Objektivität, Quantifizierung, Antike, Renaissance, 19. Jahrhundert, 20. Jahrhundert, 21. Jahrhundert, Soziale Medien, Künstliche Intelligenz, Körperbild, Proportionen, Statistik, Attraktivitätsforschung, Mathematik, Kulturgeschichte.
Häufig gestellte Fragen zur Bachelorarbeit: Die Wandelnde Rolle von Zahlen in der Gesellschaftlichen Bewertung von Schönheit
Was ist das zentrale Thema der Bachelorarbeit?
Die Arbeit untersucht, wie sich die Verwendung von Zahlen zur Bewertung von Schönheit im Laufe der Geschichte verändert hat. Sie analysiert, wie Zahlen als vermeintlich objektives Mittel zur Definition und Konstruktion von Schönheitsidealen in verschiedenen Epochen eingesetzt wurden und welche Macht ihnen dabei zugeschrieben wurde.
Welche Epochen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit betrachtet die Entwicklung von der Antike über die Renaissance, das 19. und 20. Jahrhundert bis hin zur digitalen Welt des 21. Jahrhunderts. Dabei werden verschiedene historische Kontexte und die jeweiligen Konzepte von Schönheit beleuchtet.
Welche konkreten Beispiele werden untersucht?
Die Arbeit analysiert unter anderem die Ansätze von Pythagoras, Polyklet (Kanon), Vitruv, Albrecht Dürer, Adolphe Quetelet und Francis Galton. Sie untersucht auch den Einfluss von Attraktivitätsforschung, sozialen Medien und künstlicher Intelligenz auf die heutige Wahrnehmung von Schönheit.
Wie wird die vermeintliche Objektivität von Zahlen behandelt?
Die Arbeit hinterfragt das weitverbreitete Vertrauen in die Objektivität von Zahlen und untersucht, wie diese vermeintliche Objektivität zu ihrer zentralen Rolle im Diskurs um Schönheit geführt hat. Es wird gezeigt, wie Zahlen zur Konstruktion von vermeintlich objektiven Schönheitsidealen eingesetzt werden.
Welche Disziplinen werden in der Arbeit berücksichtigt?
Die Arbeit integriert Erkenntnisse aus verschiedenen Disziplinen, darunter Kunstgeschichte, Mathematik, Soziologie und Wissenschaft, um ein umfassendes Bild der Entwicklung des Verhältnisses von Zahlen und Schönheit zu zeichnen.
Welche Rolle spielen soziale Medien und künstliche Intelligenz?
Die Arbeit untersucht den Einfluss sozialer Medien und künstlicher Intelligenz auf die Definition und Bewertung von Schönheit im 21. Jahrhundert. Sie analysiert die Rolle von Algorithmen, Likes und Followern in der Konstruktion von Schönheitsidealen und die zunehmende Quantifizierung von Schönheit in der digitalen Welt.
Welche Schlüsselkonzepte werden in der Arbeit behandelt?
Wichtige Konzepte umfassen Schönheitsideale, Objektivität, Quantifizierung, Proportion, Statistik, Attraktivitätsforschung, "L'homme moyen", "schöner Durchschnitt" und "errechnete Schönheit".
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, Kapitel zur Geschichte des Schönheitsbegriffs, zur vermeintlichen Objektivität von Zahlen, zur Anwendung von Zahlen in verschiedenen Epochen (Antike, Renaissance, 19. und 20. Jahrhundert, 21. Jahrhundert) und ein Fazit. Die Kapitelzusammenfassungen im Inhaltsverzeichnis bieten einen detaillierten Überblick.
Welche Schlussfolgerung zieht die Arbeit?
(Die genaue Schlussfolgerung ist nicht explizit im gegebenen Text zusammengefasst. Die Arbeit endet mit einem Fazit, welches die Ergebnisse der einzelnen Kapitel zusammenführt und den Einfluss von Zahlen auf die gesellschaftliche Bewertung von Schönheit abschließend beurteilt.)
Details
- Titel
- Schönheit im Spiegel der Zahl. Inwiefern wandelt sich die Bedeutung der Zahl für die gesellschaftliche Bewertung menschlicher Schönheit?
- Hochschule
- Universität Potsdam (Institut für Künste und Medien)
- Note
- 1,3
- Autor
- Judith Böttger (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2019
- Seiten
- 54
- Katalognummer
- V975586
- ISBN (eBook)
- 9783346327055
- ISBN (Buch)
- 9783346327062
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Schönheit Mathematik Geschichte Social Media Malerei Rechnen Medien
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 19,99
- Preis (Book)
- US$ 28,99
- Arbeit zitieren
- Judith Böttger (Autor:in), 2019, Schönheit im Spiegel der Zahl. Inwiefern wandelt sich die Bedeutung der Zahl für die gesellschaftliche Bewertung menschlicher Schönheit?, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/975586
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-