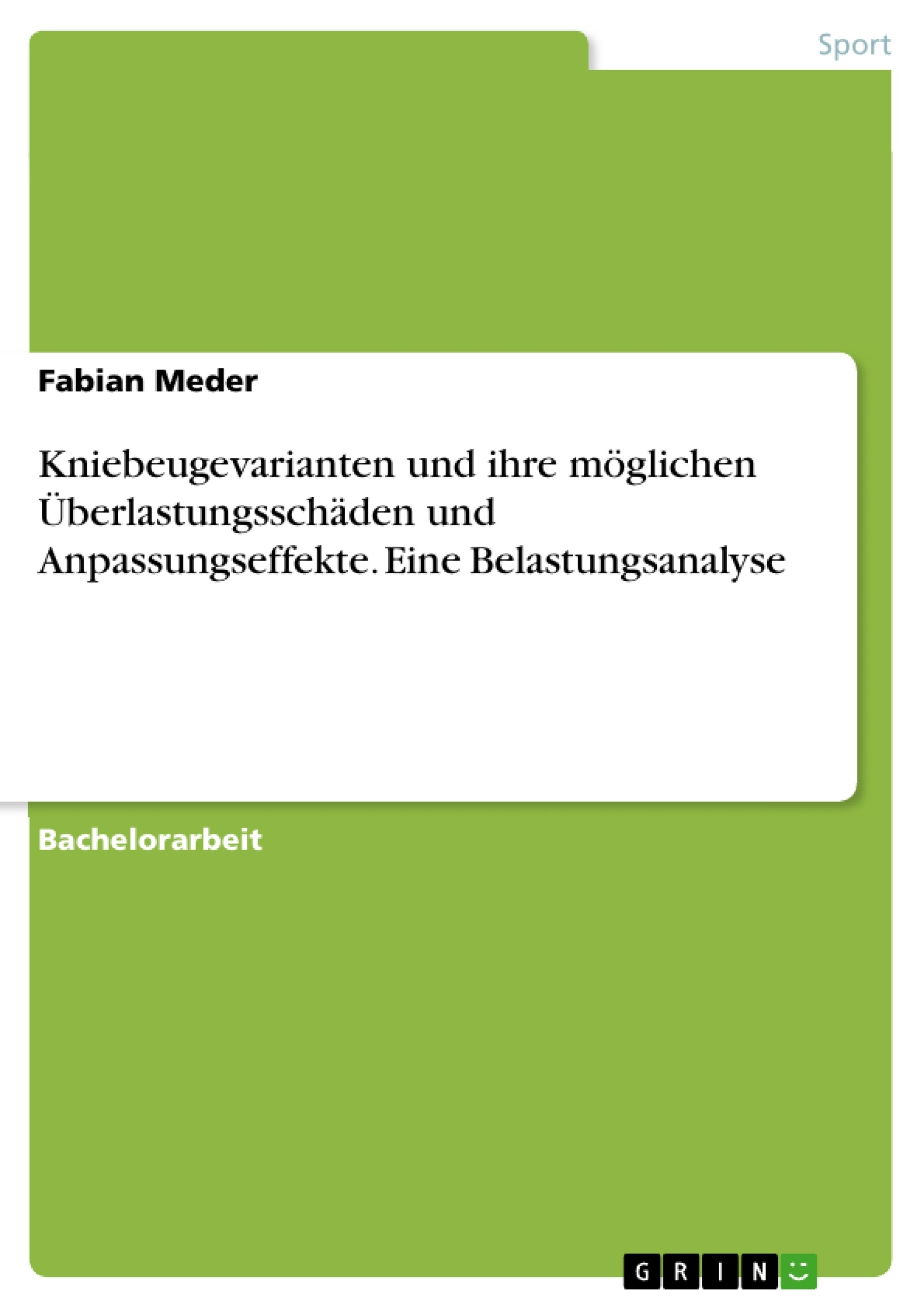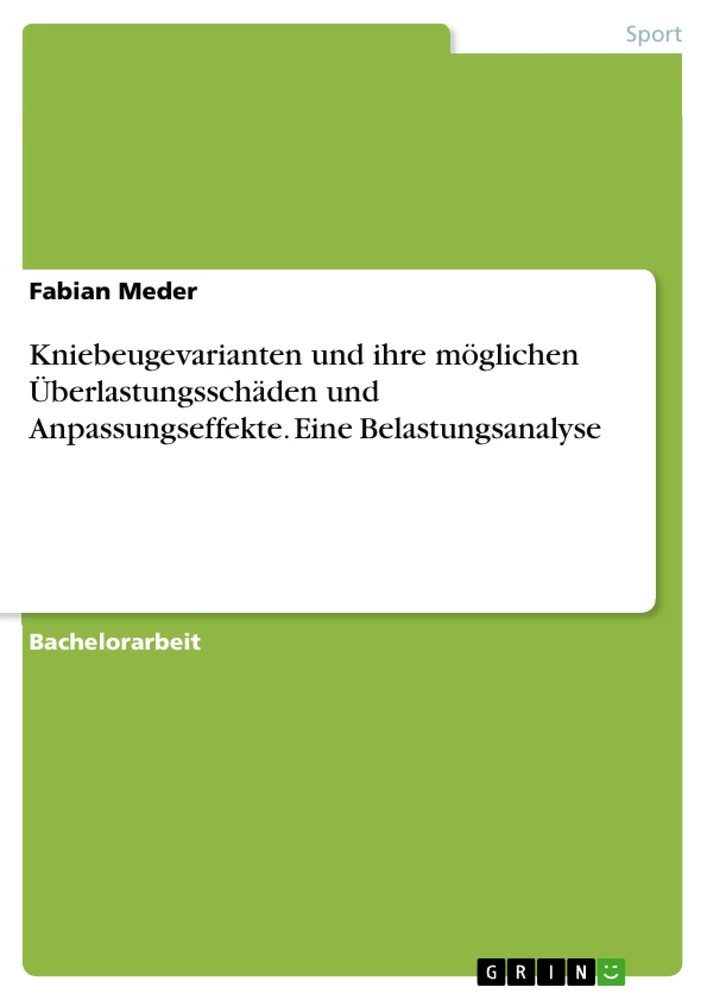
Kniebeugevarianten und ihre möglichen Überlastungsschäden und Anpassungseffekte. Eine Belastungsanalyse
Bachelorarbeit, 2020
53 Seiten, Note: 1,3
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung und Problemstellung
- 2 Zielsetzung
- 3 Gegenwärtiger Kenntnisstand
- 3.1 Geschichtliche Herleitung der Kniebeuge
- 3.1.1 Kniebeuge im Kindesalter
- 3.1.2 Kniebeuge mit Zusatzgewicht
- 3.2 Phänomenologische Betrachtung der Kniebeuge
- 3.2.1 Die Positionierung der Langhantel
- 3.2.2 Die parallele Kniebeuge
- 3.2.3 Die halbe Kniebeuge
- 3.2.4 Die viertel Kniebeuge
- 3.2.5 Die tiefe Kniebeuge
- 3.3 Biomechanische Betrachtung der Kniebeuge
- 3.3.1 Anatomie
- 3.3.1.1 Anatomie des Sprunggelenks
- 3.3.1.2 Anatomie des Kniegelenks
- 3.3.1.3 Anatomie des Hüftgelenks
- 3.3.1.4 Anatomie der Lendenwirbelsäule
- 3.3.2 Bewegungsmöglichkeiten
- 3.3.2.1 Bewegungsmöglichkeiten des Sprunggelenks
- 3.3.2.2 Bewegungsmöglichkeiten des Kniegelenks
- 3.3.2.3 Bewegungsmöglichkeiten des Hüftgelenks
- 3.3.2.4 Bewegungsmöglichkeiten der Lendenwirbelsäule
- 3.3.3 Biomechanik der unterschiedlichen Kniebeugevarianten
- 3.3.1 Anatomie
- 3.4 Darstellung der populärwissenschaftlichen Theorien und Modelle zum Thema Kniebeuge
- 3.5 Überleitung zur Problemstellung
- 3.1 Geschichtliche Herleitung der Kniebeuge
- 4 Methodik
- 5 Ergebnisse
- 6 Diskussion
- 7 Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Ziel dieser Arbeit ist die Erstellung eines narrativen Reviews, welches den aktuellen Forschungsstand zur Belastungsanalyse verschiedener Kniebeugevarianten unter Berücksichtigung möglicher Überlastungsschäden und Anpassungseffekte zusammenfasst. Die Arbeit stützt sich auf relevante theoretische und empirische Forschungsliteratur.
- Geschichtliche Entwicklung und Varianten der Kniebeuge
- Biomechanische Analyse der Kniebeuge und beteiligter Gelenke
- Überlastungsschäden und Anpassungseffekte verschiedener Kniebeugevarianten
- Populärwissenschaftliche Theorien und Modelle zur Kniebeuge
- Bewertung der Verletzungsrisiken verschiedener Techniken
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung und Problemstellung: Die Einleitung beleuchtet das steigende Interesse an funktionellem Training und der Kniebeuge innerhalb der Fitnessbranche. Sie hebt gegensätzliche Meinungen und Mythen um die Kniebeuge hervor, insbesondere bezüglich der Verletzungsgefahr bei tiefen Kniebeugen und der Position der Knie im Verhältnis zu den Fußspitzen. Die Arbeit untersucht die individuellen Überlastungsschäden und Anpassungseffekte unterschiedlicher Kniebeugevarianten.
2 Zielsetzung: Dieses Kapitel definiert das Ziel der Arbeit: die Erstellung eines Reviews zum Forschungsstand der Belastungsanalyse verschiedener Kniebeugevarianten, unter Berücksichtigung von Überlastungsschäden und Anpassungseffekten, basierend auf theoretischer und empirischer Literatur.
3 Gegenwärtiger Kenntnisstand: Dieses Kapitel liefert Hintergrundinformationen zur Kniebeuge. Es umfasst die geschichtliche Entwicklung der Kniebeuge, beginnend mit ihrer natürlichen Ausführung im Kindesalter und ihrem Rückgang durch die Zivilisation. Es werden verschiedene Kniebeugevarianten (parallele, halbe, viertel, tiefe Kniebeuge) beschrieben und die beteiligten anatomischen Strukturen (Sprunggelenk, Kniegelenk, Hüftgelenk, Lendenwirbelsäule) detailliert erläutert. Die biomechanischen Aspekte der unterschiedlichen Varianten werden ebenso behandelt, sowie populärwissenschaftliche Theorien und Modelle zum Thema Kniebeuge vorgestellt.
Schlüsselwörter
Kniebeuge, Belastungsanalyse, Überlastungsschäden, Anpassungseffekte, Biomechanik, Anatomie, Sprunggelenk, Kniegelenk, Hüftgelenk, Lendenwirbelsäule, funktionelles Training, Verletzungsrisiko, Kniebeugevarianten, Sportwissenschaft.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Dokument: Belastungsanalyse verschiedener Kniebeugevarianten
Was ist der Hauptfokus dieses Dokuments?
Der Hauptfokus liegt auf der Erstellung eines narrativen Reviews zum aktuellen Forschungsstand der Belastungsanalyse verschiedener Kniebeugevarianten. Es werden Überlastungsschäden und Anpassungseffekte berücksichtigt, basierend auf theoretischer und empirischer Literatur.
Welche Themen werden im Dokument behandelt?
Das Dokument behandelt die geschichtliche Entwicklung und Varianten der Kniebeuge, die biomechanische Analyse der Kniebeuge und der beteiligten Gelenke (Sprunggelenk, Kniegelenk, Hüftgelenk, Lendenwirbelsäule), Überlastungsschäden und Anpassungseffekte verschiedener Kniebeugevarianten, populärwissenschaftliche Theorien und Modelle zur Kniebeuge sowie eine Bewertung der Verletzungsrisiken verschiedener Techniken.
Welche Kniebeugevarianten werden im Detail betrachtet?
Das Dokument betrachtet verschiedene Kniebeugevarianten, darunter die parallele Kniebeuge, die halbe Kniebeuge, die viertel Kniebeuge und die tiefe Kniebeuge. Die biomechanischen Aspekte jeder Variante werden im Detail analysiert.
Welche anatomischen Strukturen werden im Zusammenhang mit der Kniebeuge untersucht?
Die Anatomie des Sprunggelenks, des Kniegelenks, des Hüftgelenks und der Lendenwirbelsäule wird detailliert erläutert, um die biomechanischen Vorgänge während der Kniebeuge zu verstehen.
Welche Art von Literatur wurde für dieses Dokument verwendet?
Das Dokument stützt sich auf relevante theoretische und empirische Forschungsliteratur zum Thema Kniebeuge, Belastungsanalyse und Verletzungsprophylaxe.
Welche Zielsetzung verfolgt dieses Dokument?
Das Ziel ist die Zusammenfassung des aktuellen Forschungsstandes zur Belastungsanalyse verschiedener Kniebeugevarianten unter Berücksichtigung möglicher Überlastungsschäden und Anpassungseffekte in einem narrativen Review.
Gibt es eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel?
Ja, das Dokument beinhaltet eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel: Einleitung und Problemstellung, Zielsetzung, Gegenwärtiger Kenntnisstand, Methodik, Ergebnisse, Diskussion und Zusammenfassung.
Welche Schlüsselwörter beschreiben das Dokument am besten?
Schlüsselwörter sind: Kniebeuge, Belastungsanalyse, Überlastungsschäden, Anpassungseffekte, Biomechanik, Anatomie, Sprunggelenk, Kniegelenk, Hüftgelenk, Lendenwirbelsäule, funktionelles Training, Verletzungsrisiko, Kniebeugevarianten, Sportwissenschaft.
Wie wird die Verletzungsgefahr bei der Kniebeuge behandelt?
Das Dokument behandelt die Verletzungsgefahr im Zusammenhang mit verschiedenen Kniebeugevarianten und bewertet die Risiken unterschiedlicher Techniken. Es untersucht auch Überlastungsschäden und Anpassungseffekte, um ein besseres Verständnis der Verletzungsprophylaxe zu ermöglichen.
An wen richtet sich dieses Dokument?
Das Dokument richtet sich an Personen, die sich wissenschaftlich mit der Kniebeuge, deren Biomechanik und den damit verbundenen Risiken auseinandersetzen möchten. Es ist insbesondere für akademische Zwecke und die Analyse von Themen in strukturierter und professioneller Weise geeignet.
Details
- Titel
- Kniebeugevarianten und ihre möglichen Überlastungsschäden und Anpassungseffekte. Eine Belastungsanalyse
- Hochschule
- Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement GmbH
- Note
- 1,3
- Autor
- Fabian Meder (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2020
- Seiten
- 53
- Katalognummer
- V986158
- ISBN (eBook)
- 9783346344441
- ISBN (Buch)
- 9783346344458
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Kniebeuge Bachelorarbeit Review Belastungsanalyse Überlastungsschäden Anpassungseffekte Knie Hüfte Sprunggelenk Lendenwirbelsäule
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 19,99
- Preis (Book)
- US$ 28,99
- Arbeit zitieren
- Fabian Meder (Autor:in), 2020, Kniebeugevarianten und ihre möglichen Überlastungsschäden und Anpassungseffekte. Eine Belastungsanalyse, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/986158
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-