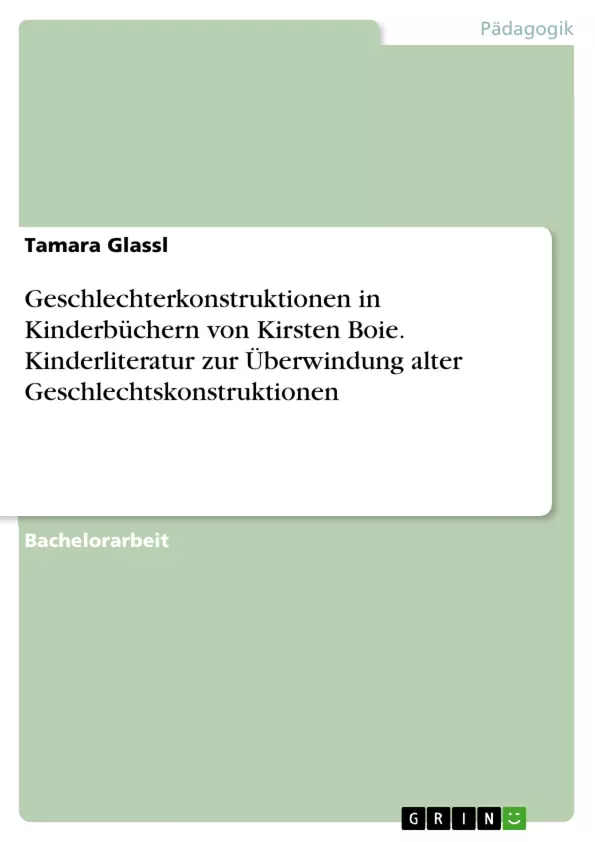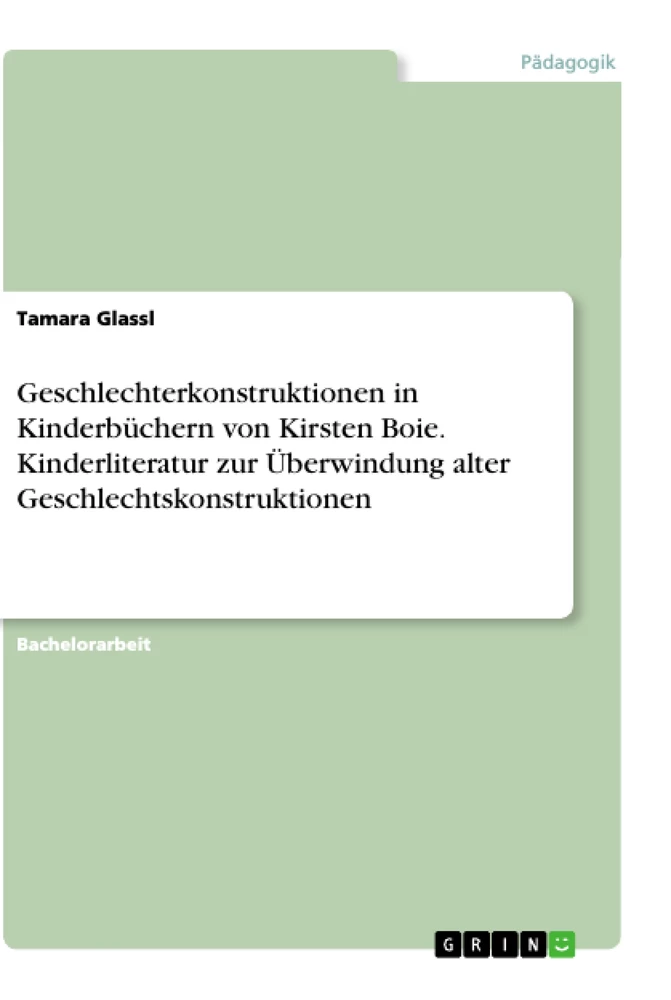
Geschlechterkonstruktionen in Kinderbüchern von Kirsten Boie. Kinderliteratur zur Überwindung alter Geschlechtskonstruktionen
Bachelorarbeit, 2020
64 Seiten, Note: 1,1
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Geschlechterstereotype
- 2.1 Produktion und Reproduktion von Geschlechterstereotypen: doing gender
- 2.1.1 Durch die Familie
- 2.1.2 Durch die Institution Schule
- 2.1.3 Durch Konsumgüter und Medien
- 2.2 Literatur und Geschlechterasymmetrien
- 3. Analyse ausgewählter Kinderbücher von Kirsten Boie
- 3.1 Die Autorin Kirsten Boie
- 3.2 Geschlechtsspezifische Unterschiede und Gemeinsamkeiten in ausgewählten Kinderbüchern
- 3.2.1 Repräsentation und Darstellung weiblicher und männlicher Figuren
- 3.2.2 Familiäre Strukturen und Freundschaften
- 3.2.3 Sprache
- 3.2.4 Genderstereotype und Reaktionen auf nicht genderstereotypes Verhalten
- 3.3 Exemplarische Analyse einzelner Schwerpunktthemen
- 3.3.1 Lena und Mathematik in „Lena hat nur Fußball im Kopf“
- 3.3.2 Chancen und Grenzen des Buches „Kann doch jeder sein wie er will“
- 4. Ausblick: Kirsten Boies Kinderbücher als geeignete Lektüre zur Sensibilisierung für Geschlechterasymmetrien
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die Darstellung von Geschlechterkonstruktionen in Kinderbüchern von Kirsten Boie. Ziel ist es, zu analysieren, inwieweit diese Bücher traditionelle Geschlechterstereotype überwinden oder reproduzieren. Die Arbeit beleuchtet die Entstehung und Reproduktion von Geschlechterstereotypen im Allgemeinen und untersucht anschließend exemplarisch ausgewählte Bücher von Boie auf ihre Darstellung von Geschlechterasymmetrien und -gerechtigkeit.
- Analyse der Entstehung und Reproduktion von Geschlechterstereotypen
- Untersuchung der Repräsentation weiblicher und männlicher Figuren in Kirsten Boies Kinderbüchern
- Bewertung der sprachlichen Gestaltung und ihrer Wirkung auf die Geschlechterdarstellung
- Auswertung der Darstellung familiärer Strukturen und Freundschaften
- Beurteilung des Potenzials von Kirsten Boies Büchern zur Sensibilisierung für Geschlechterasymmetrien
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Geschlechterrollen und -stereotype ein und erläutert den Wandel vom traditionellen Rollenbild hin zur angestrebten Gleichberechtigung. Sie hebt die Bedeutung von Kinderliteratur für die Sensibilisierung von Kindern für Geschlechterasymmetrien hervor und benennt die zentrale Forschungsfrage der Arbeit: Inwieweit gelingt es moderner Kinderliteratur, alte Geschlechterkonstruktionen zu überwinden und welche Geschlechterstereotype werden in Kirsten Boies Büchern aufgebrochen, bestehen bleiben oder neu konstruiert? Die Einleitung skizziert den methodischen Ansatz der Arbeit, der darin besteht, ausgewählte Geschichten von Kirsten Boie zu analysieren, um das Bild von Geschlechterasymmetrien und -gerechtigkeit zu untersuchen.
2. Geschlechterstereotype: Dieses Kapitel definiert Geschlechterstereotype als stark vereinfachte, generalisierende und starre Meinungen über Verhaltensweisen und Eigenschaften, die den Mitgliedern einer Geschlechtergruppe zugeschrieben werden. Es wird der Unterschied zwischen deskriptiven und präskriptiven Anteilen von Stereotypen herausgearbeitet und wie diese im Alltag zur Legitimation bestimmter Verhaltensweisen verwendet werden. Das Kapitel analysiert die Ähnlichkeiten von Frauen- und Männerstereotypen in verschiedenen Kulturen und beleuchtet, wie diese Stereotype bereits im Kindesalter durch Komplimente und Sanktionen geprägt werden. Der Einfluss von auffälligen Merkmalen, eigenen Erfahrungen und Sprache auf die Bildung geschlechtsstereotypischer Vorstellungen wird diskutiert, wobei der Zusammenhang zwischen dem Merkmal „männlich“ oder „weiblich“ und der hierarchischen Anordnung gesellschaftlicher Chancen, Grenzen und Barrieren hervorgehoben wird. Schließlich werden die Gender Studies als Forschungsfeld eingeführt, das sich mit den Ursachen und Wirkungszusammenhängen von Geschlechterdifferenzen beschäftigt.
Schlüsselwörter
Geschlechterstereotype, Geschlechterkonstruktionen, Kinderliteratur, Kirsten Boie, Gender Studies, Geschlechterasymmetrien, Geschlechtergerechtigkeit, Rollenbilder, Figurenkonstellation, Sprache, Sensibilisierung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Bachelorarbeit: Geschlechterkonstruktionen in Kinderbüchern von Kirsten Boie
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Diese Bachelorarbeit untersucht die Darstellung von Geschlechterkonstruktionen in ausgewählten Kinderbüchern der Autorin Kirsten Boie. Im Mittelpunkt steht die Analyse, inwieweit diese Bücher traditionelle Geschlechterstereotype reproduzieren oder überwinden.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit analysiert die Entstehung und Reproduktion von Geschlechterstereotypen im Allgemeinen und untersucht spezifisch, wie Geschlechterasymmetrien und -gerechtigkeit in den Büchern von Kirsten Boie dargestellt werden. Es werden die Repräsentation weiblicher und männlicher Figuren, die sprachliche Gestaltung, familiäre Strukturen und Freundschaften sowie das Potential der Bücher zur Sensibilisierung für Geschlechterasymmetrien bewertet.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit umfasst eine Einleitung, ein Kapitel zu Geschlechterstereotypen (inkl. deren Entstehung und Reproduktion durch Familie, Schule und Medien), eine Analyse ausgewählter Kinderbücher von Kirsten Boie (inkl. Figurenkonstellation, Sprache und Darstellung von Genderstereotypen), und einen Ausblick auf das Potential der Bücher zur Sensibilisierung. Konkrete Beispiele aus den Büchern, wie "Lena hat nur Fußball im Kopf" und "Kann doch jeder sein wie er will", werden analysiert.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: Eine Einleitung, ein Kapitel zu Geschlechterstereotypen, ein Kapitel zur Analyse der Kinderbücher von Kirsten Boie (mit Unterkapiteln zur Autorin, geschlechtsspezifischen Unterschieden in den Büchern, exemplarischen Analysen einzelner Themen) und ein abschließender Ausblick.
Welche Methoden werden verwendet?
Die Arbeit verwendet eine qualitative Inhaltsanalyse ausgewählter Kinderbücher von Kirsten Boie, um die Darstellung von Geschlechterasymmetrien und -gerechtigkeit zu untersuchen.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Schlüsselbegriffe sind: Geschlechterstereotype, Geschlechterkonstruktionen, Kinderliteratur, Kirsten Boie, Gender Studies, Geschlechterasymmetrien, Geschlechtergerechtigkeit, Rollenbilder, Figurenkonstellation, Sprache, Sensibilisierung.
Welche Forschungsfrage steht im Zentrum der Arbeit?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Inwieweit gelingt es moderner Kinderliteratur, alte Geschlechterkonstruktionen zu überwinden und welche Geschlechterstereotype werden in Kirsten Boies Büchern aufgebrochen, bestehen bleiben oder neu konstruiert?
Welche Aspekte der Geschlechterstereotype werden betrachtet?
Die Arbeit betrachtet sowohl deskriptive als auch präskriptive Aspekte von Geschlechterstereotypen und analysiert deren Einfluss auf die Darstellung von Figuren, Handlungssträngen und Sprache in den Büchern.
Welche Rolle spielt die Sprache in der Analyse?
Die sprachliche Gestaltung der Bücher und deren Wirkung auf die Geschlechterdarstellung wird als wichtiger Aspekt der Analyse betrachtet.
Welches Potential wird den Büchern von Kirsten Boie zugeschrieben?
Die Arbeit untersucht das Potential der Bücher von Kirsten Boie, Kinder für Geschlechterasymmetrien zu sensibilisieren und zu einem kritischen Umgang mit Geschlechterrollen anzuregen.
Details
- Titel
- Geschlechterkonstruktionen in Kinderbüchern von Kirsten Boie. Kinderliteratur zur Überwindung alter Geschlechtskonstruktionen
- Hochschule
- Pädagogische Hochschule Heidelberg
- Note
- 1,1
- Autor
- Tamara Glassl (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2020
- Seiten
- 64
- Katalognummer
- V990069
- ISBN (eBook)
- 9783346352606
- ISBN (Buch)
- 9783346352613
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- geschlechterkonstruktionen kinderbüchern kirsten boie kinderliteratur überwindung geschlechtskonstruktionen
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 31,99
- Preis (Book)
- US$ 44,99
- Arbeit zitieren
- Tamara Glassl (Autor:in), 2020, Geschlechterkonstruktionen in Kinderbüchern von Kirsten Boie. Kinderliteratur zur Überwindung alter Geschlechtskonstruktionen, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/990069
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-