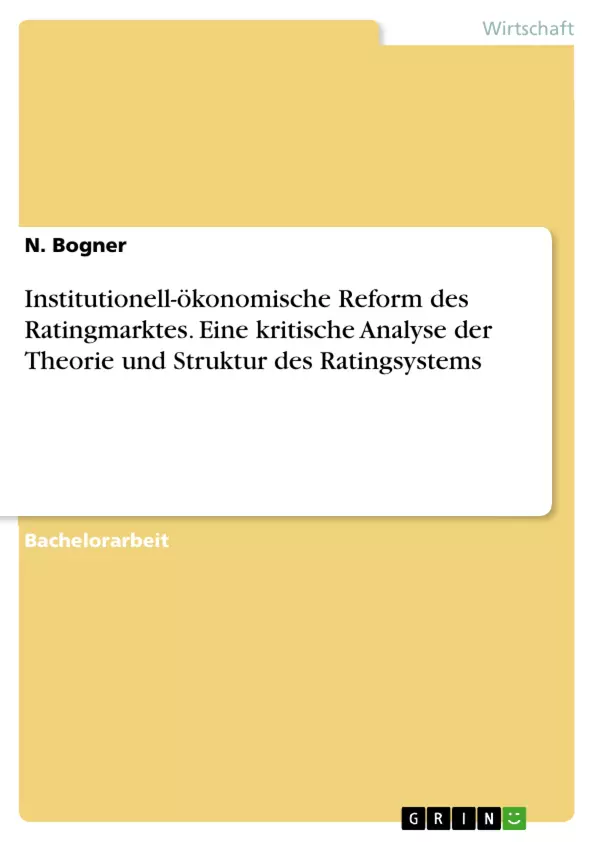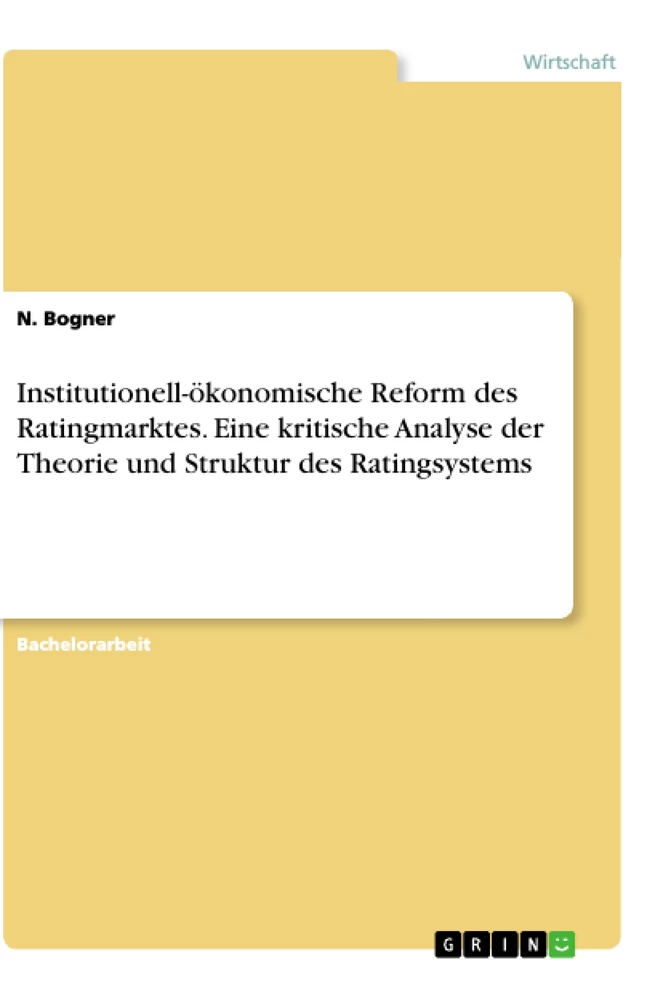
Institutionell-ökonomische Reform des Ratingmarktes. Eine kritische Analyse der Theorie und Struktur des Ratingsystems
Bachelorarbeit, 2020
65 Seiten, Note: 1,7
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- 1. Problemstellung
- 2. Rating als zentrales Instrument des Finanzmarktes
- 2.1 Historische Entwicklung des Ratingsystems
- 2.2 Komplikationen, Krisen, Konsequenzen – Exemplarische Darstellung der globalen Finanzkrise 2007-2009 als Ratingkrise
- 2.3 Moderner Ratingmarkt und das Oligopol der Big Three
- 3. Theoretische Grundlage & ökonomische Funktion des Ratings
- 3.1 Theorie der Rating-Intermediation
- 3.1.1 Ökonomische Funktion des Ratings
- 3.1.2 Empirische Fundierung des Intermediationseffektes
- 3.2 Rating-Dekomposition
- 3.2.1 Formen
- 3.2.2 Kriterien
- 3.2.3 Skalen
- 3.2.4 Aussagekraft
- 3.2.5 Risikoprämien unter Betrachtung des europäischen Anleihenmarkts
- 3.3 Systemische Interessensproblematik
- 3.3.1 Interessenkollision als Folge eines verzerrten Anreizsystems
- 3.3.2 Reputationsmechanismus als Ansatz der Selbstregulation
- 3.4 Relevanz des Ratings – Ein Zwischenfazit
- 3.1 Theorie der Rating-Intermediation
- 4. Reformperspektiven des Ratingsystems
- 4.1 Rating-Reformen in Folge der Weltfinanzkrise
- 4.1.1 Grundzüge der Regulierungstheorie
- 4.1.2 Reformmaßnahmen der USA
- 4.1.3 Reformmaßnahmen der EU
- 4.1.4 Maßnahmen auf supranationaler Ebene – Ein Blick auf Basel III
- 4.2 Kritische Würdigung des Konkurrenz-Ansatzes
- 4.3 Institutionell-ökonomische Reform - Ein theoretisches Konstrukt
- 4.3.1 Deprivatisierung
- 4.3.2 Supranationale Monopolisierung
- 4.1 Rating-Reformen in Folge der Weltfinanzkrise
- 5. Fazit & Schlussfolgerung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert kritisch die Theorie und Struktur des Ratingsystems und untersucht institutionell-ökonomische Reformansätze. Ziel ist es, die ökonomische Macht der Ratingagenturen zu erklären und mögliche Reformen zur Verbesserung der Marktstabilität zu evaluieren.
- Die historische Entwicklung und die aktuelle Struktur des Ratingmarktes
- Die ökonomische Funktion von Ratings und die Theorie der Rating-Intermediation
- Die Rolle der Ratingagenturen in der globalen Finanzkrise 2007/2009
- Mögliche Reformen des Ratingsystems, insbesondere die Institutionell-ökonomische Reform
- Die Interessenkonflikte im Ratingsystem und deren Auswirkungen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Problemstellung: Die Arbeit beginnt mit der Feststellung der erheblichen ökonomischen Macht der Ratingagenturen, insbesondere im Kontext der Finanzkrise 2007/2009. Es wird die Frage aufgeworfen, wie diese Macht entstanden ist und wie sie reguliert werden kann. Die Bedeutung von Ratings im kreditbasierten Wirtschaftssystem wird hervorgehoben, wobei ihre Einflussnahme auf Kreditvergabe, Zinsen und Investitionsentscheidungen betont wird. Der Bezug zu Theorien von Schumpeter, Olson, Acemoglu und Robinson legt den Verdacht nahe, dass extraktive Institutionen auf den Finanzmärkten zum Nutzen einer Oligarchie aufgebaut wurden.
2. Rating als zentrales Instrument des Finanzmarktes: Dieses Kapitel beleuchtet die historische Entwicklung des Ratingsystems, beginnend mit seinen Ursprüngen bis hin zum modernen Oligopol der "Big Three". Es analysiert die globale Finanzkrise als exemplarische Ratingkrise, unterstreicht die Rolle der Agenturen als wesentliche Treiber der Krise und deren scheinbar unbeeinflusste Präsenz danach. Der Fokus liegt auf den Komplikationen, Krisen und Konsequenzen des Systems. Die Darstellung der Marktanteile der großen Ratingagenturen und die Struktur des Marktes werden detailliert untersucht.
3. Theoretische Grundlage & ökonomische Funktion des Ratings: Hier wird die theoretische Grundlage des Ratingsystems erörtert, insbesondere die Theorie der Rating-Intermediation und ihre empirische Fundierung. Das Kapitel analysiert die Dekomposition von Ratings (Formen, Kriterien, Skalen, Aussagekraft) und deren Einfluss auf Risikoprämien am europäischen Anleihenmarkt. Ein zentraler Aspekt ist die systemische Interessenproblematik, einschließlich der Interessenkollisionen und des Reputationsmechanismus als Ansatz der Selbstregulierung. Das Kapitel schließt mit einem Zwischenfazit zur Relevanz des Ratings.
4. Reformperspektiven des Ratingsystems: Dieses Kapitel befasst sich mit verschiedenen Reformansätzen des Ratingsystems, insbesondere den Reformen nach der Weltfinanzkrise. Es analysiert die Grundzüge der Regulierungstheorie und beleuchtet Reformmaßnahmen in den USA, der EU und auf supranationaler Ebene (Basel III). Die kritische Würdigung des Konkurrenzansatzes wird ebenso behandelt wie ein theoretisches Konstrukt einer institutionell-ökonomischen Reform, inklusive Deprivatisierung und supranationaler Monopolisierung.
Schlüsselwörter
Ratingagenturen, Finanzmarkt, Globale Finanzkrise, Rating-Intermediation, Regulierung, Institutionell-ökonomische Reform, Oligopol, Risikoprämien, Interessenkonflikt, Basel III, Kreditwürdigkeit, Marktstabilität
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: "Analyse des Ratingsystems und institutionell-ökonomische Reformansätze"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert kritisch das Ratingssystem, seine ökonomische Funktion und seine Rolle in der globalen Finanzkrise 2007/2009. Ein Schwerpunkt liegt auf der Untersuchung möglicher institutionell-ökonomischer Reformen zur Verbesserung der Marktstabilität und zur Eindämmung der Macht der Ratingagenturen.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit behandelt die historische Entwicklung des Ratingsystems, die Theorie der Rating-Intermediation, die Interessenkonflikte im System, die Rolle der Ratingagenturen in der Finanzkrise, verschiedene Reformansätze (inklusive der Reformen nach der Finanzkrise in den USA, der EU und auf supranationaler Ebene – Basel III), und ein theoretisches Konstrukt einer institutionell-ökonomischen Reform (Deprivatisierung und supranationale Monopolisierung).
Welche theoretischen Grundlagen werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf Theorien der Regulierung, der Rating-Intermediation und institutionell-ökonomischer Ansätze. Es werden auch die Arbeiten von Schumpeter, Olson, Acemoglu und Robinson herangezogen, um die Entstehung und den Charakter extraktiver Institutionen auf den Finanzmärkten zu beleuchten.
Welche Rolle spielten die Ratingagenturen in der globalen Finanzkrise 2007-2009?
Die Arbeit analysiert die globale Finanzkrise als exemplarische Ratingkrise und untersucht die Rolle der Ratingagenturen als wesentliche Treiber der Krise. Der scheinbar unbeeinflusste Fortbestand der Agenturen nach der Krise wird ebenfalls kritisch beleuchtet.
Welche Reformansätze werden diskutiert?
Die Arbeit diskutiert verschiedene Reformansätze, darunter die nach der Finanzkrise eingeleiteten Reformen in den USA und der EU sowie Maßnahmen auf supranationaler Ebene (Basel III). Ein besonderer Fokus liegt auf einem theoretischen Konstrukt einer institutionell-ökonomischen Reform, welches Deprivatisierung und supranationale Monopolisierung der Ratingagenturen umfasst.
Was ist das Fazit der Arbeit?
Das Fazit fasst die Ergebnisse der Analyse zusammen und bewertet die diskutierten Reformansätze. Es wird eine Einschätzung abgegeben, wie die ökonomische Macht der Ratingagenturen eingeschränkt und die Marktstabilität verbessert werden kann.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant für das Verständnis der Arbeit?
Zu den wichtigsten Schlüsselbegriffen gehören: Ratingagenturen, Finanzmarkt, Globale Finanzkrise, Rating-Intermediation, Regulierung, Institutionell-ökonomische Reform, Oligopol, Risikoprämien, Interessenkonflikt, Basel III, Kreditwürdigkeit, Marktstabilität.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in fünf Kapitel gegliedert: Problemstellung, Rating als zentrales Instrument des Finanzmarktes, Theoretische Grundlage & ökonomische Funktion des Ratings, Reformperspektiven des Ratingsystems und Fazit & Schlussfolgerung. Jedes Kapitel wird detailliert im Inhaltsverzeichnis aufgeführt.
Details
- Titel
- Institutionell-ökonomische Reform des Ratingmarktes. Eine kritische Analyse der Theorie und Struktur des Ratingsystems
- Hochschule
- Bergische Universität Wuppertal (Europäisches Institut für Internationale Wirtschaftsbeziehungen)
- Note
- 1,7
- Autor
- N. Bogner (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2020
- Seiten
- 65
- Katalognummer
- V990557
- ISBN (eBook)
- 9783346369062
- ISBN (Buch)
- 9783346369079
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Ratingsystem Ratingmarkt ökonomische Reform Reformpolitik Big Three Moody's Fitch Standard & Poor's Reform Institution Institutionell-ökonomische Reform Struktur und Theorie des Ratingsystems Rating Ratingklasse Ratingnote
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 20,99
- Preis (Book)
- US$ 31,99
- Arbeit zitieren
- N. Bogner (Autor:in), 2020, Institutionell-ökonomische Reform des Ratingmarktes. Eine kritische Analyse der Theorie und Struktur des Ratingsystems, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/990557
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-