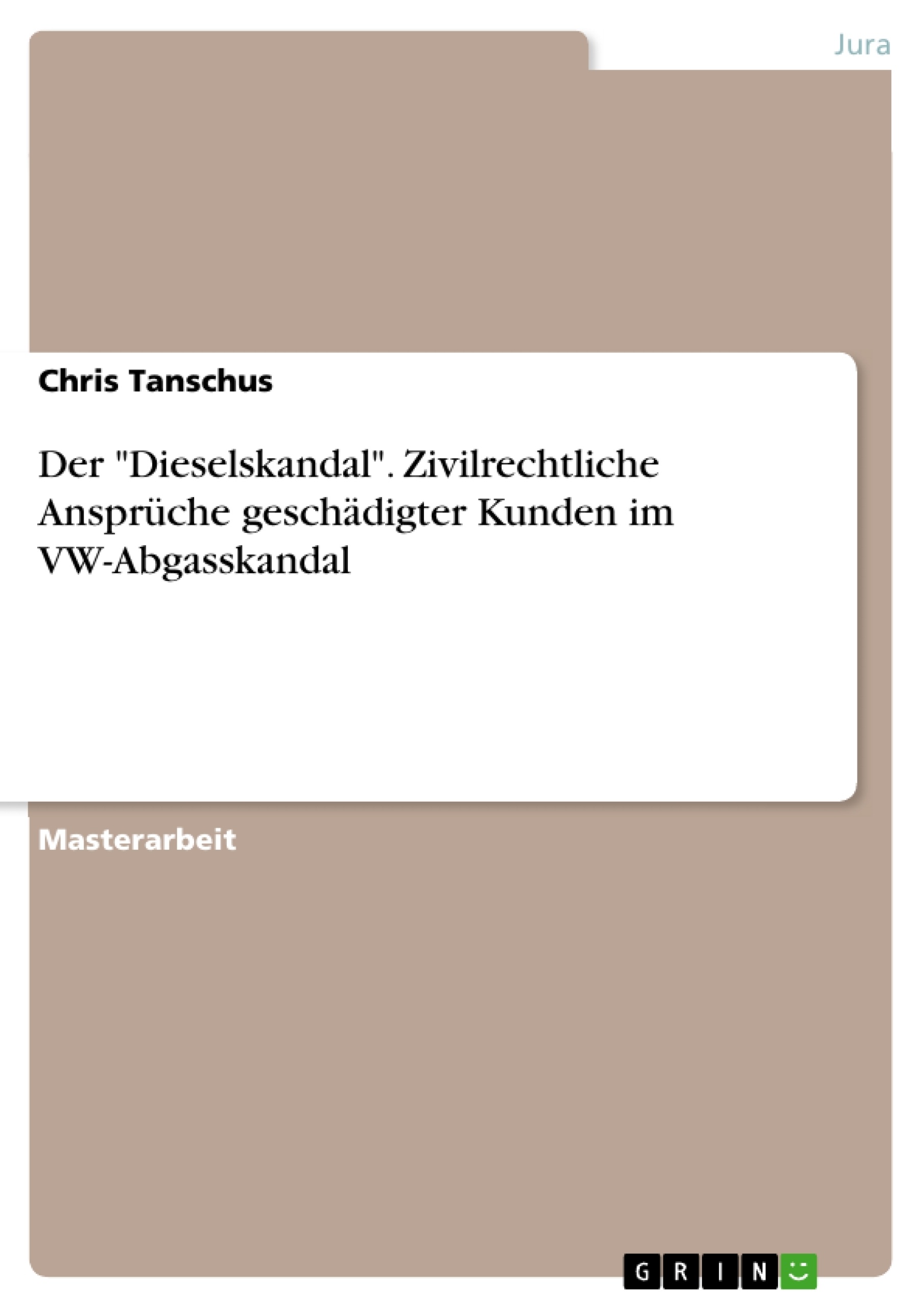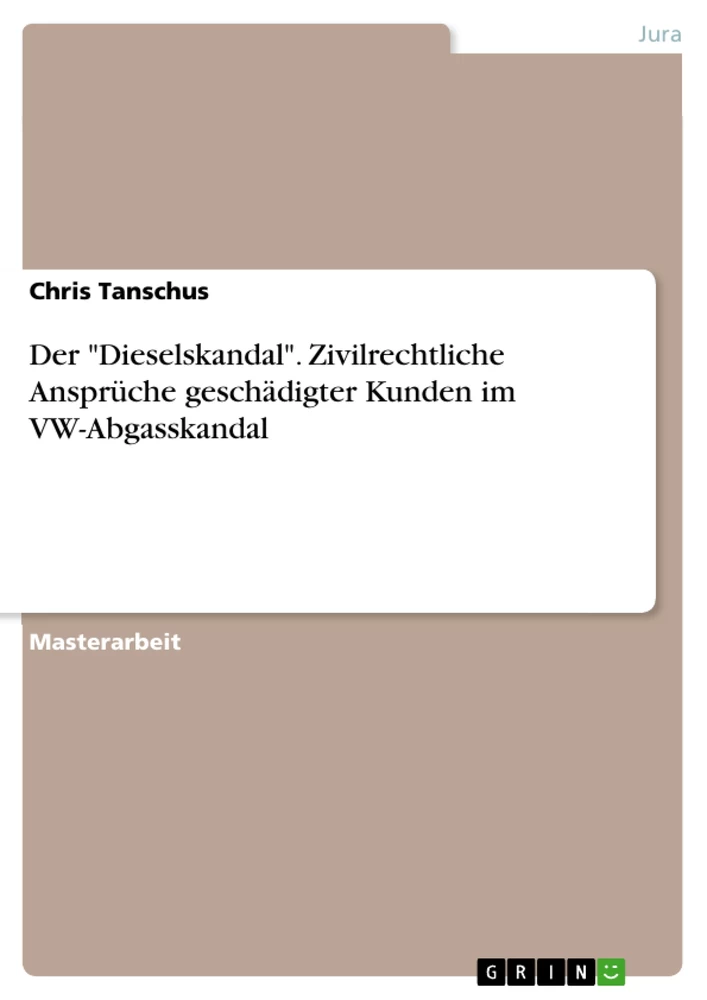
Der "Dieselskandal". Zivilrechtliche Ansprüche geschädigter Kunden im VW-Abgasskandal
Masterarbeit, 2020
54 Seiten, Note: 2,0
Jura - Zivilrecht / Handelsrecht, Gesellschaftsrecht, Kartellrecht, Wirtschaftsrecht
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Dieselskandal
- Hintergrund aus dem Europarecht
- Abschalteinrichtungen in Typ EA 189 Motoren
- Kaufrechtliche Ansprüche gegenüber dem Händler
- Vorliegen eines Mangels § 434 I BGB
- Ansprüche im Gewährleistungsrecht
- Nachbesserung § 439 I Alt. 1 BGB
- Neulieferung § 439 1 Alt. 2 BGB
- Keine Verjährung der Ansprüche
- Deliktsrechtliche Ansprüche gegenüber dem Hersteller
- Anspruch aus § 826 BGB - Vorsätzliche sittenwidrige Schädigung
- Schaden
- Sittenwidrigkeit
- Haftungsbegründende Kausalität
- Subjektive Voraussetzungen für eine Haftung gemäß §§ 826, 31 BGB
- Rechtsfolge als Schadensersatz aus §§ 249 ff. BGB
- Erwerb nach Offenlegung des Skandals/Verjährung der Ansprüche
- Anspruch aus § 826 BGB - Vorsätzliche sittenwidrige Schädigung
- Abschließende Bewertung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit untersucht die zivilrechtlichen Aspekte des Dieselskandals, indem sie kauf- und deliktsrechtliche Ansprüche gegen Händler und Hersteller beleuchtet. Der Fokus liegt auf der Analyse der Rechtslage und der Prüfung der Erfolgsaussichten betroffener Käufer.
- Kaufrechtliche Ansprüche bei Mängeln an Fahrzeugen mit manipulierten Abgassystemen
- Deliktsrechtliche Ansprüche gegen den Hersteller aufgrund sittenwidrigen Verhaltens
- Bedeutung von Abschalteinrichtungen und deren rechtliche Konsequenzen
- Analyse der Beweislastverteilung bei Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüchen
- Verjährung von Ansprüchen im Kontext des Dieselskandals
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des Dieselskandals und die Zielsetzung der Arbeit ein. Sie skizziert den Aufbau und die Methodik der Untersuchung der zivilrechtlichen Ansprüche.
Der Dieselskandal: Dieses Kapitel beschreibt den Dieselskandal in seinen wesentlichen Aspekten, beleuchtet die beteiligten Akteure und die Auswirkungen auf die betroffenen Verbraucher. Es dient als Grundlage für die folgenden Kapitel, die die rechtlichen Aspekte vertiefen.
Hintergrund aus dem Europarecht: Der Abschnitt beleuchtet die europäischen Rechtsgrundlagen im Bereich der Abgasreinigung und -vorschriften, die den Hintergrund für die juristische Auseinandersetzung mit dem Dieselskandal bilden. Die Darstellung des relevanten Europarechts schafft die Basis für das Verständnis der nationalen Rechtsanwendung.
Abschalteinrichtungen in Typ EA 189 Motoren: Dieses Kapitel beschreibt detailliert die Funktionsweise der manipulierten Abschalteinrichtungen im EA 189 Motor und analysiert deren technische und juristische Relevanz im Hinblick auf die geltenden Abgasnormen. Die genaue Erläuterung der technischen Mechanismen ist essenziell für die Bewertung der Rechtslage.
Kaufrechtliche Ansprüche gegenüber dem Händler: Dieser Abschnitt analysiert die kaufrechtlichen Ansprüche der Käufer gegen den Händler. Es wird geprüft, ob ein Mangel im Sinne des § 434 I BGB vorliegt und welche Gewährleistungsansprüche (§ 439 I BGB) sich daraus ergeben. Die Ausführungen befassen sich mit der Nachbesserung, der Neulieferung sowie der Frage der Verjährung. Die verschiedenen Szenarien und die damit verbundenen rechtlichen Konsequenzen werden umfassend diskutiert.
Deliktsrechtliche Ansprüche gegenüber dem Hersteller: Dieses Kapitel befasst sich mit den deliktsrechtlichen Ansprüchen der Käufer gegen den Hersteller auf der Grundlage von § 826 BGB (vorsätzliche sittenwidrige Schädigung). Es werden die Voraussetzungen für einen solchen Anspruch detailliert geprüft, einschließlich Schaden, Sittenwidrigkeit, Kausalität und Vorsatz. Die Problematik der Haftung juristischer Personen wird ebenfalls behandelt und die Rechtsfolgen im Hinblick auf den Schadensersatz werden dargestellt. Der Erwerb von Fahrzeugen nach Bekanntwerden des Skandals und die damit verbundene Verjährung der Ansprüche werden ebenfalls adressiert.
Schlüsselwörter
Dieselskandal, Abgasskandal, Volkswagen, Kaufrecht, Gewährleistungsrecht, Deliktsrecht, § 826 BGB, Sittenwidrigkeit, Schadensersatz, Mangel, Abschalteinrichtung, EA 189 Motor, Europarecht, Verjährung, Beweislast, Nutzungsvorteile.
Häufig gestellte Fragen zum Dieselskandal: Zivilrechtliche Ansprüche
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Masterarbeit analysiert die zivilrechtlichen Ansprüche von Käufern von Fahrzeugen mit manipulierten Abgassystemen (Dieselskandal) gegenüber Händlern und Herstellern. Sie untersucht sowohl kaufrechtliche als auch deliktsrechtliche Ansprüche und bewertet deren Erfolgsaussichten.
Welche Ansprüche werden im Kaufrecht untersucht?
Die Arbeit untersucht die Ansprüche aus dem Kaufrecht (§§ 434 ff. BGB), insbesondere die Rechte auf Nachbesserung (§ 439 I Alt. 1 BGB) und Neulieferung (§ 439 I Alt. 2 BGB) bei Mängeln an Fahrzeugen mit manipulierten Abgassystemen. Dabei wird auch die Frage der Verjährung dieser Ansprüche behandelt.
Welche Ansprüche werden im Deliktsrecht untersucht?
Im Bereich des Deliktsrechts wird der Anspruch aus § 826 BGB (vorsätzliche sittenwidrige Schädigung) gegen den Hersteller analysiert. Hierbei werden die Voraussetzungen für einen solchen Anspruch detailliert geprüft, darunter Schaden, Sittenwidrigkeit, Kausalität und der Vorsatz des Herstellers. Die Rechtsfolgen (Schadensersatz) und die Problematik der Haftung juristischer Personen werden ebenfalls erörtert.
Welche Rolle spielen die Abschalteinrichtungen?
Die Arbeit beschreibt detailliert die Funktionsweise der manipulierten Abschalteinrichtungen im EA 189 Motor und analysiert deren technische und juristische Relevanz im Hinblick auf die geltenden Abgasnormen. Diese technische Beschreibung ist Grundlage für die rechtliche Bewertung der Ansprüche.
Welche Bedeutung hat das Europarecht?
Die Arbeit beleuchtet die europäischen Rechtsgrundlagen im Bereich der Abgasreinigung und -vorschriften, die den Hintergrund für die juristische Auseinandersetzung mit dem Dieselskandal bilden. Das Verständnis des Europarechts ist essenziell für die nationale Rechtsanwendung.
Wie wird die Beweislast behandelt?
Die Arbeit analysiert die Beweislastverteilung bei Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüchen im Kontext des Dieselskandals. Die konkrete Zuweisung der Beweislast ist für den Erfolg der Ansprüche entscheidend.
Welche Rolle spielt die Verjährung?
Die Verjährung von Ansprüchen im Kontext des Dieselskandals, sowohl im Kauf- als auch im Deliktsrecht, wird umfassend diskutiert. Dabei wird besonders der Zeitpunkt des Erwerbs des Fahrzeugs im Verhältnis zum Bekanntwerden des Skandals berücksichtigt.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Zu den relevanten Schlüsselwörtern gehören: Dieselskandal, Abgasskandal, Volkswagen, Kaufrecht, Gewährleistungsrecht, Deliktsrecht, § 826 BGB, Sittenwidrigkeit, Schadensersatz, Mangel, Abschalteinrichtung, EA 189 Motor, Europarecht, Verjährung, Beweislast, Nutzungsvorteile.
Gegen wen richten sich die Ansprüche?
Die Ansprüche richten sich sowohl gegen den Händler (kaufrechtliche Ansprüche) als auch gegen den Hersteller (deliktsrechtliche Ansprüche).
Gibt es eine Zusammenfassung der Kapitel?
Ja, die Arbeit enthält eine Zusammenfassung jedes Kapitels, beginnend mit der Einleitung und endend mit der abschließenden Bewertung. Die Zusammenfassungen geben einen Überblick über den Inhalt der jeweiligen Kapitel.
Details
- Titel
- Der "Dieselskandal". Zivilrechtliche Ansprüche geschädigter Kunden im VW-Abgasskandal
- Hochschule
- Universität Rostock (juristische Fakultät)
- Note
- 2,0
- Autor
- Chris Tanschus (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2020
- Seiten
- 54
- Katalognummer
- V990782
- ISBN (eBook)
- 9783346353641
- ISBN (Buch)
- 9783346353658
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Dieselskandal Zivilrecht Abgas Skandal diesel-abgasskandal vw Gewährleistung Deliktsrecht Verbraucheransprüche Nacherfüllung Nachbesserung Deliktsrecht §826 Rücktritt Diesel Verbraucheransprüche Unmöglichkeit der Nachbesserung Neulieferung §439 BGB Zivilrecht Verjährung Ansprüche Zivilrecht Rücknahme Dieselfahrzeug Musterfeststellungsklage sittenwidrige Täuschung Winterkorn Volkswagen
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 19,99
- Preis (Book)
- US$ 28,99
- Arbeit zitieren
- Chris Tanschus (Autor:in), 2020, Der "Dieselskandal". Zivilrechtliche Ansprüche geschädigter Kunden im VW-Abgasskandal, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/990782
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-