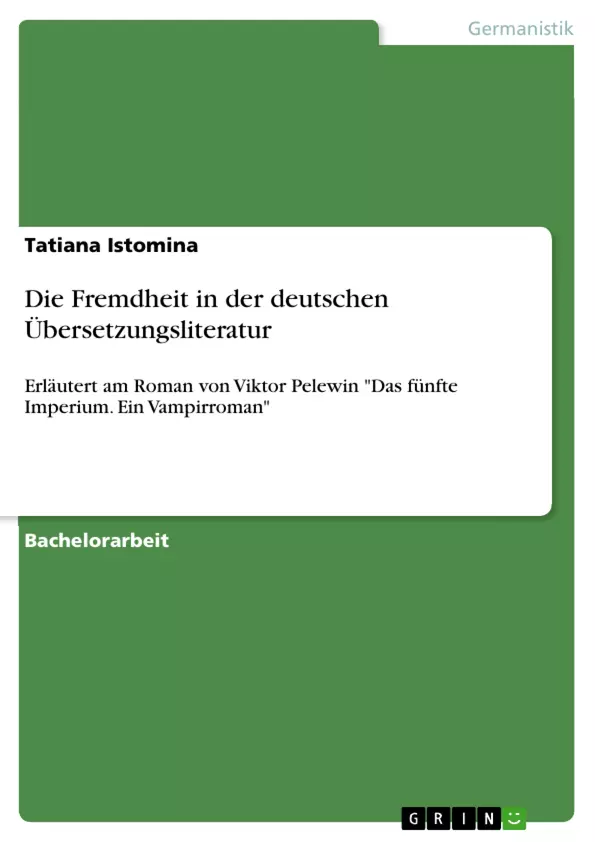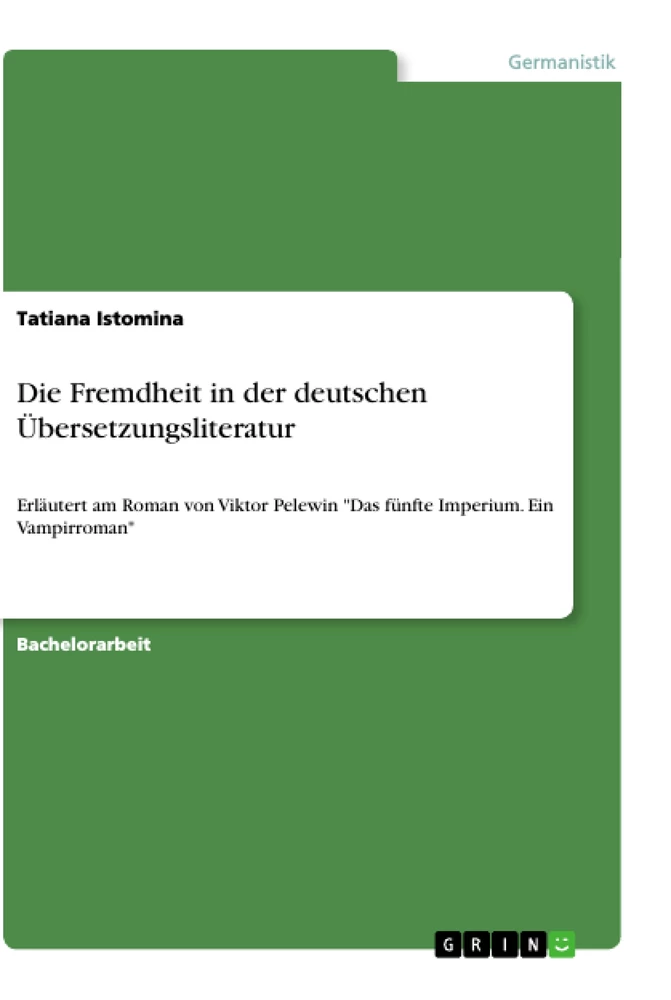
Die Fremdheit in der deutschen Übersetzungsliteratur
Bachelorarbeit, 2011
46 Seiten, Note: 2,0
Germanistik - Komparatistik, Vergleichende Literaturwissenschaft
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Fremdheit in der literaturwissenschaftlichen Fremdheitsforschung
2.1 Das Konzept der Fremdheit
2.2 Der Begriff der Fremdheit
2.3 Darstellungsformen der Fremdheit und ihre Funktionen
3 Fremdheit in der Übersetzungswissenschaft
3.1 Fremdheit als Übersetzungsproblem
3.2 Übersetzungsstrategien beim Umgang mit der Fremdheit
4 Viktor Pelewins Roman „Das fünfte Imperium. Ein Vampirroman“
4.1 Inhaltsangabe des Romans
4.2 Fremdheit im Originaltext und in der Übersetzung
5 Schlussbemerkung
6 Bibliographie
Danksagung
An dieser Stelle möchte ich allen Personen danken, die mich bei der Ausarbeitung meiner Bachelor-Arbeit tatkräftig unterstützt haben.
Der Frau Univ. Prof. Dr. Vogel und dem Herrn Dr. Jodl danke ich für die gute Betreuung und Unterstützung während des Verfassens meiner Arbeit.
Für die umfangreichen Gespräche, Hinweise, Korrekturen und Anregungen bin ich der Russischschule in Düsseldorf und hier insbesondere den Dozentinnen Katja Grupp und Anja Pollmann zu Dank verpflichtet.
Für die weiteren Hinweise zu einzelnen Textpassagen möchte ich darüber hinaus der Frau Dr. Pepetual Mforbe Chiangong von der Summer School beim Masterstudiengang Literaturübersetzen der Heinrich-Heine-Universität meinen Dank aussprechen.
1 Einleitung
Gegenstand der vorliegenden Untersuchung ist das Phänomen der Fremdheit und dessen Formen im literarischen Diskurs, dargestellt am Beispiel des russischen Romans „Das fünfte Imperium. Ein Vampirroman“ von Viktor Pelewin und dessen deutscher Übersetzung von Andreas Tretner.
Das Phänomen der Fremdheit ist ein komplexes und vielschichtiges Thema, das im Globalisierungskontext an Bedeutung gewinnt und innerhalb vieler Disziplinen untersucht wird. Ist man mit z.B. solchen Aspekten der Globalisierung wie Mehrsprachigkeit und Multikulturalismus konfrontiert, geht es vor allem um folgende Frage: Wie ist mit dem Fremden umzugehen, wie soll diese Fremdheit verstanden oder wiedergegeben werden? Fremdheitsforschung, sog. kulturwissenschaftliche Xenologie untersucht ein breites Spektrum. In der literaturwissenschaftlichen Fremdheitsforschung sind vor allem die sprachlichen Darstellungsformen der Fremdheit von Interesse. Neu an der Fragestellung ist die übersetzerische Perspektive, deshalb liegt der Fokus dieser Arbeit auf der Fremdheit aus linguistischer und übersetzerischer Perspektive.
Fremdheit wird in der modernen Literatur als literarisches Mittel der Postmoderne von vielen Autoren der ganzen Welt in zahlreichen Formen für verschiedene Ziele eingesetzt. Für diese Arbeit wurde der sowohl in Russland als auch in Deutschland erfolgreiche russische Schriftsteller Viktor Pelewin ausgewählt. Denn er gilt als bedeutender Autor der Postmoderne und setzt in seinen Werken häufig Fremdheit als Strategie in verschiedenen Formen ein. Der Roman „Das fünfte Imperium. Ein Vampirroman“ dient als Grundlage für die Untersuchung, weil dieser besonders stark von den literarischen Formen der Fremdheit geprägt ist: Der Autor mischt hier die russische Sprache mit der englischen. Diese sprachliche Fremdheit wird somit zum Problem des Lesers, der über Kenntnisse mehrerer Fremdsprachen verfügen muss, um den Text zu verstehen. Der Roman „Das fünfte Imperium. Ein Vampirroman“ wurde von Andreas Tretner ins Deutsche übersetzt, interessanterweise ist aber bei den deutschen Lesern weniger beliebt als die anderen Werke dieses Autors. Der Roman verursachte auch bei der Übersetzung Probleme, da der Übersetzer vor eine neue Aufgabe gestellt wurde, und zwar den Text, der an sich bereits fremd ist, in die deutsche Sprache zu übertragen. Da die Verfasserin dieser Arbeit Russisch als Muttersprache sowohl die deutsche als auch die englische Sprache als Fremdsprache beherrscht, ist dieser Roman eine optimale Basis, um als Expertin dieser drei Sprachen beurteilen zu können, ob die Übersetzung ins Deutsche gelungen ist oder nicht.
Ziel dieser Arbeit ist es, anhand des theoretischen Rahmens der literaturwissenschaftlichen Fremdheitsforschung innerhalb der interkulturellen Germanistik und der Übersetzungswissenschaft das Konzept von Fremdheit aus sprachwissenschaftlicher/übersetzungswissenschaftlicher Sicht näher zu untersuchen.
Dazu wird in Kapitel 2.1. dargestellt, wie Fremdheit in der aktuellen literaturwissenschaftlichen Fremdheitsforschung der interkulturellen Germanistik untersucht wird. Der Begriff der Fremdheit ist Thema des Kapitels 2.2. In Kapitel 2.3. wird auf die Formen der Fremdheit in der Literatur bzw. auf die sprachlichen Darstellungsweisen der Fremdheit im literarischen Diskurs eingegangen. Welche Funktion Fremdheit als literarisches Mittel im Roman erfüllt, wird das Kapitel 2.3. beantworten. Dabei wurde für die Untersuchung das Modell der diskursstrategischen Funktionen von Code-Switching aus den Daten der Gesprächsforschung auf die Analyse des literarischen Diskurses übertragen, was im Rahmen der Arbeit für sinnvoll gehalten wird, weil es dem aktuellen Forschungstand der Übersetzungswissenschaft der Literatur entspricht.
In Kapitel 3.1. wird auf Fremdheit als Übersetzungsproblem eingegangen. Das Kapitel 3.2. stellt die Strategien vor, die in der Übersetzungswissenschaft für die Übersetzung der Fremdheit verwendet werden.
In Kapitel 4. Erfolgt eine Übertragung der theoretischen Erkenntnisse auf den Roman „Das fünfte Imperium. Ein Vampirroman“. In Kapitel 4.1. wird eine Inhaltsangabe des Romans gegeben und in Kapitel 4.2. wird Fremdheit und deren Funktion an Beispielen aus diesem russischen Roman und seiner deutschen Übersetzung untersucht.
In Kapitel 5 wird abschließend ein Fazit gegeben.
2Fremdheit in der literaturwissenschaftlichen Fremdheitsforschung
In diesem Teil der vorliegenden Arbeit wird zunächst der Theorierahmen entwickelt, innerhalb dessen das Phänomen Fremdheit zu analysieren und zu erörtern ist. Aufgrund der Vielzahl verschiedener relevanter Fremdheitstheorien erhebt diese Arbeit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Außerdem ist zu beachten, dass viele Theorien oft sachlich keine strikte Unterscheidung zwischen Fremdheit und Andersheit vornehmen. Wobei eine strikte Unterscheidung problematisch wäre, da der Begriff Fremdheit in der deutschen Sprache auch die Bedeutung „das Anderen gehörende“1 umfasst und somit das Andere auch aufgreift.
2.1 Das Konzept der Fremdheit
Den Versuch, das Fremde und die Fremdheit zu erforschen, haben Vertreter verschiedener sozial- und geisteswissenschaftlicher Disziplinen unternommen. Die Entwicklung einer fächerübergreifenden kulturwissenschaftlichen Fremdheitsforschung ist jedoch sehr eng mit der Entwicklung der interkulturellen Germanistik verbunden:
Nur in dieser Disziplin [bilden] die Erfahrung kultureller Fremde, die Beziehung zwischen Eigenem und Fremdem und die entsprechende Relationskategorie Fremdheit einen fachkonstruktiven Begründungszusammenhang.2
Die interkulturelle Germanistik als Teil der angewandten Kulturwissenschaft erforscht interkulturelle Kommunikation sowohl hinsichtlich ihrer alltäglichen als auch ästhetischen, historischen, medialen und institutionellen Aspekten. Das Thema der Fremdheit bildet also einen ihrer Forschungsschwerpunkte.
Bereits seit den 1970er Jahren spielt die Kategorie des Fremden eine wichtige Rolle in der Theorie, wie sich z.B. in den Jahrbüchern „Deutsch als Fremdsprache“ nachvollziehen lässt. Diese Jahrbücher dienen denjenigen als Forum, die sich mit der Vermittlung der deutschen Sprache und Kultur beschäftigen, und sollen zudem das theoretische Fundament der Vermittlungstätigkeiten fördern.3 Im Jahr 1984 wurde die Gesellschaft für Interkulturelle Germanistik gegründet. Seit 1987 wurden interdisziplinäre Fremdheitsfragestellungen an der Bayreuther Universität in die Lehr- und Forschungspraxis eingebracht und kulturwissenschaftliche Xenologie, Fremdheitslehre, wurde als universitäres Fach eingeführt. Das Ziel der kulturwissenschaftlichen Xenologie ist die systematische Reflexion über Anderes als Fremdes, was in Bezug auf die moderne Globalisierungssituation an Bedeutung gewinnt. Die kulturwissenschaftliche Xenologie ist eng mit der interkulturellen Germanistik sowie literaturwissenschaftlichen, linguistischen, landeskundlichen und kulturvergleichenden Studien verknüpft. All diese Disziplinen beschäftigen sich mit xenologischen Perspektiven, besonders dadurch geprägt ist aber die Erforschung der deutschen Literatur:
In der Geschichte der deutschen Literatur lässt sich auf bequeme Weise der ganze Umkreis der Problematik des Fremden erkunden – und zwar nach der Themenstellung, nach inhaltlichen und ästhetischen Kategorien und Verfahrensweisen, nach Aspekten der Rezeption, Produktion und teilweise sogar der Distribution.4
Die Kategorie Fremdheit eröffnet demzufolge einen breiten gesellschaftlichen Problembereich mit großem Konfliktpotenzial; die Literatur bietet konkrete Beispiele für die Konstruktion des Fremden. Aus literaturwissenschaftlicher Sicht ist die Vielzahl an neuen ästhetischen Darstellungsformen der Fremdheit von besonderem Interesse.
Das vielschichtige Verhältnis Literatur-Fremde beschäftigt sich auch mit der Frage: „Wie vermittelt man Literatur über kulturelle Grenzen hinweg?“5, wobei die Ausgangsbedingungen und Perspektiven des Rezipienten in der Vermittlungssituation von zentraler Bedeutung sind. Es handelt sich laut Dietrich Krusche einerseits um die Konfrontation mit einem kulturellen Kontext, in dem Eigenes als Fremdes zu vermitteln ist; andererseits wird man nicht nur mit einer anderen Sprache, sondern auch mit einer fremdkulturellen gesellschaftlichen Wirklichkeit konfrontiert.6 Damit ist ein Grundproblem von Fremdheit und Literatur angesprochen. Das sehr komplexe Verhältnis Literatur-Fremde eröffnete Wissenschaftlern unzählige Themen und Fragestellungen, die in folgenden Punkten zusammengefasst werden sollen:
- Literatur als Vermittler von Fremdkultur,7
- Vermittlung von Literatur in fremdkulturellen Bildungsprozessen,8
- Fremderfahrungen in und mit Literatur.9
Zum Einen wird das kulturelle Fremde als ein Paradigma der literarischen Hermeneutik verstanden, zum Anderen werden die Voraussetzungen von Fremdheitswahrnehmungen und -konstruktionen, wie diese in der Literatur dargestellt werden, in den Vordergrund gerückt.
Diese Fragestellungen wurden zu drei Entwicklungslinien der Literaturfremdheitsforschung ausdifferenziert. Dabei geht die Entwicklung von der Literaturfremdheitsforschung zur (kulturwissenschaftlichen) Fremdheitsforschung.
Als erste Entwicklungslinie literaturwissenschaftlicher Fremdheitsforschung entwickelte sich die interkulturelle Hermeneutik. Es handelt sich dabei um die Gestaltung der Praxis von fremdkultureller Literaturvermittlung sowie um die Probleme der Didaktisierung bei kulturräumlichen Vermittlungsdifferenzen: „Unter der formelhaften Problemstellung ‹Eigenes als Fremdes› wird eine hermeneutische Vermittlungsdifferenz bearbeitet.“10
Unter der zweiten Entwicklungslinie literaturwissenschaftlicher Fremdheitsforschung versteht man die Auseinandersetzung mit literarisch vermittelten Fremdheitserfahrungen, Wahrnehmungen, Konstruktionen usw. Hier handelt sich nicht um die Bedeutung der Fremdheit als dargestelltes Phänomen, sondern als Erfahrungswirklichkeit.11
Die dritte Entwicklungslinie betrifft Fremdheit als pädagogisches Problem. Die zentrale Frage ist, ob Literatur als eine „Art Vorschulung für die Begegnung mit Fremdheit in konkreter Wirklichkeit“12 verstanden und vermittelt werden kann.
Die erste Entwicklungslinie ist für die Argumentation dieser Arbeit ausschlagegebend, da die Arbeit die Erarbeitung der Kompetenzen für den Umgang mit Fremdheit in der Literatur zum Ziel hat. Die Aktualität dieser Entwicklungslinie in moderner Globalisierungssituation betont auch Andrea Leskovec: „[U]nser Alltag fordert mehr denn je Kompetenzen für die Auseinandersetzung mit dem Fremden.“13
Daraus sei eine „Kultur des Friedens“14 zu entwickeln. Allerdings kritisiert Leskovec die interkulturelle Hermeneutik, hermeneutische Konzepte müssen laut Leskovec erweitert und ausgearbeitet werden: [E]in Wirklichkeitsverständnis, das die postmoderne Pluralität von Wirklichkeit und damit das Problem der Wahrnehmung nicht thematisiert, sowie das Vertrauen in hermeneutische Konzepte, die im Grunde auf eine Auflösung des Fremden im Eigenem und damit auf Konsensbildung und Harmonisierung von Gegensätzen hinauslaufen.15
Abschließend lässt sich sagen, dass das Thema Fremdheit auch in der Literatur an Bedeutung gewinnt. Man braucht spezifische Kompetenzen, um mit der Fremdheit umgehen zu können. Sie werden in der interkulturellen Hermeneutik, die in der interkulturellen Germanistik entwickelt wurde, erarbeitet. Andrea Leskovec erweitert diese Theorie. Im Folgenden wird daher Fremdheit als der Leitbegriff der interkulturellen Germanistik erläutert und die Dimensionen des Begriffs werden in Anlehnung an Leskovec im Rahmen ihres alternativen hermeneutischen Ansatzes für eine interkulturell ausgerichtete Literaturwissenschaft betrachtet.16
2.2 Der Begriff der Fremdheit
Bereits in den Anfängen der interkulturellen Germanistik wurde der Fremdheitsproblematik eine zentrale Rolle zugewiesen. Auf einem Symposium im Jahr 1990, veranstaltet von der Bayreuther interkulturellen Germanistik, wurde der Ausgangsbefund dieser Arbeit bestätigt, dass es noch keine klaren Fremdheitsbegriffe und systematischen Reflexionen zum Problem gibt.17 Die verschiedenen Dimensionen und konstitutiven Elemente des Begriffs Fremdheit sind zugleich die Komponenten der Kategorie Fremde, die einander wechselseitig bedingen und ergänzen und die ein komplexes Verhältnis zwischen dem Eigenen und dem Fremden darstellen. Diese Komplexität und Vielschichtigkeit lässt sich schwer in einer einzigen Definition abzubilden. In dem Entwurf einer kulturwissenschaftlichen Xenologie wurde jedoch von Alois Wierlacher eine prägnante Synthese dieser Aspekte formuliert:
Menschen erwerben eine fremde Sprache und sehen eine fremde Kultur immer durch den Filter ihrer eigenkulturellen Vorverständnisse und Vorbilder. Das ›Fremde‹ ist darum grundsätzlich als das aufgefasste Andere, als Interpretament der Andersheit und Differenz zu definieren. Es ist mithin keine objektive Größe und Eigenschaft des Fernen, Ausländischen, Nichteigenen, Ungewohnten, Unbekannten, des Unvertrauten oder Seltenen. Als Interpretament ist das Fremde wie alle gesellschaftliche Wirklichkeit aber auch keine nur subjektive Größe. Es besitzt eine merkwürdige Valenz, insofern es um die Andersheit und deren im Fremdheitsprofil der Wahrnehmung erscheinendes Sosein, um Assimilationen zwischen dem Fremden und dem Eigenen sowie darum geht, dass sich beide mit ihrer differenzierenden, Reiz und Spannung setzenden Interrelation (Wahrnehmung, Auffassung) selbst konstituieren und charakterisieren, so dass die Begriffe Andersheit und Fremdheit ihre Stellung wechseln können.18
Wierlacher stellt in diesem Entwurf auch fest, dass es in Deutschland viele einschlägige Veröffentlichungen gibt, die sich mit dem Fremden beschäftigen. Darin wird oft nur die Semantik von fremd angegangen, aber nur selten versucht, den Begriff Fremdheit zu definieren.19
Unter anderem werden von ihm zwei Ansätze der interkulturellen Germanistik zur Annäherung an den Begriff der Fremdheit als besonders wichtig angesehen. Der kultursemiotische Ansatz der interkulturellen Germanistik zur Erklärung des Begriffs basiert auf der Auslotung der Bedeutungsdimensionen. Im hermeneutischen Ansatz der interkulturellen Germanistik werden Aspekte des Fremden erklärt und somit „die hermeneutischen Voraussetzungen der Wahrnehmung des je Eigenen und des Interpretaments des Fremden“20 problematisiert. Die Fremdheit entsteht somit „erst durch die Interpretation“21 aus Andersheit und wird nach Wierlacher „als aufgefasstes Anderes“22 und als „Interpretament der Andersheit und Differenz“23 definiert.
Der kultursemiotische Ansatz untersucht die Semantik des Wortes fremd. Untersucht man die Semantik des Wortes fremd, trägt sie erheblich zur Unschärfe des Begriffs Fremdheit bei, weil der Begriff fremd bzw. Fremdheit polysem ist und je nach Kontext verschiedene Bedeutungen aufweist:
Den Begriff der Fremdheit gibt es gar nicht. Mit der Wendung ‚ der Begriff der Fremdheit‘ setzen wir voraus, dass es nur einen einzigen Begriff von Fremdheit gäbe. Fakt ist aber, dass fremd vielfach polysem ist.24
Das deutsche Wort fremd umfasst also ein breites Bedeutungsspektrum. Brigitte Jostes fasst dieses unter vier Bedeutungsvarianten:
1. Einem anderen Land, Volk, Ort, einer anderen Gegend, Stadt, Familie angehörend, aus einem anderen Land, Volk, Ort, einer anderen Gegend etc. stammend, von anderer Herkunft;
2. Einem anderen gehörend, einen anderen angehend, betreffend, bzw. anderer Leute;
3. Nicht bekannt, nicht vertraut, unbekannt, unvertraut, ungewohnt;
4. Nicht zu etwas, jemandem passend, andersartig, fremdartig, seltsam.25
Dabei betonen die ersten zwei Bedeutungsvarianten eine Zugehörigkeit bzw. Nichtzugehörigkeit, die dritte den Bereich der Kognition, die vierte die Abweichung von der „Normalität“26. Jostes betont den inneren Verweiszusammenhang dieser Bedeutungsvarianten, sie nennt es „ein Bedeutungskontinuum“27.
Diese Bedeutungsvarianten sind sehr unbestimmt. Erstens, weil sie sich explizit durch nicht oder durch das Wort anders, also über eine Negation konstituieren,28 und somit einen Negationscharakter aufweisen. Das Wort fremd verweist zugleich immer auf ein Nicht-Eigenes oder Anderes und stellt ein Verhältnis der Nichtidentität oder Verschiedenheit dar. Zweitens weisen diese Bedeutungsvarianten auf einen relativen, relationalen und deiktischen Verweischarakter hin. Das Wort fremd bedingt also die Bezugspunkte im Kontext. Diese können lokal (Örtlichkeit: Land, Ort etc.) oder personell (Gemeinschaft: Volk, Familie etc.) sein, oder beide Aspekte beinhalten. Die Bedeutungsvarianten weisen auch einen relationalen Charakter auf. Da der andere Ort immer in Beziehung zum eigenen Ort gesetzt wird, bezieht sich auch eine fremde Gruppe auf ein Ich oder eine Wir-Gruppe. Seltsam oder unbekannt kann demzufolge für jemanden etwas nur in Bezug auf seine eigenen Kenntnisse, Erfahrungen etc. sein.29
Herfried Münkler und Bernd Ladwig heben bei der Erörterung des Begriffs Fremd zwei Dimensionen der Bedeutung hervor: die soziale Bedeutungsdimension, die die Nichtzugehörigkeit eines Anderen betont und sich aus einer exkludierenden Grenzziehung ergibt, und die kulturelle Bedeutungsdimension, die auf Fremdheit im Sinne von Unvertrautheit Bezug nimmt.30 Wenn man diese Bedeutungsdimension untersucht, ist der Begriff Fremdheit ambivalent und hat emotive Bedeutungsanteile. Die Wörter fremd und Fremdheit haben auch im alltäglichen Sprachgebrauch Reizqualitäten. Zum einen werden damit Ängste angesprochen, die oft mit Menschen anderer Herkunft verbunden sind, zum anderen aber wird das Fremde bzw. die Fremdheit als Ort des Abenteuers, als Alternative zum eigenen Leben etc. verstanden, womit der Begriff noch eine andere Bedeutungskomponente hat.31
Im kultursemiotischen Ansatz ist vor allem die kulturelle Dimension des Begriffs von Bedeutung. Dabei geht es in der kulturwissenschaftlichen Fremdheitsforschung vor allem um die „kulturelle Fremdheit“32, oder in anderen Worten, um das Fremde aus der Perspektive der eigenen Kultur auf bestimmte andere Kulturen.33
Die interkulturelle Germanistik agiert somit mit einem kulturwissenschaftlichen Fremdheitsbegriff und hier vor allem mit dem Begriff des kulturellen Fremden. Daher wird in den Konzepten der interkulturellen Hermeneutik Fremdheit als kulturelle Fremdheit definiert. Der hermeneutische Ansatz der interkulturellen Germanistik (vertreten durch Wierlacher, Krusche, Weinrich) unternimmt dabei den Versuch, durch die Auslegung der Aspekte des Fremden die Fremdheit näher zu definieren, ohne die Semantik des Wortes anzugehen. Dies geschieht unter folgenden Aspekten:
1. Relationalität: Das Fremde ist abgängig von einer Konstellation und einem Standpunkt. Unter Fremdheit wird also ein Verhältnis verstanden, bei dem zwischen jeweils Eigenem und dem, was diesem nicht zugehörig ist, unterschieden wird. Das Fremde greift also auf das Eigene zurück und umgekehrt. Die Fremdheit ist somit relational, weil sie „keine eigene Qualität […], kein[en] Zustand, keine Eigenschaft“34 beschreibt, sondern lediglich auf „ein spezifisches Beziehungsverhältnis“35 verweist.
2. Dialektik von Eigenem und Fremdem: Das Eigene und das Fremde bedingen einander: Es gibt keine Vorstellung vom Fremden, wo es die Vorstellung vom Eigenen nicht gibt. Horst Turk betont: „Fremdheit [ist] ein kulturelles Interpretament der Andersheit oder die Andersheit [ist] ein kulturelles Interpretament der Fremdheit.“36
3. Fremdheit als Interpretament von Andersheit und Differenz: In anderen Worten: Nicht alles, was anders ist, ist gleichzeitig fremd,37 es gibt viele Differenzen in Bezug auf Personen oder Objekte, die als Andersheit zu bezeichnen sind, aber noch nicht als Fremdheit. Fremdheit entsteht erst durch eine Interpretation der Andersheit. Fremdheit ist somit ein Interpretament der „Andersheit“38 und der „Differenz“39.
4. Das Fremdheitsprofil: Dietrich Krusche versteht unter dem Fremdheitsprofil ein bestimmtes Profil, das Alteritäten gewinnt, wenn sie als fremd interpretiert werden. Dieses Profil geht auf das dialektische Verhältnis zwischen dem Eigenen und dem Fremden zurück, da beim Vergleich mit dem Eigenen bestimmte Merkmale an einer Person bzw. Sache als fremd interpretiert werden und somit zum Fremdheitsprofil werden. Das ist laut Krusche jedoch lediglich „eine virtuelle Struktur“40, deren Bildung von den Eigenschaften der wahrzunehmenden Person bzw. Sache und von der jeweiligen Beobachterperspektive abhängig ist.
5. Das Interpretament „fremd“ als kollektives Deutungsmuster: Als Teil der jeweiligen gesellschaftlichen Wirklichkeit und deren historischen und soziokulturellen Wandlungen ist das Interpretament „fremd“ in kollektive Deutungs- und Sinnbildungsprozesse eingebunden, weil die Wahrnehmungs- und Deutungsaktivität von vorherrschenden Modellen der jeweiligen Kultur und Gesellschaft abhängt. Hermann Bausinger betont, dass „der Einzelne sich selbst ja nicht nur in der Auseinandersetzung mit anderen, sondern auch in seiner kulturellen Ausstattung mit einer bestimmten Sprache, mit bestimmten Überlieferungen, bestimmten Eigenheiten der materiellen Kultur, mit Normen und Werten [erfährt]“41.
6. Affektiv besetzte Wahrnehmungsmuster: Die jeweilige Wahrnehmung basiert auch auf individual- und sozialpsychologischen Wahrnehmungsmustern von Fremdem, die eng mit affektiven Qualitäten verbunden sind. Als solche Ordnungs- und Orientierungsmuster sind Exotismus, Ethnozentrismus und Xenophobie zu nennen. Diese deuten das Fremde in jeweils spezifischer Weise, entsprechend als besonders anregenden Reiz oder als der eigenen Kultur oder Gesellschaft Unterlegenes bzw. als Bedrohung.42
7. Fremdheitskonstruktionen: Intendierte Fremdheitskonstruktionen befassen sich mit der Fremdstellung, um das Fremdgestellte auszugrenzen43 und als normativ Fremdes aufzufassen44.
Unter Fremdheit wird also in den oben genannten Ansätzen ein Interpretationsergebnis verstanden. Dabei sind Relation, Zuschreibung und der regulative Aspekt wesentliche Gesichtspunkte bei der Annäherung an den Begriff Fremdheit, die aber den Begriff nicht definieren, sondern nur näher beschreiben. Fremdheit ist somit keine „eindeutige Kategorie“45, sondern lediglich ein „Sammelbegriff für eine bestimmte relationale Erfahrung.“46
Andrea Leskovec betont, dass in den Konzepten der interkulturellen Hermeneutik der 1990er Jahre mit einem reduzierten und instrumentalisierten Fremdheitsbegriff agiert wurde, was auch Einfluss auf die Aufgabenstellungen der interkulturellen Literaturwissenschaft hat. Die Fremdheit wurde als kulturelle Fremdheit definiert, somit wurde die ästhetische Eigenqualität der Literatur kaum wahrgenommen. Laut Leskovec liegt das auch in der kulturwissenschaftlichen Ausrichtung der interkulturellen Hermeneutik begründet. In diesem Zusammenhang betont Leskovec das breite Spektrum des Phänomens des Fremden und die Notwendigkeit, verschiedene Dimensionen des Fremdheitsbegriffes, die sogenannten „Steigerungsgrade der Fremdheit“47, zu erläutern. Außerdem weist sie darauf hin, dass aus der Kritik an den vorherrschenden Konzepten von Fremdheit, die mit einem reduzierten Fremdheitsbegriff agieren, ein Konzept entwickelt wurde, das den Fremdheitsbegriff der interkulturellen Hermeneutik um die Dimension der radikalen Fremdheit erweitert48 und die ästhetische Dimension des Begriffes berücksichtigt. Leskovec hat einen alternativen hermeneutischen Ansatz erarbeitet und präsentiert in Anlehnung an ein Modell von Bernhard Wanderfels zur Klassifizierung eine neue Grundlage zur Konzeption und Interpretation der Fremdheit. Die Dimensionen der Fremdheit werden in Steigerungsgrade gegliedert. Dieses Modell ist für die weitere Argumentation dieser Arbeit ausschlaggebend. Es wird deshalb im Folgenden ausgeführt und erläutert. Das Modell betont drei Aspekte:
1. Alltägliche und normale Fremdheit umfasst das Fremde innerhalb der eigenen Ordnung;
2. Strukturelle Fremdheit umfasst das Fremde außerhalb der eigenen Ordnung;
3. Radikale Fremdheit umfasst die Phänomene, die sich jeglicher kultureller Ordnung entziehen, die als Folge „niemals kulturell gebändigt werden können“49 wie der Schlaf, der Eros, der Rausch oder der Tod.50
Fremdheit entsteht durch die Beziehung zwischen Betrachtetem und Betrachtendem und ist somit ein relationaler Begriff, wie bereits in Kapitel 2.2. erwähnt. In diesem Zusammenhang ist die Problematisierung des eigenen Standpunktes notwendig, und als Folge werden nach Waldenfels verschiedene „Fremdheitsstile“51 unterschieden. In der Literatur entsteht durch die Beziehung zwischen Text und Leser/in die hier beschriebene Relation Der Text wird durch die Rezeption aktualisiert, dabei spielen die kulturellen Prägungen der Lesenden eine besondere Rolle:
Bedeutung ist in Texten so wenig enthalten wie in Bildern, sie muss vielmehr hier wie dort im Akt der Rezeption eines Kommunikationsangebotes vom Rezipienten immer wieder neu hergestellt werden.52
Daraus resultiert, dass Fremdheit in literarischen Texten relativ ist, sie wird von den Lesenden in der Rezeption erst als solche bestimmt. In fremdkulturellen Texten ist der Lesende mit einer relativen Fremdheit konfrontiert.53 Eine solche Fremdheit kann überwunden werden, da sie einen vorübergehenden Charakter hat. Sie resultiert zum Einen durch die Relation zwischen Text und Leser/in, zum anderen ist Fremdheit „den Texten eingeschrieben, ist Strukturelement und daher immanent“54. Von der relativen Fremdheit ist die radikale Fremdheit zu unterscheiden. Sie entsteht nicht durch eine Relation, sondern sie macht sich „als fremder Anspruch bemerkbar.“55 Im Rückgriff auf die Phänomenologie des Fremden bei Waldenfels betont Leskovec die Notwendigkeit, beim Umgang mit der Fremdheit in literarischen Texten bzw. fremdkulturellen Texten zwischen drei Steigerungsgraden der Fremdheit zu unterscheiden und stellt ein erweitertes Modell zu Klassifizierung für den Umgang mit literarischen Texten vor:56
1. Alltägliche Fremdheit
a. Außertextliche Wirklichkeit
b. Textmusterwissen
c. Innertextliche Wirklichkeit
2. Strukturelle Fremdheit
a. Diskursive Fremdheit: anderes Zeichensystem (Fremdsprache, Literatur)
b. Intersubjektive Fremdheit/Zugehörigkeit zu anderen Kommunikationsgemeinschaften: kulturelle Fremdheit, Geschlechterdifferenz, soziale Unterschiede, Generationskonflikt, Gesellschaft – Individuum
3. Radikale Fremdheit: Thematisierung des Selbstentzugs als Überschuss (Nichtparaphrasierbarkeit), Abweichung (abweichendes Reden, Verhalten, Denken), Verformung (verformende Darstellung des Gewohnten) oder Verschiebung (existenzielle Verschiebung, Uneinholbarkeit des Ich)
Im Rahmen dieser Arbeit ist vor allem die Kategorie der strukturellen Fremdheit von großer Bedeutung. Deshalb wird diese Dimension im Folgenden weiter erläutert und differenziert:57
Strukturelle Fremdheit wird als Handlungselement, als Strukturelement und als Relation zwischen dargestellter Wirklichkeit und der Wirklichkeit des Rezipienten verstanden. Sie ist außerhalb der eigenen Ordnung zu finden, darunter werden andere Zeichensysteme verstanden, andere Sprachen oder Kulturen. Der Rezipient ist somit mit anderen Wirklichkeitsordnungen konfrontiert, die ihm unvertraut und unverständlich sind. Dadurch ist das erfolgreiche Handeln und sinnhafte Wahrnehmen nicht mehr möglich. In der Folge entsteht Unsicherheit, was die Kommunikation erschwert. Die Fremdheit des Rezipienten lässt sich nicht einfach erklären, wenn auch zusätzliche Informationen gegeben werden. Der Rezipient muss sich tief mit den Sinnbeständen der anderen Kultur beschäftigen, mit den jeweils anderen Normen und Werten. Somit kann eine Annäherung an die Codes der anderen Kultur nur teilweise gelingen.
In Bezug auf Literatur lässt sich strukturelle Fremdheit oft in zwei weitere Dimensionen unterteilen: So unterscheidet Leskovec in Anlehnung an Waldenfels zwischen der Fremdheit des literarischen Diskurses und systembedingter Fremdheit; diese stehen in einem wechselseitigen Verhältnis zueinander.58
Bei der systembedingten strukturellen Fremdheit geht es um die Literatur als ein anderes Zeichensystem, was aus der Autonomie der Literatur als System gegenüber anderen Sozialsystemen und der „Nicht-Instrumentalität der poetischen Sprache und des literarischen Textes“59 resultiert. Systembedingte strukturelle Fremdheit ergibt sich auch aus dieser Autonomie, weil diese nach eigenen Regeln als „gesellschaftlich akzeptierter Freiraum“60 funktioniert und eine eigene Ordnung bildet, die sich von etablierten Ordnungen unterscheiden kann. Da die poetische Funktion der Sprache im literarischen Text dominiert, die anderen Funktionen aber „entfunktionalisiert“ sind, wird der literarische Text aus diesem Grund zu einer anderen Sprachordnung. In der Literatur kann generell ein von der Norm abweichender Sprachgebrauch gelten und sie bildet somit eine fremde oder andere Ordnung zu den gewohnten Sprachstandards.
Die Fremdheit des literarischen Diskurses bezieht sich auf eine fremde Sprache, auf die „Bedeutungsdimensionen“61 der Wörter dieser Sprache. Da „in der Bedeutung von Wörtern […] mehr oder weniger diffuse, heterogene und zum Teil auch durchaus widersprüchliche Bestände eines kulturellen Wissens“62 eingehen, weist diese Dimension der Fremdheit die Aspekte Mehrdeutigkeit und Undeutlichkeit auf. Die Mehrdeutigkeit entsteht durch den Sprachgebrauch in den Kontexten außerhalb der eigenen Ordnung, d.h. in den Kontexten einer Fremdsprache. Die Fremdheit des literarischen Diskurses zeigt sich insbesondere in Strukturelementen wie Autoreflexivität, Funktionalität und Vieldeutigkeit.63
Die Autoreflexivität der Literatur entsteht durch die Dominanz der poetischen Funktion der Sprache über andere Funktionen und wird von Roman Jakobson prägnant definiert: „Die Einstellung auf die Botschaft als solche, die Ausrichtung auf die Botschaft um ihrer selbst willen, stellt die poetische Funktion der Sprache dar.“64
Das heißt, dass in der anderen Sprachordnung, die durch einen literarischen Text dargestellt ist, die Aufmerksamkeit auf die Sprache als Material gerückt wird. Dadurch wird die Wahrnehmung desautomatisiert. Durch die Abweichung von den Normalstandards der Sprache entsteht eine alternative Ordnung zu den gewohnten Sprachstandards, die von Winterstein als „Fremd-Sprache“65 bezeichnet wird. Dabei wird die Rezeption von Texten durch die Dominanz der poetischen Funktion der Sprache über andere Funktionen erschwert, zum Einen wird die Aufmerksamkeit auf die ästhetische Dimension des Textes gelenkt, zum Anderen wird die Normalität dieser Sprachordnung in Frage gestellt.66
Ein weiteres Strukturelement, die Vieldeutigkeit, ist ebenfalls von großer Bedeutung, weil diese die Produktivität der literarischen Sprache steigert, so Uwe Japp: „Die Wörter vervielfachen sich, sobald sie aus der Eindeutigkeit des Lexikons in die Latenz und Virtualität des Satzes überwechseln.“67
Durch den potenziellen Gebrauch von Sprache in bestimmten Kontexten können neue bzw. mehrere Bedeutungen entstehen. Paul Ricouer belegt die Theorie der Polysemie in Bezug auf Metaphern: „In der metaphorischen Aussage […] schafft die Wirkung des Kontexts eine neue Bedeutung, die wohl ein Ereignis ist, weil sie nur in diesem Kontext existiert“68.
Neva Šlibar betont, dass Mehrdeutigkeit durch Kontextentzug oder Kontextwechsel hergestellt wird.69
Als Fazit lässt sich feststellen, dass Fremdheit ein sehr komplexer Begriff ist, daher werden von Literaturwissenschaftlern mehrere Dimensionen des Begriffs differenziert. Im Rahmen ihres alternativen hermeneutischen Ansatzes präsentiert Leskovec eine neue erweiterte Grundlage zur Interpretation der Fremdheit im Rückgriff auf das Modell von Waldenfels, das die Dimensionen des Begriffs in die Steigerungsgrade unterteilt. Dabei können auf der Eben der strukturellen Fremdheit bereits zwei Ebenen für die Untersuchung ausgegrenzt werden: zwischen der Fremdsprache im literarischen Diskurs (englische Sprache im russischen Text oder in der deutschen Übersetzung) und dem literarischen Diskurs als Fremdsprache (russischer literarischer Text als Fremdheit, Fremdsprache, die ins Deutsche zu übersetzen ist).
2.3 Darstellungsformen der Fremdheit und ihre Funktionen
Leskovec geht davon aus, dass Literatur zu einem Ort wird, „in dem andere Möglichkeiten durchgespielt, andere Weltentwürfe inszeniert werden.“70 In der Literatur als Ort der Begegnung mit Fremdheit tritt diese in verschiedenen Darstellungsweisen auf. Bei der diskursiven Fremdheit wird von Literaturwissenschaftlern häufig auf den Sprachgebrauch verwiesen, der vom alltäglichen Sprachgebrauch abweicht, da die Literatur, wie bereits erwähnt, als eine andere Sprachordnung gilt.71
Norbert Mecklenburg betont, dass das Verfremdungskonzept und das Dialogizitätskonzept zwei zentrale Konzepte der Fremdheit darstellen. Das Verfremdungskonzept geht auf die These der Formalen Schule und von Roman Jakobson zurück. Hier wird die Aufmerksamkeit durch die Hervorhebung der poetischen Funktion auf den Text als solchen betont. Die Fremdheit wird als Verfremdung durch spezifische Verfahren, z.B. durch Deformation oder Herstellung von Mehrdeutigkeit, verstanden. Harald Weinrich weist darauf hin, dass die Beziehung zwischen Wörtern und Dingen aufgrund der Dominanz der poetischen Sprachfunktion über alle anderen Funktionen in die Schwebe gebracht und in spielerische Bewegung gesetzt wird.72 In einem Sprachspiel werden die referentielle und die kommunikative Sprachfunktion gebrochen oder paradox abgelöst. Mit anderen Worten: Durch solche Sprachspiele werden Bedeutungen hervorgerufen, ohne dass diese jedoch gleichzeitig kommunikativ umgesetzt werden.73 Durch die Verarbeitung solcher Sprachspiele wird die literarische Kommunikation unterbrochen. Daraus entsteht ein großer Spielraum für die Interpretation des Lesers.74 Norbert Mecklenburg erläutert weiter:
Die Unterbrochenheit der literarischen Kommunikation macht aus jeder Lektüre, nicht nur solcher über große räumliche oder zeitliche Distanz zwischen Autor und Leser, eine imaginäre Reise ins Unbekannte, Fremde. Fiktionale Texte enthalten, als spezifischen Aspekt von kognitiver Fremdheit, ein hohes Maß an Unbestimmtheit und eröffnen damit einen Deutungsraum, innerhalb dessen der Rezipient das Fremde des Textes mit Eigenem in Beziehung setzen muss.75
Mecklenburg spricht in Anlehnung an Bachtin in diesem Zusammenhang vom Dialogizitätskonzept. Dieses konstituiert sich in der „Engführung“76 sprachlicher „Polyphonie“77 und gesellschaftlicher „Redevielfalt“78. Intertextualität ist ein Aspekt dieser Redevielfalt. Unter Dialogizität wird die „Besiedelung“79 der Wörter durch fremde Stimmen verstanden. Es geht zum Einen um Sprachmischungen, um Interferenzen und Mehrsprachigkeit, zum Anderen um die sprachliche „Binnenfremdheit“80, d.h. um die Mehrstimmigkeit vieler Subsprachen, „als Feld der Diskurse, die den verschiedenen Bereichen gesellschaftlicher Praxis angehören, und um die Formen poetischer Transformation dieses sprachlichen Pluralismus.“81
In Bezug auf die Fremdheit des literarischen Diskurses wird aus diesen Konzepten deutlich, dass sich diese Art von Fremdheit, Fremdheit, die sich auf eine Fremdsprache außerhalb der eigenen Sprachordnung bezieht, im literarischen Diskurs vor allem in Sprachenmischungen niederschlägt. Sprachenmischung ist der Oberbegriff für Begriffe wie Code-Switching, Transferenz, Interferenz etc. In Bezug auf Sprachenmischung werden also mehrere Unterbegriffe differenziert.82
Code-Switching bzw. Sprachwechsel (auch Kodewechsel, Kode-Umschaltung) bezeichnet einen „Wechsel zwischen zwei Sprachen […] innerhalb einer Äußerung oder eines Dialoges bei bilingualen Sprechern/Schreibern, meist durch Kontextfaktoren bedingt.“83 Das Phänomen des Code-Switching wird innerhalb von Gesprächsanalysen untersucht, im Rahmen dieser Arbeit werden die Ergebnisse dieser Forschung bei der Untersuchung der literarischen Texte übertragen. Hierbei wird auf aktuelle Studien von Literaturwissenschaftlern z.B. Dr. Mforge, zurückgegriffen.84 Das linguistische Konzept wird also bei der Untersuchung der literarischen Texte eingesetzt, weil es für sinnvoll an dieser Stelle gehalten wird, die gesprochene Rede realer Personen mit der Rede fiktionaler Personen der literarischen Texte für die Analyse gleichzustellen.
Es wird hierbei zwischen intrasentenziellem und intersentenziellem Code-Switching (auch: Code-Mixing) unterschieden, einige Forscher differenzieren auch zusätzlich das sog. Tag-Switching. Der erste Begriff wird für den Wechsel von Sprachen innerhalb von Sätzen verwendet. Der zweite Begriff wird für den Wechsel von Sprachen zwischen Äußerungen/Sätzen eingesetzt, also für den Wechsel am Übergang von einem Satz zum nächsten. Tag-Switching bedeutet das Einfügen eines tags (‚Ausruf‘, ‚Füller‘).
Wenn Sprachen/sprachliche Varietäten nicht verändert, sondern innerhalb von sprachlichen Äußerungen gemischt auftreten, handelt sich um das Prinzip des Code-Switchings, wobei ‚Code’ in diesem Zusammenhang die Bedeutung ‚Sprache’ und ‚Varietät’ (im Sinne von Dialekt) hat. Im Rahmen dieser Arbeit wird mit der Bedeutung ‚Sprache’ operiert.85
In diesem Zusammenhang ist es wichtig, zwischen Code-Switching und den anderen genannten Unterbegriffen der Sprachenmischung unterscheiden zu können. Die größte Schwierigkeit stellt die Unterscheidung ‚Transferenz vs. Code-Switching‘ dar. Unter Transferenz wird die Übernahme von Elementen, Merkmalen und Gesetzmäßigkeiten aus der Kontaktsprache86 verstanden, es handelt sich um „eine Integration der einen Sprache (d.h. der weniger aktiven) in die andere, nämlich die Matrixsprache.“87 Dabei werden die einzelnen Sprachtransferenz-Fälle als Transfers bezeichnet.88 Insbesondere in der Praxis kann man zwischen (intrasentenziellem) Code-Switching und Entlehnung bzw. grammatischen und/oder lexikalischen Transfers kaum unterscheiden.89 In Anlehnung an Martin Pütz betont Csaba Földes ein grundlegendes Merkmal von Code-Switching, dass die Matrixsprache durch die Integration der jeweils anderen Sprache im Prozess des Code-Switchings nicht verändert wird.90 Wie aber die Sprechrealität und viele Untersuchungen beweisen, zeigt sich, dass „eine extreme Verschiebung [aller empirischen Belege]“91 in Richtung Transferenz oder Entlehnung vorliegt.
Die Unterscheidungsproblematik ‚Transferenz vs. Code-Switching‘ wird durch die umstrittene Frage weiter verkompliziert, ob das Phänomen der „nonce loans“92 bzw. ‚Ad-hoc-Entlehnungen‘ als eine einzelne Kategorie differenziert werden soll93 oder als Bestandteil des Code-Switching-Prozesses zu subsummieren ist.94 Es handelt sich dabei um „nicht rekurrente Übernahmen, die nur idiolektal distribuiert sind, im Übrigen aber denselben Kriterien entsprechen wie die etablierten Lehnwörter - sie sind also morphologisch, syntaktisch und womöglich auch phonologisch integriert.“95 Um eine weitere Ausdifferenzierung zu vermeiden, spricht Claudia Maria Riehl von einem Kontinuum zwischen Entlehnung und Code-Switching, das vor allem für unflektierte Formen gilt, „bei denen auch die phonetische Form nicht einer bestimmten Sprache zugeordnet werden kann.“96 In Anlehnung an Suzanne Romaine wird von Riehl die Aussage getroffen, dass diejenigen Sprachen, die eine unähnliche Struktur aufweisen, auch weniger zum Code-Switching-Prozess neigen. Dadurch sind sich in solchen Fällen Code-Switching und Transferenz strukturell ähnlich.97 Da sich die russische und deutsche Sprache in wesentlichen Merkmalen unterscheiden, wird als Untersuchungsgrundlage für diese Arbeit das Modell von Pieter Muysken zu Grunde gelegt.98 Durch eine Dreiteilung in der Beschreibung und durch die Einführung neuer Begriffe entzieht er sich der Unterscheidungsproblematik ‚Transferenz vs. Code-Switching’. Wenn Einheiten eingebettet sind, handelt es sich um ‚Insertion‘, z. B. in dem Satz: „Morgen fahren wir zum lago (=See).“99 Wenn die Einheiten getrennt bleiben, spricht Muysken von ‚Alternation‘: „Alternation resembles switching between clauses or utterances“100, z.B. in dem Satz: „Das ist ein bel ragazzo (=schöner Junge).“101 Wenn die Sprachen eine gemeinsame grammatische Struktur haben, wird dafür bei Muyken der Terminus ‚Congruent Lexicalisation‘ verwendet: „Congruent lexicalisation resembles, in its extrem form, style shifting and intra-system variation“102, z.B. in dem Satz „Das ristorante an der Ecke ist sehr gut (=Restaurant)“.103
Neben der Unterscheidungsproblematik ‚Transferenz vs. Code-Switching‘ ist vor allem die Diskussion um die Funktionen des Code-Switchings von Bedeutung, die auf John Joseph Gumperz104 zurückgeht. Dabei wird zwischen soziolinguistisch motiviertem (funktionalem) und psycholinguistisch motiviertem (nicht-funktionalem) Code-Switching unterschieden.105
Das funktionale Code-Switching wird aufgrund von äußeren Faktoren oder aus strategischen Gründen eingesetzt. Dabei unterscheidet Gumperz zwischen situationellem und konversationellem Code-Switching. Des Weiteren werden von Appel/Muysken sechs diskursstrategische Funktionen des Code-Switchings differenziert.106 Claudia Maria Riehl verbindet diese zwei Modelle in einem eigenen Schema:
1. Situationelles Code-Switching107 („situational switching“108 ):
Äußere Faktoren, die diese Form von Code-Switching auslösen, sind Gesprächspartner, Ort der Kommunikation und Thema. Durch die Änderung dieser Faktoren werden auch die sozialen Rollen, die Rechte und Pflichten der Gesprächspartner neu definiert.109
Hier gehen Appel/Muysken auf die “direkte Funktion“110 ein: Der Sprecher/ Gesprächspartner wechselt die Sprache, um entweder einen Gesprächspartner bewusst auszuschließen oder um ihn in die Konversation mit einzubeziehen.111
2. Konversationelles Code-Switching112 („metaphorical switching“113 ):
Blom/Gumperz bezeichnen „metaphorisches Code-Switching“114 als den Wechsel von der einen in die andere Sprache mit dem Ziel, bei dem Empfänger eine bestimmte Einstellung zum Gesagten hervorzurufen. Der Sprecher agiert aus diskursstrategischen Gründen, um einen kommunikativen Effekt zu erzielen.
In diesem Zusammenhang werden von Appel/Muysken115 weitere diskursstrategische Funktionen unterschieden:
- Expressive Funktion: persönliche Einstellung, Bewertung einer Situation.
Zum Beispiel: „[…] E poi l’abbiamo lasciato. It was just amazing ! […] “116
- Referentielle Funktion: Ausdrucksschwierigkeiten des Sprechers in der einen Sprache, die oft mit der Kompetenz des Sprechers zusammenhängen.
Zum Beispiel: „Can you give me your – crayon [=pencil]? “117
- Phatische bzw. metakommunikative Funktion: Metakommentare in der anderen Sprache.
Zum Beispiel: „[…] und mein – Opa – der war – kak tam u nih govoritsja ? [‚wie heißt der Tierarzt bei ihnen‘]“118
- Poetische Funktion: Wortspiele, Witze und Gedichte
Zum Beispiel: „Das ist nahrungsvoll, es ist mit iron (Eiern).“119
3. Code-Switching als Identitätsmerkmal („they-code“; „we-code“).
Gumperz stellte fest, dass jeder dieser Codes eine bestimmte Funktion ausübt. Der ‚We-code’ wird zum Ausdruck persönlicher Aufforderung, Involviertheit oder persönlicher Meinungen verwendet. Der ‚They-code‘ drückt eine objektive Warnung, eine Distanz zum Geschehen oder allgemeine Fakten aus. Beispiel: „Manchmal wenn ich deutschsprachige Bekannte treffe, spreche ich deutsch, otherwise I speak only English.“120
Als Fazit dieses Kapitels lässt sich feststellen, dass sich die Fremdheit des literarischen Diskurses oft in Form von Sprachenmischungen zeigt. Die Sprachenmischung ist der Oberbegriff für Code-Switching, Transferenz und Interferenz. Im Kapitel 4. wird näher auf Code-Switching eingegangen, daher ist es sinnvoll, zwischen diesen Unterbegriffen unterscheiden zu können.
3 Fremdheit in der Übersetzungswissenschaft
Die Übersetzungsforschung erlebt eine „kulturwissenschaftliche Wende“121. In der Epoche der Globalisierung ist die Übersetzung literarischer Texte mehr als eine Sprachübertragung. Es geht um die Übersetzung zwischen und von Kulturen. Durch die Wahrnehmung neuer Weltliteraturen außerhalb der westlichen Zentren gewinnt die Frage der literarischen Übersetzung als ein Prozess der Übersetzungsvorgänge zwischen Kulturen an Bedeutung.122 Durch die Globalisierung besteht die Gefahr, dass „kulturelle Differenzen bei gleichzeitiger Ausgrenzung des Fremden eingeebnet werden“123, deswegen werden in der Übersetzungsforschung die Übersetzungsanalysen für ein textübergreifendes kritisches Bezugsfeld ausgearbeitet. In der Übersetzungsforschung werden somit die Akzente der Forschung verschoben: Es werden die Verschiedenartigkeit der Repräsentationsweisen sowie ihre unterschiedlichen kulturstrategischen Verwendungskontexte untersucht. Die Übersetzung bezieht sich somit wieder auf kulturspezifische Differenzen, auf Übersetzungsprobleme wird aus dem Blickwinkel der ethnografischen Reflexion eingegangen.124 Die Übersetzung fremder Kulturen hängt unterhalb der Textrepräsentation von einer Wechselseitigkeit der Interaktion ab, somit sind das Übersetzte sowie der Übersetzer in einen Handlungsrahmen eingebunden.
Fremdheit als literarisches Mittel ist komplex. Der moderne Übersetzer ist mit neuen Problemen konfrontiert – die in Kapitel 2.2 aufgeführten Dimensionen der Fremdheit und ihre sprachliche Darstellungsweisen in literarischen Texten, die im Kapitel 2.3 präsentiert wurden, erweisen sich als spezifische Übersetzungsprobleme, die bewältigt werden müssen. Dies erfordert oft von Übersetzern eine Entscheidung zugunsten der einen oder anderen Übersetzungsstrategie, die in Kapitel 3.2. vorgestellt werden. Es wird gezeigt, welche Aspekte der Fremdheit in literarischen Texten bei der Übersetzung als Problem entstehen können, und mit welchen Strategien operiert wird, um mit diesen Problemen angemessen umgehen zu können.
3.1 Fremdheit als Übersetzungsproblem
Die Übersetzungsforschung versteht die literarische Übersetzung als eine Form der Literatur, als Medium der Interpretation des literarischen Werkes, als „integrale […] Interpretation eines literarischen Werks in einer zweiten Sprache […], allerdings nicht als metasprachliche, sondern als eine zumindest dem Anspruch nach literatursprachliche Interpretation. Deshalb nimmt sich diese besondere Art der Interpretation auch wie ein literarische Werk aus, das – zumindest für den zweisprachigen Leser – das ‚Übersetzte’ in der zweiten Sprache, Literatur und Kultur ‚ersetzt‘.“125 Bei dieser Definition wird auf das Verhältnis eingegangen, in dem der Originaltext und der Text der Übersetzung in Bezug auf die Zielsprache, -literatur und -kultur stehen. D.h. beim Prozess des Übersetzens wird nicht nur Sprache, sondern es werden viele weitere Faktoren übertragen. Friedmar Apel betont vor allem die Rolle, welche die Person des Übersetzers, die Bedeutung des Umfeldes und der jeweiligen Kultur spielt:
Übersetzung ist eine zugleich verstehende und gestaltende Form der Erfahrung von Werken einer anderen Sprache. Gegenstand dieser Erfahrung ist die dialektische Einheit von Form und Inhalt als jeweiliges Verhältnis des einzelnen Werks zum gegebenen Rezeptionshorizont (Stand der Sprache und Poetik, literarische Tradition, geschichtliche, gesellschaftliche, soziale und individuelle Situation). Diese Konstellation wird in der Gestaltung als Abstand zum Original erfahrbar.126
Durch die komplexen Bedingungen des Übersetzens entsteht also der Abstand, durch welchen das vielschichtige Verhältnis der Übersetzung zum Original gekennzeichnet ist. Durch das Spannungsverhältnis zweier Sprachen tritt die Fremdheit in Erscheinung. Sie konstituiert sich nicht allein im Sprachlichen, sondern auch in der fremden Wirklichkeit, auf die sich die andere Sprache bezieht. Die Darstellung der fremden Wirklichkeit kann durch verschiedene Techniken erfolgen, die für die Literatur der Zielsprache fremd sind. Solche Fremdheitsaspekte gewinnen erst im Übersetzungsprozess an Bedeutung. Willi Huntemann und Lutz Rühling unterscheiden in diesem Zusammenhang zwischen „extrinsischer Fremdheit“ und „intrinsischer Fremdheit“127. „Extrinsische Fremdheit“ ist „an einen bestimmten Rezipientenkreis gebunden und prinzipiell aufhebbar“128. Die Texte, die „extrinsische Fremdheit“ aufweisen, sind nicht „an sich“ fremd, sondern beziehen sich auf bestimmte Kultur- und Literaturpaare. Hier sind besonders die kognitiven Fähigkeiten des Übersetzers angesprochen, weil es in diesem Aspekt der Fremdheit um Realia und Kulturalia geht. Der Übersetzer löst die Probleme des Übersetzens der „extrinsischen Fremdheit“, indem er eine Wissenslücke schließt. Im Gegensatz zur „extrinsischen Fremdheit“ besteht die „intrinsische Fremdheit“ „unabhängig von einem solchen Rezipientenkreis“129. Die Texte, die „intrinsische Fremdheit“ aufweisen, sind „an sich“ fremd, sie bringen Fremdheit als Programm zum Ausdruck. Es sind meistens Texte der literarischen Moderne bis hin zur Gegenwart. „Intrinsische Fremdheit“ wird durch Verstöße gegen sprachliche Normen zum Ausdruck gebracht:
Bei den Regeln, gegen die verstoßen wird, kann es sich sowohl um konstitutive als auch um regulatorische handeln, um soziale und literarische Konventionen oder auch bloß gattungs- und epochenspezifische ‚Quasinormen‘, die lediglich auf den aus Gewöhnung entstandenen Erwartungen der Rezipienten beruhen.130
Solche Texte bekommen bei der Übersetzung ein neues Potenzial, weil eine Fremdheit in kognitiver Hinsicht nicht nivelliert werden kann:
Dieses Faktum wird unter anderem durch die bekannte und hinlänglich abgegriffene Formel zum Ausdruck gebracht, mit einem modernistischen Text wolle der Autor seinem Leser ‚nichts Bestimmtes‘ mehr sagen.131
Solche Texte bleiben unverständlich, weil der Autor die Unverständlichkeit intendiert. Der Übersetzer ist in solchen Fällen auf eine harte Bewährungsprobe gestellt, die besonders seine „affektiven bzw. emotionalen Reaktionen“132 betrifft.
Im Weiteren werden dem Übersetzer zur Verfügung stehende Strategien dargestellt, um die verschiedenen Arten von Fremdheit zu übertragen.
3.2 Übersetzungsstrategien beim Umgang mit der Fremdheit
In der Übersetzungssituation ist der Übersetzer, wie oben erwähnt, mit dem Problem des Transfers von Fremdheit konfrontiert, sowohl mit dem Problem der subjektiven kognitiven Fremdheit sowie mit dem Problem der eigenen Reaktionen auf intrinsische Fremdheit. Damit steht der Übersetzer nicht nur vor der Aufgabe, das Fremde für sich selbst zu verstehen, sondern auch dieses Fremde „unter den Bedingungen der eigenen Sprache, Literatur und Kultur und zudem in der Form der Übersetzung“133 einem neuen Leserkreis zur Verfügung zu stellen. Es wird in der Übersetzungswissenschaft über zwei grundlegende Strategien diskutiert, die das Verhältnis von Eigenem und Fremdem regeln: das einbürgernde Übersetzen und das verfremdende Übersetzen. Bei der ersten Strategie geht es darum, die Fremdheit in der Zielliteratur zu nivellieren, bei der zweiten Strategie wird der Versuch unternommen, die Fremdheit zu bewahren.
Die erste Strategie basiert auf der Vorstellung einer „Assimilation des Fremden“134 im Zuge eines kulturellen Ethnozentrismus. Sie wird von den Befürwortern der zweiten Strategie, den Vertretern postmoderner übersetzerischer Strömungen wie Arrojo und Venuti kritisch gesehen.135 Bei der ersten Strategie geht es um eine „philologisch genaue“ Wiedergabe des Textes. Diese „logozentrische“ Auffassung ist derjenigen der sog. Dekonstruktion gegenübergestellt, welche die Übersetzung als solche in den Vordergrund stellt.
Aus postmoderner Sicht gilt die Annahme, dass die literarische Übersetzung notwendigerweise von ihrer Vorlage abweichen soll. Die literarische Übersetzung erscheint als eine „Transtextualisierung“, als „grenzüberschreitender Verkehr zwischen den Sprachen, Literaturen und Kulturen.“136 Das „historisch und individuell verschiedene Verständnis des jeweiligen Werks“137 wird als eine Interpretation eines literarischen Werkes und als konstruktiv angesehen. Außerdem gilt in postmoderner Sicht die Überzeugung, dass jede Übersetzung „fundamentally ethnocentric“138 ist und die Übersetzungsstrategien von „asymmetrical relations“139 abhängig sind. Theo Hermans behauptet sogar: „All translation implies a degree of manipulation of the source text for a certain purpose.“140 In postmodernen übersetzerischen Strömungen wird das Übersetzen also als „Manipulation“ am Ausgangstext verstanden.
Die Literatur ist dabei als ein Polysystem zu betrachten. Die Tatsache, dass ein literarisches Werk sehr komplex ist,141 viele verschiedene Dimensionen beinhaltet und einen Relationscharakter aufweist, wie bereits in Kapitel 2.2 erwähnt, macht dem Übersetzer die Anwendung einer einzigen Übersetzungsstrategie für ein ganzes Werk unmöglich. Oft geht es um eine Mischung, d.h. in Bezug auf einen Aspekt kann das Werk verfremdend übersetzt werden (z. B. bei Realia), in Bezug auf einen anderen Aspekt kann der Übersetzer einbürgernd übersetzen (z. B. bei Sprichwörtern). Somit kann die literarische Übersetzung verschiedene Arten der Fremdheit beinhalten.
Zusammenfassend lässt sich feststellen: Beim einbürgernden Übersetzen werden die kulturell fremden Elemente reduziert bzw. durch eigene ersetzt, somit wird die Fremdheit nivelliert. Beim verfremdenden Übersetzen wird die Fremdheit des Ausgangstextes in den Vordergrund gestellt. So werden in der Übersetzung bewusst Differenzen geschaffen, um die kulturellen und sprachlichen Verschiedenheiten zwischen den Kulturen hervorzuheben.142
4 Viktor Pelewins Roman „Das fünfte Imperium. Ein Vampirroman“
Viktor Pelewin ist ein russischer Schriftsteller, der als einer der erfolgreichsten und meistgelesenen zeitgenössischen Erzähler Russlands gilt.143 Auf der Webseite vom Schriftsteller werden seine Bücher und die Rezensionen zu verschiedenen seiner Romane und Erzählungen zur freien Nutzung veröffentlicht, somit werden sie schnell verbreitet.144 In letzter Zeit wurde Pelewin auch international bekannt, in Deutschland hat er sich vor allem mit seinem Roman „Generation P“ einen Namen gemacht. Die deutschen Kritiker und Wissenschaftler hinterfragen vor allem die postmoderne Motiven seiner Werke.145
Viktor Pelewin gilt also als ein Autor der Postmoderne. Anhand vieler intertextuellen Schnittstellen, nicht zuletzt mit seinen eigenen Romanen, anhand der Themen-Motivgestaltung können Motive postmodernen Schaffens in seinen Werken nachgewiesen werden.146 Sally Dalton-Brown betont Pelewins Einordnung in den Kontext der Postmoderne: „Pelewin’s work is the most essentially ‚postmodern’ of the contemporary Russian prose.“147
Marian Madela weist anhand von Pelewins Werken die These von Aleksander Etkinds These nach, dass russische Texte der Postmoderne vielschichtig sind und als Gedächtnisträger einer melancholischen postsowjetischen Epoche fungieren. Einerseits haben alle Bücher von Pelewin das moderne russische Zeitgeschehen zum Thema, der Schriftsteller stellt die postsowjetische Realität, die moderne Konsumgesellschaft und die westliche Lebensweise in Frage. Andererseits ist die Vielschichtigkeit als konstitutiver Bestandteil seiner Texte zu sehen.148
Die Vampirgeschichte "Das fünfte Imperium" ist ein postmoderner Mix aus Bildungsroman, Satire und Märchen, verfeinert mit Philosophie, wodurch er sich von anderen zurzeit beliebten Vampir-Romanen unterscheidet. Pelewins Stil ist ein Eklektizismus der literarischen Genres, literarischen Stils und Formen, sein Stil entspricht somit den Gesetzmäßigkeiten der Postmoderne. Dieser Roman ist als Grundlage für die Untersuchung wissenschaftlich von großem Interesse, weil es noch keine Analysen dazu gibt, obwohl er zahlreiche Beispiele der Fremdheit auf verschiedenen Ebenen aufweist.
Andreas Tretner ist der Übersetzer der Werke von Viktor Pelewin ins Deutsche. Die Meinungen, ob die deutsche Übersetzung gelungen ist, gehen auseinander. Einige deutsche Kritiker sind der Meinung, dass durch die deutsche Übersetzung leider viel verloren geht:
Denn nicht wir, die deutschen Leser, sind das Publikum, für das Pelewin schreibt; viel, und vielleicht das Beste, dürfte uns entgehen. Dieses Buch ist, gerade indem es sich eine so betont mondäne, ‚eurosanierte‘ Haltung gibt, eine tief binnenrussische Angelegenheit.149
Der Schriftsteller Wladimir Kaminer ist dagegen der Meinung: “Die deutsche Fassung ist noch besser als das Original - innovativ und durchgeknallt."150
Anhand von Beispielen aus dem Roman wird festgestellt, wie die Fremdheit übertragen wurde und ob es sich um eine gelungene Übersetzung handelt.
4.1 Inhaltsangabe des Romans
Der Roman besteht aus drei Sujets. Der erste Handlungsstrang (inhaltliche Ebene) erzählt die spannende Geschichte von einem männlichen Vampir namens Rama, die sich vor dem Hintergrund einer fantasievoll geschilderten Vampirwelt und komplizierter Vampirtheorien in ein romantisches Liebesabenteuer stürzt. Metaphorisch ist die Elite der modernen Gesellschaft vom Autor gemeint und wird in Frage gestellt, daraus bildet sich der zweite Handlungsstrang (soziale Ebene). Der dritte Handlungsstrang (thematische Ebene) ist ein philosophischer Ansatz über das Begriffspaar Glamour und Diskurs, der innerhalb des Romans von verschiedenen Figuren erläutert und festgelegt wird. Hier wird über die moderne Kultur diskutiert.
Der Roman beginnt damit, dass der Protagonist Roma in einer fremden Wohnung zu sich kommt und unmittelbar nach einem Biss zum Vampir namens Rama wird. Während dieser Metamorphose, die sich zunächst physisch vollzieht, erlebt er seine Erinnerungen aus der Vergangenheit aufs Neue. Dadurch erfährt der Leser im Kapitel „Sonnenstadt“ mehr über seine Persönlichkeit. Roma ist ein durchschnittlicher Junge, der noch in der UdSSR geboren wird. Er wohnt mit seiner Mutter in Moskau, sein Vater, den er nie richtig kennenlernte, hat die Familie verlassen. Er weiß nur, dass sein Vater ein Journalist ist und ursprünglich aus einer aristokratisch-baltischen Familie mit dem Namen von Storkwinkel abstammt. Der Nachname sollte aber aus Sicherheitsgründen geändert werden, da die aristokratische Elite in der UdSSR ausgerottet werden sollte. Die Kindheit von Rama endet, als die UdSSR auseinander bricht. Mit dem Sturz des alten politischen Regimes scheint das Leben der Bürger ungebrochen weiterzugehen, sie passen sich dem neuen Regime an und sie übertragen alte Regeln und Vorstellungen auf das neue Leben. Roma fühlt sich jedoch in seinem Leben verloren. Er fällt bei der Aufnahmeprüfung für die Moskauer Universität durch, geht arbeiten, aber er findet seinen Weg nicht. Allerdings hat er den Traum, an der Spitze der Gesellschaft zu stehen. Er wird zum Outsider des Lebens, bis er eines Tages ein kleines Inserat, eine Einladung in die Elite einzutreten findet. Da wartet ein Vampir auf ihn, der ihn in einen Vampir verwandelt und danach Selbstmord begeht.
Um aber ein vollkommener Vampir zu werden, soll Rama Privatunterricht nehmen und viel studieren. Er lernt Fächer wie „Glamour“ und „Diskurs“ und erfährt viel Neues über die Gesellschaft, die wahre Weltordnung, über die Welt der Vampire und Menschen, indem er mit seinen Dozenten, vollkommenen Vampiren, diskutiert und philosophiert. Im Großen und Ganzen lernt er, dass ein richtiger Vampir nicht nur Blut, sondern auch Bablos151 trinkt, sich chic anzieht und nur dann intellektuelle Diskurse führt, wenn er mit anderen Vampiren und Menschen kommuniziert. Rama lernt dann ein junges Mädchen namens Hera kennen, das auch vor kurzem zum Vampir geworden ist und denselben Vampirkurs besucht. Nach der Beendigung dieses Kurses nehmen beide junge Vampire an einem Ritual teil, „dem großen Sündenfall“, das beide offiziell zu vollkommenen Vampiren machen soll, teil. Sie verwandeln sich in Vampirfledermäuse und fliegen über ganz Moskau ins „Heartland“152 zu ihrem Lehrer. Da erfahren sie die wahre Geschichte über den Sinn des Vampirlebens. Eines Tages lebte eine Große Maus, als aber auf der Erde das Essen knapp wurde, löste sich ein Teil von ihr ab, aus ihrer Symbiose mit besonderen Menschen wurde eine neue Symbiose, der Vampir. Vampire züchten seitdem Menschen, um ihr Blut und um das Bablos zu trinken, welches die Menschen produzieren. Ischtar produziert aus dem Bablos das Bablos-Konzentrat, das danach zwischen den Vampiren hierarchisch verteilt wird. Rama und Hera verbringen einige Zeit miteinander, kommunizieren und verlieben sich ineinander. In dieser Zeit begegnet Rama auch der Göttin Ischtar und Chaldäer. Das sind in der Geschichte der Vampire eingeweihte Menschen, die das Geheimnis bewahren und die auf die anderen Menschen aufpassen sollen. Nachdem Rama und Hera das Geldkonzentrat Bablos kosten, kommt es zu einem Liebesdreieck. Hera verlässt Rama für den Lehrer Mitra. Rama fordert ihn zum Duell heraus und verliert. Als Strafe soll er das Date von Hera und seinem Gegner Mitra durch eine versteckte Kamera live mitverfolgen. Erstaunlicherweise sieht er aber, dass Mitra getötet und aus Hera die neue Göttin Ischtar wird. Er bekommt von ihr einen Brief mit der Erklärung, dass sie entweder Rama oder Mitra töten musste, um die alte Göttin zu ersetzen, sie hat Mitra als Opfer gewählt. Es ist eine Liebeserklärung und der Vorschlag, seine Freundin zu werden, womit Rama zum ersten Mann in der Hierarchie nach ihr wird. Rama nimmt das Angebot an und sein Traum, an der Spitze der Gesellschaft zu sein, geht in Erfüllung.
Der zweite Handlungsstrang ist die metaphorische Geschichte, wie sich der Outsider des Lebens an die Spitze der Gesellschaft gelangt.
Der dritte Handlungsstrang basiert auf Pelewins philosophischen Überlegungen zu den Begriffen Glamour und Diskurs. Die beiden Begriffe werden im Buch folgendermaßen definiert:
Glamour ist Sex, der sich durch Geld artikuliert bzw. Geld, das durch Sex artikuliert wird. […] Und Diskurs ist sublimierter Glamour […]. Betrachte den Glamour am besten als Diskurs des Körpers […] und den Diskurs als Glamour des Geistes […] An der Schnittstelle dieser Begriffe entsteht die ganze moderne Kultur.153
Pelewin philosophiert über die Weltordnung, den Sinn des Lebens etc. Dabei weisen viele Elemente des zweiten Handlungsstranges die Fremdheit des literarischen Diskurses auf, die sich in Form von Code-Switching zeigt.
4.2 Fremdheit im Originaltext und in der Übersetzung
In diesem Kapitel wird versucht, anhand von Beispielen aus dem russischen Roman „Das fünfte Imperium“ und im Rückgriff auf das Modell von Appel/Muysken154 die Formen und die Funktionen der Fremdheit des literarischen Diskurses und die entsprechenden Übersetzungsstrategien, die der deutsche Übersetzer verwendet hat, zu zeigen und zu erläutern.
Der Roman von Viktor Pelewin „Das fünfte Imperium. Ein Vampirroman“ weist die typischen Merkmale der Postmoderne, Intertextualität und Metafiktionalität, auf. Der Autor nutzt in seinem Roman Techniken und Elemente der Postmoderne als Strategie. Er setzt in seinem Roman bekannte Texte ein, von den Liedern „Hotel California“ (some danse to remember, some danse to forget) und den Auszügen aus seinen eigenen Romanen bis zu Personen und Auszügen aus den Mythen und philosophischen Aufsätzen. Er zitiert sie und interpretiert sie weiter, sodass durch diese Intertextualität spielerisch ein neuer Sinn konstruiert wird und die Texte mehrdeutig erscheinen. Seine typischen Mittel sind das Zitieren, das Spiel mit Wortbedeutungen, das Mischen der literarischen Gattungen, des Stils und des Jargons, das Zusammenfügen von Unterhaltung und Philosophie. Seine Witze sind linguistischer Natur, sie basieren auf dem Spiel mit Etymologie, Synonymie etc. Pelewins Texte sind auch durch Merkmale der Postmoderne wie Multikulturalismus und Mehrsprachigkeit geprägt, wobei auch Fremdheit dadurch erzeugt wird. Der Autor spielt mit den Texten anderer Kulturen, nutzt andere Sprachen, um einen komplizierten, mehrdeutigen Text zu schaffen.
Die Fremdheit von Pelewins Texten ist vielschichtig und weist verschiedene Steigerungsgrade auf. Fremdheit ist somit ein konstitutiver Bestandteil von Pelewins Werken und hat Potenzial für die Untersuchung. In dieser Arbeit steht die Fremdheit des literarischen Diskurses als literarische Strategie im Mittelpunkt. Bei der Analyse der Fremdsprachen, die der Autor benutzt, wird nur auf die Beispiele aus der englischen Sprache eingegangen.
Fremdheit schlägt sich im literarischen Diskurs vor allem in Code-Switching nieder. Code-Switching wird im Text vom Autor als Strategie eingesetzt, um beim Leser eine bestimmte Reaktion zu erzielen. Somit lässt sich in diesem Zusammenhang von funktionalem Code-Switching sprechen. Die Ergebnisse der Untersuchung erfüllen innerhalb des Code-Switching Modells im Roman folgende diskursstrategischen Funktionen:155
1. Expressive Funktion: persönliche Einstellung, Bewertung einer Situation:
Der Hauptheld Roma nennt das Zimmer, in dem er aufgewachsen ist, bedroom, um damit einen Bezug zu westlichen Wohnungen herzustellen:156 „In diesem ‚Bedroom‘ wuchs ich auf.“157 Der Übersetzer benutzt hier verfremdendes Übersetzen und betont wie der Autor die Anspielung auf den Westen.
Ein Vampir-Lehrer benutzt an einer anderen Stelle im Roman während seiner Rede das englische Wort cubicle158 und betont es, um seine Verachtung gegenüber dem modernen Arbeitsplatz zu äußern. Der Übersetzer benutzt hier das einbürgernde Übersetzen: „[…] doch der moderne Büroarbeitsplatz ist sogar äußerlich einem Koben im Rinderstall ähnlich […].”159
2. Phatische bzw. metakommunikative Funktion: Metakommentare in der anderen Sprache:
Der Autor benutzt englische Begriffe, um den Unterschied zwischen fast-food chain und food chain zu erklären. Er wiederholt die Begriffe auch auf Russisch: „Макдональдс – это fast-food chain, „цепь быстрого питания.“160 Der Übersetzer benutzt das einbürgernde Übersetzen, er lässt die englischen Begriffe aus: „Einer Nahrungskette gehören Pflanzen und Tiere an, die durch das Prinzip „Fressen und gefressen werden“ miteinander verbunden sind.“161
Der Vampir-Lehrer erklärt den Begriff conspicuous consumption, indem er den Begriff auf Russisch und auf Englisch benutzt.162 Der Übersetzer benutzt das einbürgernde Übersetzen, er lässt aber die englischen Begriffe nicht komplett aus: „Metrosexualität […] ist nur eine neuere Verpackung von Geltungskonsum“, und weiter im Text heißt es: „Ach so, ich weiß: conspicuous consumption.“163
Der junge Vampir Rama benutzt den Werbeslogan der Marke „Patek Philippe“ auf Englisch: „You never actually own a Patek Philippe. You merely look after it for the next generation“, als ein Kommentar, eine Begründung zu seiner negativen Einstellung zum Produkt.164 Der Übersetzer benutzt hier verfremdendes Übersetzen und lässt den Slogan unübersetzt.
3. Poetische Funktion: Wortspiele, Witze und Gedichte:
Der russische Name des Romans verweist bereits auf ein Spiel – das englische Wort Empire V ist ein phonetisches Homonym zum russischen Wort Вампир (‚Vampir‘), wenn man den ersten Buchstaben ans Ende des Wortes verschiebt: ‚ampir V’. Das wird im Buch erklärt.165 Der Übersetzer verwendet das einbürgernde Übersetzen, wenn er die Überschrift ins Deutsche übersetzt, bei der Erklärung im Text wird allerdings das verfremdende Übersetzen verwendet. Der Name des Romans lautet auf Deutsch: „Das fünfte Imperium. Ein Vampirroman“. In der deutschen Übersetzung ist dazu Folgendes zu finden: „In Wirklichkeit handelt es sich um die humane Vampire-Rule-Epoche, das Weltimperium der Vampire oder auch in kryptischer Symbolik: Empire V.“166
Der Autor spielt mit dem Ausdruck Windows XP, wenn der Hauptheld die englischen Buchstaben auf Russisch liest.167 „Stimmt! […] Windows chrrrr…“, „[…] indem er das XP als russische Buchstaben nahm und aussprach – es ergab sich ein grimmiges Knurren.“168
Der Name des amerikanischen Autors Gore Vidal wird zum Witz, indem der Autor den Ausdruck betont und auf Russisch schreibt, dann heißt es ‚er hat Unglück gesehen‘.169 Der Übersetzer umschreibt den Witz, benutzt das einbürgernde Übersetzen: „Den Namen Gore Vidal konnte ich nicht lesen, ohne ihn sofort kyrillisch transkribiert zu sehen, und dann stand da: Viel Leids Gesehen …“170.
Der Erzähler verspottet an einer weiteren Stelle im Roman den englischen Namen einer russischen Boutique: „HeightReason“171 denn, wird diese in kyrillischen Buchstaben geschrieben, kommt es zu einem merkwürdigen Wort „ХайТризон“172 ([haitrison]). Um den Witz beizubehalten, benutzt der Übersetzer die Rückübersetzung ins Englische: „Russisch geschrieben, las sich der Name eher wie HighTreason.“173.
Der Erzähler spielt zudem mit phonetischen Homonymen, so mit dem englischen true batch und dem russischen Трубач (‚Hornist‘).174 Der Übersetzer gibt dazu zwei Kommentare, zwei alternative Übersetzungen, um den Witz zu übertragen: „Sobald der Hornist zum Rückzug bläst/Wenn die treue Gang den Mob an Kerligkeit aussticht“175.
Ein anderer Vampir-Lehrer benutzt ein englisches Wort hamlet, auf Russisch Хамлет geschrieben, um einen Begriff aus der Vampir-Welt einzuführen. Der Autor spielt dabei mit dem Namen des berühmten Literaturhelden Hamlet.176 „Das ist unser Hamlet.“ – „Shakespeare?“ – „Nein, nicht Shakespeare. Aber aus dem Englischen. Es bedeutet: kleines Dorf ohne Kirche.“177 Der Übersetzer umschreibt den Witz, benutzt das einbürgernde Übersetzen.
Auf diese Weise wird auch Heartland als ein Vampir-Ort eingeführt, auf Russisch Хартланд geschrieben. Dann wird vom Hauptheld auf die Bedeutung des Wortes eingegangen, dass es eventuell auf zwei englischen Wörter zurückgeht – heart, land.178 Der Übersetzer benutzt das verfremdende Übersetzen: „Hera VIII. ist in Heartland gelandet“179.
Die Aussage des Vampirs wird wiederholt – einmal auf Russisch, und dann auf Englisch: „Человек делает деньги. He or she makes money.“180 Der Übersetzer benutzt das verfremdende Übersetzen: „He or she makes money“181.
Die poetische Funktion wird erfüllt, wenn der Schriftsteller mit Fremdsprachen und Code-Switching spielt und dadurch zwischensprachliche Wortspiele schafft, die als konstantes Zeichen seiner Texte gelten.182
4. Der Autor benutzt Code-Switching als Identitätsmerkmal:
Der Vampir Mitra benutzt das englische Wort price, auf Russisch прайс geschrieben, um sich als intelligenter Vampir von den Menschen abzugrenzen.183 Der Übersetzer benutzt das einbürgernde Übersetzen: „Zum gleichen schlechten Preis“184.
Rama benutzt oft englische Wörter, die im Text auf Russisch geschrieben werden – user pick (Юзерпик)185, message (Мессидж)186, account (аккаунт)187, friends (френды)188, drink (дринк)189 etc., um seinen glamourösen Vampir-Diskurs von dem früheren Outsider-Diskurs des Menschen Roma abzugrenzen. Der Übersetzer benutzt das verfremdende Übersetzen: „Außerdem meinte ich das Mädchen schon auf einem UserPic im LiveJournal gesehen zu haben.“190 Des Weiteren wird das einbürgernde Übersetzen verwendet: „Die nackten Handgelenke des eingesperrten Oligarchen sprachen eine beredte Sprache“191, message wird ausgelassen und umgeschrieben. Bei account, friends und drink benutzt der Übersetzer das verfremdende Übersetzen: „Vielleicht hatte sie dort einen Account? Ich hatte einen – mit an die fünfzig registrierten Friends“192 ; „Und Vampire mixen sich ihren Drink daraus.“193
Als Antwort auf eine Frage äußert der Vampir Osiris auf Englisch: „some dance to remember, some dance to forget“194, und er benutzt das Englische auch, um sich als Vampir von den Menschen abzugrenzen. Der Übersetzer verwendet das verfremdende Übersetzen: „some dance to remember, some dance to forget“195, ohne der deutschen Übersetzung einen Kommentar hinzuzufügen.
Fremdheit als Identitätsmerkmal symbolisiert also bei Pelewin die Elite, die Fremdsprachen beherrscht und sich dadurch von anderen Menschen (und Vampiren) abhebt.
Als Ergebnis der Untersuchung lasst sich Folgendes feststellen: Im russischen Text wird die Fremdheit untersucht, die sich in Form von Code-Switching zeigt. Durch Code-Switching im russischen Text wird von Pelewin die Mehrdeutigkeit geschaffen, die er auch dem russischen Leser schwermacht, diese zu entziffern. Sie erfüllt mehrere diskursstrategische Funktionen im Text. Damit die Fremdheit diese Funktionen auch in deutscher Übersetzung übernimmt, benutzt der Übersetzer oft die verfremdende Funktion, die Fremdheit wird anhand vieler Beispiele behalten, die deutsche Version wird dadurch auch vielschichtig. In manchen Fällen wird auch mit der einbürgernden Übersetzungsstrategie übersetzt, die Fremdheit geht verloren, um den Sinn richtig zu wiedergeben. An manchen Beispielen wird klar, dass es sich oft um einen Mix der Übersetzungsstrategien handelt – um ein Spagat zwischen dem Sinn und der Fremdheit hinzubekommen, benutzt der Übersetzer oft entweder zwei Strategien gleichzeitig oder eine alternative Version. Die besondere Schwierigkeit stellt die Fremdheit dar, die eine poetische Funktion erfüllt: Sprachspiele und Witze stoßen meistens an die Grenze der Übersetzbarkeit. Es gibt Fälle, wo durch das einbürgernde Übersetzen die Fremdheit und ihre Funktion verloren gehen, meistens an Beispielen, wo Code-Switching als Identitätsmerkmal der Elite der Vampire von Bedeutung ist und mit der Verfremdungsstrategie zu übersetzen wäre. Im Großen und Ganzen erfüllt, wenn das verfremdende Verfahren durchgeführt wird, die Fremdheit in der Übersetzung eine sehr ähnliche Funktion wie im Originaltext.
Im Ergebnis lässt sich sagen, dass Pelewins Roman ein postmoderner komplexer und vielschichtiger Roman ist. Die Handlung lässt sich in drei Erzählebenen teilen: thematische, inhaltliche und soziale. Die Fremdheit des literarischen Diskurses ist dabei ein strategisch eingesetztes literarisches Mittel. Als ein Mittel der Satire lässt der Autor die Literaturpersonen mit einem glamourösen Diskurs reden und macht sich dadurch über sie lustig, dafür setzt der Autor Code-Switching ein. Als Teil des Spiels mit intertextuellen Bezügen, ist Code-Switching auch von Bedeutung. Dadurch verkompliziert Pelewin seinen Roman und schafft ein interessantes postmodernes Werk.
5 Schlussbemerkung
Im Globalisierungskontext ist das Thema Fremdheit wichtig. Das Phänomen Fremdheit ist aber vielseitig und komplex, in der literaturwissenschaftlichen Fremdheitsforschung ist die Erarbeitung von Kompetenzen für den Umgang mit der Fremdheit und neue Darstellungsformen der Fremdheit in der Literatur von besonderem Interesse, mit denen sich die interkulturelle Hermeneutik beschäftigt. Da der Begriff der Fremdheit sehr komplex ist, wurden verschiedene Ansätze zur Interpretation dargestellt und im Rahmen dieser Arbeit nur der alternativen Ansatzes von Andrea Leskovec fokussiert. Die Fremdheit wurde auf mehrere Steigerungsgrade hin ausgelegt und auf einen Teil der strukturellen Dimension von Fremdheit, der Fremdheit des literarischen Diskurses, wurde eingegangen. Diese Fremdheit zeigt sich im literarischen Diskurs oft als Code-Switching. Code-Switching erfüllt verschiedene diskursstrategische Funktionen im Diskurs, wird in der Gesprächsforschung untersucht, ist aber aktuell auch für die Forschung im Literaturübersetzen von Relevanz geworden. Das linguistische Modell von Appel/Muysken wurde also für die Untersuchung des literarischen Diskurses übertragen. Anhand dieses Modells und der Analyse lässt sich feststellen, dass Fremdheit in den Texten von Pelewin verschiedene Funktionen erfüllt und ein strategisch eingesetztes Mittel ist. Bei der Übersetzung bekommt die Fremdheit ein neues Potential, für den Übersetzer stellt sie eine Herausforderung dar. Der Übersetzer benutzt einen Mix der Strategien: das einbürgernde Übersetzen und das verfremdende Übersetzen. Damit schafft er eine gelungene Übersetzung.
6 Bibliographie
Primärliteratur
1. Pelewin, Viktor (2009): Das fünfte Imperium. Ein Vampirroman, übers. aus dem Russischen von Andreas Tretner, München: Luchterhand.
2. Пелевин, Виктор (2009) 2006: Empire V, Москва: Эксмо. (Die Originalausgabe: Pelewin, Viktor (2006): Empire V, Moskau: Eksmo).
Sekundärliteratur
1. Albrecht, Corinna (1992): „Fremdheitsbegriffe der Wissenschaften. Bericht über das Beyreuther Symposium zur Begründung einer interdisziplinären Fremdheitsforschung vom 11.-13.Juli 1990“, in: Eggers, Dietrich et al. (ed.) (1992): Jahrbuch Deutsch als Fremdsprache, 18 vol., München: Iudicum, S. 544-546.
2. Albrecht, Corinna (1997): „Der Begriff „der, die, das Fremde“. Zum wissenschaftlichen Umgang mit dem Thema Fremde – ein Beitrag zur Klärung einer Kategorie“, in: Bizeul, Yves et al. (ed.) (1997): Vom Umgang mit dem Fremden. Hintergrund – Definitionen – Vorschläge, Weinheim/Basel: Beltz, S. 80–93.
3. Albrecht, Corinna (2003): „Kulturwissenschaftliche Xenologie und Kulturkomparatisik“, in: Bogner Andrea/ Wierlacher Alois (ed.) (2003): Handbuch Interkulturelle Germanistik, Stuttgart/Weimar: J.B. Metzler, S. 131-144.
4. Altmayer, Claus (2004): Kultur als Hypertext. Zu Theorie und Praxis der Kulturwissenschaft im Fach Deutsch als Fremdsprache, München: Iudicium.
5. Apel, Friedmar (1983): Literarische Übersetzung, Stuttgart : Metzler.
6. Appel, Rene/ Muysken, Pieter (1987): Language contact and bilingualism, New York: Edward Arnold.
7. Bachman-Medick, Doris (1997): „Einleitung“, in: Bachmann-Medick, Doris (ed.) (1997): Übersetzung als Repräsentation fremder Kulturen, Berlin: Erich Schmidt, S. 1-18 (=Göttinger Beiträge zur Übersetzungsforschung 12).
8. Bachtin, Michail M. (1979): Die Ästhetik des Wortes, Frankfurt: Suhrkamp.
9. Bausinger, Herrmann (1986): „Kulturelle Identität – Schlagwort und Wirklichkeit“, in: Bausinger, Herrmann (ed.) (1986): Ausländer – Inländer. Arbeitsmigration und kulturelle Identität, Tübingen: Tübinger Vereinigung für Volkskunde, S. 141-159.
10. Blom, Jan-Petter/ Gumperz, John J. (1972): „Social meaning in linguistic structures: Code switching in northern Norway“, in: Gumperz, John J. / Hymes, Dell. (1972): Directions in Sociolinguistics, New York: Holt, Rinehart, and Winston, S. 407-434.
11. Bogner, Andrea/ Wierlacher, Alois (2003): Handbuch Interkulturelle Germanistik, Stuttgart/Weimar: Metzler.
12. Christ, Tomas (1999): South of the border, al norte del Río Grande: Grenzüberschreitung und Fremdheitserfahrung in Texten von Cormac McCarthy, Genaro González und Carlos Fuentes, Würzburg: Königshausen/Neumann.
13. Clyne, Michael (1991): „Zu kulturellen Unterschieden in der Produktion und Wahrnehmung englischer und deutscher wissenschaftlicher Texte“, Info DaF 4, S. 376-383.
14. Clyne, Michel (1975): Forschungsbericht Sprachkontakt. Untersuchungsergebnisse und praktische Probleme, Kronberg/Ts: Scriptor.
15. Coseriu, Eugenio (1980): Textlinguistik, Tübingen: Narr.
16. Dalton-Brown, Sally (1997): “Ludic nonchalance or ludicrous despair? Viktor Pelevin and Russian postmodernist prose. Viktor Pelewin and Russian postmodernist prose”, Slavonic and East European Review 75/2, S. 216-233.
17. Földes, Csaba (2005): Kontaktdeutsch, Tübingen: Narr.
18. Frank, Armin Paul (1987): „Einleitung“, in: Schultze, B. (ed.) (1987): Die literarische Übersetzung. Fallstudien zu Ihrer Kulturgeschichte, Berlin: Erich Schmidt, IX-XVII (=Göttinger Beiträge zur Internationalen Übersetzungsforschung 1).
19. Gadamer, Hans-Georg (1975): Wahrheit und Methode. Grundzüge der philosophischen Hermeneutik, Tübingen: J.C.B. Mohr.
20. Glück, Helmut (ed.) (1993): Metzler Lexikon Sprache, Stuttgart/ Weimar: Metzler.
21. Grübel, Rainer (1979): „Die Ästhetik des Wortes bei Michail Bachtin“, in: Bachtin, Michail (1979): Die Ästhetik des Wortes, 40 vol., Opera Slavica, Frankfurt/Main: Otto Harrassowitz, S. 21-89.
22. Hermanns, Fritz (1996): „Fremdheit. Zur Semantik eines vielfach polysemen Wortes“, in: Hess-Lüttich, Ernest W.B. et al. (ed.) (1996): Fremdverstehen in Sprache, Literatur und Medien, Frankfurt / Bern / New York: Peter Lang, S. 37-56.
23. Hermans, Theo (1985): The Manipulation of Literature, Studies of Literary Translation, London/ Sydney: Croom Helm, S. 11.
24. Hinderer, Walter (1993): „Das Phantom des Herrn Kannitverstan. Methodische Überlegungen zu einer interkulturellen Literaturwissenschaft als Fremdheitswissenschaft“, in: Wierlacher, Alois (2001): Architektur interkultureller Germanistik, München: Iudicium, S. 199-217.
25. Horn, Peter (1987): „Fremdheitskonstruktionen weißer Kolonisten“, in: Wierlacher, Alois (ed.) (1987): Perspektiven und Verfahren interkultureller Germanistik, München: Iudicium, S. 405-418.
26. Hunfeld, Hans (1995): „Erlkönigs Tochter. Über das Mißverständnis, Fremdes verstehen zu müssen“, Info DAF 22, S. 19-23.
27. Huntemann, Willi/ Rühling, Lutz (ed.) (1997) : F remdheit als Problem und Programm: Die literarische Übersetzung zwischen Tradition und Moderne, Berlin: Schmidt (=Göttinger Beiträge zur Internationalen Übersetzungsforschung 14).
28. Jakobson, Roman (1979): Poetik: ausgewählte Aufsätze 1921-1971, Frankfurt/Main: Suhrkamp.
29. Japp, Uwe (1977): Hermeneutik, München: Fink.
30. Jauß, Hans Robert (1982): Ästhetische Erfahrung und literarische Hermeneutik, Frankfurt/Main: Suhrkamp.
31. Jostes, Brigitte (1997): „Was heißt hier fremd ? Eine kleine semantische Studie“, in: Naguschewski, Dirk/ Trabant, Jürgen (ed.) (1997): Was heißt hier ‚fremd‘? Studien zu Sprache und Fremdheit, Berlin: Akademie Verlag, S. 11-76.
32. Krusche, Dietrich (1983): „Eigenes als Fremdes. Zu Sprach- und Literaturdidaktik im Fache Deutsch als Fremdsprache“, Neue Sammlung 23, S. 27-41.
33. Krusche, Dietrich (1985): Literatur und Fremde. Zur Hermeneutik kulturräumlicher Distanz, München: Iudicium.
34. Krusche, Dietrich (1987): „Warum gerade Deutsch? Zur Typik fremdkultureller Rezeptionsinteressen“, in: Wierlacher, Alois (ed.) (1987): Perspektiven und Verfahren interkultureller Germanistik, München: Iudicium, S. 99-112 .
35. Leskovec, Andrea (2009): „Fremdheit und Literatur. Alternativer hermeneutischer Ansatz für eine interkulturell ausgerichtete Literaturwissenschaft“, Berlin: Dr. W. Hopf (=Kommunikation und Kulturen 8).
36. Lönker, Fred (1992): Die literarische Übersetzung als Medium der Fremderfahrung, Berlin: Erich Schmidt.
37. Mecklenburg, Norbert (1987): „Über kulturelle und poetische Alterität. Kultur- und literaturtheoretische Grundprobleme einer interkulturellen Germanistik“, in: Wierlacher, Alois (1987): Perspektiven und Verfahren interkultureller Germanistik, München: Iudicium, S. 563-584.
38. Mecklenburg, Norbert (1990): „Über kulturelle und poetische Alterität. Kultur- und literaturtheoretische Grundprobleme einer interkulturellen Germanistik“, durchges. und verb. Fassung in: Krusche, Dietrich/ Wierlacher, Alois (ed.) (1990): Hermeneutik der Fremde, München: Iudicium, S. 80-102.
39. Müller, Natascha (ed.) (2006): Einführung in die Mehrsprachigkeitsforschung: Deutsch - Französisch – Italienisch, Tübingen: Narr, S. 177.
40. Münkler, Herfried / Ladwig, Bernd (1998): „Einleitung: Das Verschwinden des Fremden und die Pluralisierung der Fremdheit“, in: Münkler, Herfried (ed.) (1998): Die Herausforderung durch das Fremde. Interdisziplinäre Arbeitsgruppen, Forschungsberichte, 5 vol., Berlin: Akademie Verlag, S. 11-25.
41. Muysken Pieter (2000): Bilingual Speech: A Typology of Code-Mixing, Cambridge: Cambridge University Press.
42. Nünning, Ansgar/ Sommer, Roy (ed.) (2004): Kulturwissenschaftliche Literaturwissenschaft, Tübingen: Narr.
43. Ohle, Karlheinz (1978): Das Ich und das Andere. Grundzüge einer Soziologie des Fremden, Stuttgart: Lucius und Lucius.
44. Reuter, Julia (2002): Ordnungen des Anderen. Zum Problem des Eigenen in der Soziologie des Fremden, Bielefeld: Transcript.
45. Ricoeur, Paul (2005): Vom Text zur Person. Hermeneutische Aufsätze (1970-1999), Hamburg: Felix Meiner.
46. Riehl, Claudia Maria (2009): Sprachkontaktforschung, Tübingen: Narr.
47. Sandkühler, Hans Jörg (ed.) (1999): Enzyklopädie Philosophie, 1 vol., Hamburg: Meiner.
48. Stolze, Radegundis (2005): Übersetzungstheorien, Tübingen: Narr.
49. Turk, Horst (1993): „Alienität und Alterität als Schlüsselbegriffe einer Kultursemantik. Zum Fremdheitsbegriff der Übersetzungsforschung“, in: Wierlacher, Alois (1993): Kulturthema Fremdheit. Leitbegriffe und Problemfelder kulturwissenschaftlicher Fremdheitsforschung. Mit einer Forschungsbibliographie von Corinna Albrecht et al. Reihe: Kulturthemen, S. 173-197 (=Beiträge zur Kulturthemenforschung interkultureller Germanistik 1).
50. Venuti, Lawrence (1995): The translator's invisibility: A History of Translation, London/ New York: Routledge.
51. Waldenfels, Bernhard (1997): Topographie des Fremden, Frankfurt/Main: Suhrkamp.
52. Weinrich, Harald (1985): Wege der Sprachkultur, Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt.
53. Weinrich, Harald (1990): „Fremdsprachen als fremde Sprachen“, in: Krusche, Dietrich/ Wierlacher, Alois (ed.) (1990): Hermeneutik der Fremde, München: Iudicium, S. 24-47.
54. Wierlacher, Alois (1976): „Vorwort“, in Wierlacher, Alois, et al. (ed.) (1976): Jahrbuch Deutsch als Fremdsprache, 2 vol., Heidelberg: Groos, V.
55. Wierlacher, Alois (1985): „Einführung in den Thematischen Teil: Literaturforschung als Fremdheitsforschung“, in: Bogner, Andrea et al. (ed.) (1985): Jahrbuch Deutsch als Fremdsprache, 11 vol., Heidelberg: Groos,Heidelberg: Groos, S. 103-208.
56. Wierlacher, Alois (1993): „Kulturwissenschaftliche Xenologie“, in Wierlacher, Alois (ed.) (1993): Kulturthema Fremdheit. Leitbegriffe und Problemfelder kulturwissenschaftlicher Fremdheitsforschung. Mit einer Forschungsbibliographie von Corinna Albrecht et al., S.19-112. (=Kulturthemen. Beiträge zur Kulturthemenforschung interkultureller Germanistik 1).
57. Wierlacher, Alois (ed.) (2000) 1985: Das Fremde und das Eigene. Prolegomena zu einer interkulturellen Germanistik, München: Iudicium.
58. Winterstein, Werner (2006a): Poetik der Verschiedenheit. Literatur, Bildung, Globalisierung, Klagenfurt: Drava.
59. Wintersteiner, Werner (2001b): „Hätten wir das Wort, wir bräuchten die Waffen nicht. “ Erziehung für eine Kultur des Friedens, Innsbruck/ Wien/ München: Studien Verlag.
Internet-Dokumente
1. Madela, Marian (2009): Strategien postmoderner Dekanonisierung – Klassische russische Literatur in Viktor Pelevins „Čapaev i Pustota“, < http://othes.univie.ac.at/6359/1/2009-09-08_0409752.pdf> (letzter Zugriff: 27.07.2011).
2. Makeewa, Xenia (s.a.): „Творчество Виктора Пелевина“, <http://pelevin.nov.ru/stati/o-mak/1.html> (letzter Zugriff: 27.07.2011).
3. Müller, Burkhard (2009): „Der Mensch als Vieh“,< http://www.sueddeutsche.de/kultur/viktor-pelewin-vampir-roman-der-mensch-als-milchvieh-1.411758> (letzter Zugriff: 27.07.2011).
4. Random House, Bertelsman, die offizielle Webseite der Verlagsgruppe (s.a.):„Autoren: Andreas Tretner“, <http://www.randomhouse.de/author/author.jsp?per=74306> (letzter Zugriff: 27.07.2011).
5. Viktor Pelewin, die offizielle Webseite des russischen Schriftstellers (s.a.): „Texte“ <http://pelevin.nov.ru/texts/> (letzter Zugriff: 27.07.2011).
6. Zekri, Sonja (2003): „http://www.sueddeutsche.de/kultur/buchmesse-russland-der-unbezahlbare-skandal-1.429339> (letzter Zugriff: 27.07.2011).
[...]
1 Sandkühler, Hans Jörg (ed.) (1999): Enzyklopädie Philosophie, 1 vol., Hamburg: Meiner, S. 407.
2 Albrecht, Corinna (2003): „Kulturwissenschaftliche Xenologie und Kulturkomparatistik“, in: Bogner, Andrea/ Wierlacher, Alois (ed.) (2003): Handbuch Interkulturelle Germanistik, Stuttgart/Weimar: J.B. Metzler, S. 544-546; Zitat S. 541.
3 Wierlacher, Alois (1976): „Vorwort“, in: Wierlacher, Alois, et al. (ed.) (1976): Jahrbuch Deutsch als Fremdsprache, 2 vol., Heidelberg: Julius Groos, S.V.
4 Hinderer, Walter (1993): „Das Phantom des Herrn Kannitverstan. Methodische Überlegungen zu einer interkulturellen Literaturwissenschaft als Fremdheitswissenschaft“, in: Wierlacher, Alois (2001): Architektur interkultureller Germanistik, München: Iudicium Verlag, S. 199-217; Zitat S. 208.
5 Bogner, Andrea/ Wierlacher, Alois (2003): Handbuch Interkulturelle Germanistik, Stuttgart/Weimar: J.B. Metzler, S. 542.
6 Vgl. Krusche, Dietrich (1985): Literatur und Fremde. Zur Hermeneutik kulturräumlicher Distanz, München: Iudicium, S. 9.
7 Vgl. Ebd.
8 Vgl. Ebd., S. 9.
9 Vgl. Wierlacher, Alois (1985): „Einführung in den Thematischen Teil: Literaturforschung als Fremdheitsforschung“, in: Bogner, Andrea et al. (ed.) (1985): Jahrbuch Deutsch als Fremdsprache, 11 vol., Heidelberg: J. Groos, S. 103-208; Zitat S. 184.
10 Krusche 1985: 9.
11 Vgl. Wierlacher, Alois (1993): „Kulturwissenschaftliche Xenologie“, in Wierlacher, Alois (ed.) (1993): Kulturthema Fremdheit. Leitbegriffe und Problemfelder kulturwissenschaftlicher Fremdheitsforschung. Mit einer Forschungsbibliographie von Corinna Albrecht et al., S.74 ff. (=Kulturthemen. Beiträge zur Kulturthemenforschung interkultureller Germanistik 1).
12 Hunfeld, Hans (1995): „ Erlkönigs Tochter. Über das Missverständnis, Fremdes verstehen zu müssen“, in: Info DAF 22, S. 19-23; Zitat S. 23.
13 Leskovec, Andrea (2009): Fremdheit und Literatur. Alternativer hermeneutischer Ansatz für eine interkulturell ausgerichtete Literaturwissenschaft, Berlin: Dr. W. Hopf, S. 2 (=Kommunikation und Kulturen 8).
14 Vgl. Wintersteiner, Werner (2001b): „Hätten wir das Wort, wir bräuchten die Waffen nicht“. Erziehung für eine Kultur des Friedens. Innsbruck/ Wien/ München: Studien Verlag.
15 Leskovec 2009:2.
16 Ebd.
17 Vgl. Albrecht, Corinna (1992): „Fremdheitsbegriffe der Wissenschaften. Bericht über das Bayreuther Symposium zur Begründung einer interdisziplinären Fremdheitsforschung vom 11.-13. Juli 1990“, in: Eggers, Dietrich et al. (ed.) (1992): Jahrbuch Deutsch als Fremdsprache, 18 vol., München: Iudicium, S. 544-546.
18 Vgl. Wierlacher 1993: 62.
19 Vgl. Jostes, Brigitte (1997): „Was heißt hier fremd ? Eine kleine semantische Studie“, in: Naguschewski, Dirk/ Trabant, Jürgen (ed.) (1997): Was heißt hier ‚fremd‘? Studien zu Sprache und Fremdheit, Berlin: Akademie Verlag, S. 11-76.
20 Wierlacher 1993:12.
21 Ebd., S. 62.
22 Ebd.
23 Ebd..
24 Hermanns, Fritz (1996): „Fremdheit. Zur Semantik eines vielfach polysemen Wortes“, in: Ernest W. B. Hess-Lüttich, Christoph Siegrist et al. (ed.) (1996): Fremdverstehen in Sprache, Literatur und Medien, Frankfurt / Bern / New York: Peter Lang, S. 37-56; Zitat S. 37.
25 Vgl. Jostes 1997:15 ff.
26 Ebd., S. 29.
27 Ebd.
28 Vgl. Hermanns 1996: 37.
29 Vgl. Ebd., S. 37-56.
30 Münkler, Herfried / Ladwig, Bernd (1998): „Einleitung: Das Verschwinden des Fremden und die Pluralisierung der Fremdheit“, in: Münkler, Herfried (ed.) (1998): Die Herausforderung durch das Fremde. Interdisziplinäre Arbeitsgruppen, Forschungsberichte, 5 vol., Berlin: Akademie Verlag, S. 11-25.
31 Vgl. Ebd.
32 Wierlacher 1993: 52.
33 Vgl. Ebd.
34 Reuter, Julia (2002): Ordnungen des Anderen. Zum Problem des Eigenen in der Soziologie des Fremden, Bielefeld: Transcript, S. 27.
35 Ebd.
36 Turk, Horst (1993): „Alienität und Alterität als Schlüsselbegriffe einer Kultursemantik. Zum Fremdheitsbegriff der Übersetzungsforschung“, in: Wierlacher, Alois (1993): Kulturthema Fremdheit. Leitbegriffe und Problemfelder kulturwissenschaftlicher Fremdheitsforschung. Mit einer Forschungsbibliographie von Corinna Albrecht et al., S. 173-197; Zitat S. 182 (=Kulturthemen. Beiträge zur Kulturthemenforschung interkultureller Germanistik 1).
37 Weinrich, Harald (1990): „Fremdsprachen als fremde Sprachen“, in: Krusche, Dietrich/ Wierlacher, Alois (ed.) (1990): Hermeneutik der Fremde, München: Iudicium, S. 24-47; Zitat S. 24.
38 Ebd., S. 26.
39 Mecklenburg, Norbert (1990): „Über kulturelle und poetische Alterität. Kultur- und literaturtheoretische Grundprobleme einer interkultureller Germanistik“, in: Krusche, Dietrich/ Wierlacher, Alois (ed.) (1990): Hermeneutik der Fremde, München: Iudicium, S. 80-102; Zitat S. 80.
40 Krusche, Dietrich (1983): „Eigenes als Fremdes, Zu Sprach- und Literaturdidaktik im Fache Deutsch als Fremdsprache“, in: Neue Sammlung 23, S. 27-41; Zitat S. 27.
41 Bausinger, Herrmann (1986): „Kulturelle Identität – Schlagwort und Wirklichkeit“, in: Bausinger, Herrmann (ed.) (1986): Ausländer-Inländer. Arbeitsmigration und kulturelle Identität, Tübingen: Tübinger Vereinigung für Volkskunde, S. 141-159; Zitat S. 143.
42 Vgl. Albrecht, Corinna (1997): „Der Begriff „der, die, das Fremde“. Zum wissenschaftlichen Umgang mit dem Thema Fremde – ein Beitrag zur Klärung einer Kategorie“, in: Bizeul, Yves et al. (ed.) (1997): Vom Umgang mit dem Fremden. Hintergrund – Definitionen – Vorschläge, Weinheim/Basel: Beltz, S.80–93.
43 Vgl. Horn, Peter (1987): „Fremdheitskonstruktionen weißer Kolonisten“, in: Wierlacher, Alois (ed.) (1987): Perspektiven und Verfahren interkultureller Germanistik, München: Iudicium, S. 405-418.
44 Vgl. Ohle, Karlheinz (1978): Das Ich und das Andere. Grundzüge einer Soziologie des Fremden, Stuttgart: Lucius und Lucius, S. 29-65.
45 Krusche, Dietrich (1987): „Warum gerade Deutsch? Zur Typik fremdkultureller Rezeptionsinteressen“, in: Wierlacher, Alois (ed.) (1987): Perspektiven und Verfahren interkultureller Germanistik, München: Iudicium, S. 99-112; Zitat S. 103.
46 Ebd., S. 103.
47 Leskovec 2009: 7.
48 Ebd.
49 Waldenfels, Bernhard (1997): Topographie des Fremden, Frankfurt/Main: Suhrkamp, S. 72.
50 Vgl. Ebd.
51 Vgl. Ebd., S. 23.
52 Altmayer, Claus (2004): Kultur als Hypertext. Zu Theorie und Praxis der Kulturwissenschaft im Fach Deutsch als Fremdsprache, München: Iudicium, S. 237.
53 Vgl. Leskovec 2009: 198.
54 Ebd.
55 Ebd.
56 Ebd.
57 Sie soll aus Gründen der Übersichtlichkeit in die Ebenen der Handlung und der Struktur geteilt werden, obwohl sich die Ebenen nicht voneinander trennen lassen.
58 Ebd., S. 205.
59 Vgl. Leskovec 2009: 198.
60 Ebd.
61 Altmayer 2004: 226.
62 Ebd., S. 229.
63 Vgl. Leskovec 2009: 198.
64 Jakobson, Roman (1979): Poetik: ausgewählte Aufsätze 1921-1971, Frankfurt/Main: Suhrkamp, S. 92.
65 Winterstein, Werner (2006a): Poetik der Verschiedenheit. Literatur, Bildung, Globalisierung, Klagenfurt: Drava, S. 120.
66 Vgl. Japp, Uwe (1977): Hermeneutik, München: Fink, S. 42.
67 Ebd.
68 Ricoeur, Paul (2005): Vom Text zur Person. Hermeneutische Aufsätze (1970-1999), Hamburg: Felix Meiner, S. 117.
69 Vgl. Leskovec 2009: 198.
70 Leskovec 2009: 208.
71 Im weiteren Verlauf der Arbeit wird nur noch die diskursive Fremdheit als Fremdheit bezeichnet.
72 Vgl. Weinrich, Harald (1985): Wege der Sprachkultur, Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt, S. 233.
73 Vgl. Coseriu, Eugenio (1980): Textlinguistik, Tübingen: Narr, S. 102.
74 Vgl. Jauß, Hans Robert (1982): Ästhetische Erfahrung und literarische Hermeneutik, Frankfurt/Main: Suhrkamp, S.33 ff.
75 Mecklenburg: 1987: 573.
76 Grübel, Rainer (1979): „Die Ästhetik des Wortes bei Michail Bachtin“, in: Bachtin, Michail (1979): Die Ästhetik des Wortes, 40 vol, Opera Slavica, Frankfurt/Main: Otto Harrassowitz, S. 21-89.
77 Ebd., S. 21.
78 Ebd.
79 Christ, Tomas (1999): South of the border, al norte del Río Grande: Grenzüberschreitung und Fremdheitserfahrung in Texten von Cormac McCarthy, Genaro González und Carlos Fuentes, Würzburg: Königshausen/Neumann, S. 18.
80 Ebd.
81 Mecklenburg 1987: 576.
82 Földes, Csaba (2005): Kontaktdeutsch, Tübingen: Narr, S. 37.
83 Glück, Helmut (ed.) (1993): Metzler Lexikon Sprache, Stuttgart/ Weimar: Metzler, S. 633.
84 Aus dem Vortrag von Dr. Mforbe, die Summer School bei der Heinrich Heine Universität, 2.8.-2011-4.8.2011.
85 Riehl, Claudia Maria (2009): Sprachkontaktforschung, Tübingen: Narr, S. 20.
86 Clyne, Michel (1975): Forschungsbericht Sprachkontakt. Untersuchungsergebnisse und praktische Probleme, Kronberg/Ts: Scriptor, S. 16.
87 Földes 2005: 73.
88 Ebd.
89 Földes 2005: 78.
90 Ebd.
91 Ebd., S. 79.
92 Ebd.
93 Vgl. Ebd.
94 Vgl. Riehl 2009: 20.
95 Földes 2005: 79.
96 Riehl 2009: 22.
97 Földes 2005: 80.
98 Muysken, Pieter (2000): Bilingual Speech: A Typology of Code-Mixing, Cambridge: Cambridge University Press, S. 33.
99 Müller, Natascha (ed.) (2006): Einführung in die Mehrsprachigkeitsforschung: Deutsch - Französisch – Italienisch, Tübingen: Narr, S. 177.
100 Muysken 2000: 33.
101 Mülle 2006: 177.
102 Muysken 2000: 33.
103 Müller 2006: 177.
104 Blom/ Gumperz 1972:408.
105 Vgl. Riehl 2009: 23.
106 Riehl 2009: 23
107 Ebd.
108 Blom, Jan-Petter/ Gumper, John J. (1972): „Social meaning in linguistic structures: Code switching in northern Norway“, in: Gumperz, J. J/ Hymes, D. (1972): Directions in Sociolinguistics, New York: Holt, Rinehart, and Winston, S. 407-434; Zitat S. 408.
109 Ebd.
110 Appel, Rene, /Muysken, Pieter (1987): Language contact and bilingualism. New York: Edward Arnold, S.119.
111 Ebd., S. 116.
112 Riehl 2009: 24.
113 Blom/Gumperz 1972: 408.
114 Ebd., S. 408.
115 Appel/Muysken 1987: 116.
116 Riehl 2009: 25.
117 Ebd.
118 Ebd.
119 Ebd.
120 Ebd.
121 Vgl. Bachman-Medick, Doris (1997): „Einleitung“, in: Bachmann-Medick, Doris (ed.) (1997): Übersetzung als Repräsentation fremder Kulturen, Berlin: Erich Schmidt, S. 1-18; Zitat S. 1 (=Göttinger Beiträge zur Übersetzungsforschung 12).
122 Ebd.
123 Ebd., S. 4.
124 Ebd.
125 Frank, Armin Paul (1987): „Einleitung“, in: Schultze, B. (ed.) (1987): Die literarische Übersetzung. Fallstudien zu Ihrer Kulturgeschichte, Berlin: Erich Schmidt, IX-XVII; Zitat: V (=Göttinger Beiträge zur Internationalen Übersetzungsforschung 1).
126 Gadamer, Hans-Georg (1975): Wahrheit und Methode. Grundzüge der philosophischen Hermeneutik, Tübingen: J.C.B. Mohr, S. 367.
127 Huntemann, Willi/ Rühling, Lutz (ed.) (1997): F remdheit als Problem und Programm: Die literarische Übersetzung zwischen Tradition und Moderne, Berlin: Schmidt, S. 12 (= Göttinger Beiträge zur Internationalen Übersetzungsforschung 14).
128 Ebd., S. 9.
129 Ebd.
130 Ebd., S. 10.
131 Ebd.
132 Ebd., S. 11.
133 Lönker, Fred (1992): Die literarische Übersetzung als Medium der Fremderfahrung, Berlin: Erich Schmidt, S. 50.
134 Stolze: 145.
135 Ebd.
136 Ebd., S. 146.
137 Ebd.
138 Venuti, Lawrence (1995): The Translator's Invisibility: A History of Translation, London/ New York: Routledge, S. 50.
139 Ebd., S. 148.
140 Stolze: 139, sie übernimmt ein Zitat von Hermans, Theo (1985): The Manipulation of Literature, Studies of Literary Translation, London/ Sydney: Croom Helm, S. 11.
141 Ebd., S. 149.
142 Ebd., S. 143.
143 Makeewa, Xenia (s.a.): „Творчество Виктора Пелевина“, <http://pelevin.nov.ru/stati/o-mak/1.html> (letzter Zugriff: 27.07.2011).
144 Viktor Pelewin, die offizielle Webseite des russischen Schriftstellers (s.a.): „Texte“ <http://pelevin.nov.ru/texts/> (letzter Zugriff: 27.07.2011).
145 Vgl. Zekri, Sonja (2003): „Russland - der unbezahlbare Skandal“, <http://www.sueddeutsche.de/kultur/buchmesse-russland-der-unbezahlbare-skandal-1.429339> (letzter Zugriff: 27.07.2011).
146 Madela, Marian (2009): Strategien postmoderner Dekanonisierung – Klassische russische Literatur in Viktor Pelevins „Čapaev i Pustota“, S. 142, < http://othes.univie.ac.at/6359/1/2009-09-08_0409752.pdf> (letzter Zugriff: 27.07.2011).
147 Dalton-Brown, Sally (1997): “Ludic nonchalance or ludicrous despair? Viktor Pelevin and Russian postmodernist prose. Viktor Pelewin and Russian postmodernist prose”, Slavonic and East European Review 75/2, S. 216.
148 Madela 2009:146.
149 Müller, Burkhard (2009): „Der Mensch als Vieh“,< http://www.sueddeutsche.de/kultur/viktor-pelewin-vampir-roman-der-mensch-als-milchvieh-1.411758> (letzter Zugriff: 27.07.2011).
150 Random House, Bertelsman, die offizielle Webseite der Verlagsgruppe (s.a.): „Autoren: Andreas Tretner“, <http://www.randomhouse.de/author/author.jsp?per=74306> (letzter Zugriff: 27.07.2011).
151 Erklärung der Verfasserin: Bablos ist ein Konzentrat aus dem Geld und der Lebensenergie der Menschen, die die Vampirfledermäusen sammeln und zur Göttin Ischtar bringen.
152 Pelewin 2009: 63.
153 Pelewin 2009: 62.
154 Appel/Muysken 1987: 116.
155 Appel/Muysken 1987: 119.
156 Пелевин, Виктор (2009): Empire V, Москва: Эксмо, S. 15.
157 Pelewin 2009: 29.
158 Пелевин 2009: 192.
159 Pelewin 2009: 177.
160 Пелевин 2009: 52.
161 Pelewin 2009: 51.
162 Пелевин 2009: 79.
163 Pelewin 2009: 75.
164 Пелевин 2009: 83.
165 Пелевин 2009: 297.
166 Pelewin 2009: 270.
167 Пелевин 2009: 33.
168 Pelewin 2009: 34.
169 Пелевин 2009: 69.
170 Pelewin 2009: 67.
171 Пелевин 2009: 83.
172 Ebd.
173 Pelewin 2009: 79.
174 Пелевин 2009: 93.
175 Pelewin 2009: 89.
176 Пелевин 2009: 58.
177 Pelewin 2009: 163.
178 Пелевин 2009: 162.
179 Pelewin 2009: 163.
180 Пелевин 2009: 192.
181 Pelewin 2009: 178.
182 Vgl. Dalton-Brown: 216.
183 Пелевин 2009: 29.
184 Pelewin 2009: 30.
185 Пелевин 2009: 130.
186 Ebd., S. 84.
187 Ebd., S. 203.
188 Ebd., S. 203.
189 Ebd., S. 216.
190 Pelewin 2009: 122.
191 Ebd., S. 79.
192 Ebd., S. 178.
193 Ebd., S. 196.
194 Ebd., S. 405.
Häufig gestellte Fragen zu dem Language Preview
Was ist der Gegenstand der vorliegenden Untersuchung?
Gegenstand der vorliegenden Untersuchung ist das Phänomen der Fremdheit und dessen Formen im literarischen Diskurs, dargestellt am Beispiel des russischen Romans „Das fünfte Imperium. Ein Vampirroman“ von Viktor Pelewin und dessen deutscher Übersetzung von Andreas Tretner.
Warum ist das Phänomen der Fremdheit ein wichtiges Thema?
Das Phänomen der Fremdheit ist ein komplexes und vielschichtiges Thema, das im Globalisierungskontext an Bedeutung gewinnt und innerhalb vieler Disziplinen untersucht wird.
Was ist das Ziel dieser Arbeit?
Ziel dieser Arbeit ist es, anhand des theoretischen Rahmens der literaturwissenschaftlichen Fremdheitsforschung innerhalb der interkulturellen Germanistik und der Übersetzungswissenschaft das Konzept von Fremdheit aus sprachwissenschaftlicher/übersetzungswissenschaftlicher Sicht näher zu untersuchen.
Wie wird Fremdheit in der aktuellen literaturwissenschaftlichen Fremdheitsforschung untersucht (Kapitel 2.1)?
Kapitel 2.1 stellt dar, wie Fremdheit in der aktuellen literaturwissenschaftlichen Fremdheitsforschung der interkulturellen Germanistik untersucht wird.
Was behandelt Kapitel 2.2?
Der Begriff der Fremdheit ist Thema des Kapitels 2.2.
Was wird in Kapitel 2.3 untersucht?
In Kapitel 2.3. wird auf die Formen der Fremdheit in der Literatur bzw. auf die sprachlichen Darstellungsweisen der Fremdheit im literarischen Diskurs eingegangen. Außerdem wird analysiert, welche Funktion Fremdheit als literarisches Mittel im Roman erfüllt.
Wie wird Fremdheit als Übersetzungsproblem behandelt?
In Kapitel 3.1. wird auf Fremdheit als Übersetzungsproblem eingegangen.
Welche Strategien werden in der Übersetzungswissenschaft für die Übersetzung von Fremdheit verwendet?
Das Kapitel 3.2. stellt die Strategien vor, die in der Übersetzungswissenschaft für die Übersetzung der Fremdheit verwendet werden.
Was ist der Inhalt von Kapitel 4?
In Kapitel 4. Erfolgt eine Übertragung der theoretischen Erkenntnisse auf den Roman „Das fünfte Imperium. Ein Vampirroman“.
Was wird in Kapitel 4.1 präsentiert?
In Kapitel 4.1. wird eine Inhaltsangabe des Romans gegeben.
Was ist der Fokus von Kapitel 4.2?
In Kapitel 4.2. wird Fremdheit und deren Funktion an Beispielen aus diesem russischen Roman und seiner deutschen Übersetzung untersucht.
Welche abschließende Zusammenfassung wird in Kapitel 5 gegeben?
In Kapitel 5 wird abschließend ein Fazit gegeben.
Was für eine Art Text ist "Das fünfte Imperium. Ein Vampirroman"?
Die Vampirgeschichte "Das fünfte Imperium" ist ein postmoderner Mix aus Bildungsroman, Satire und Märchen, verfeinert mit Philosophie, wodurch er sich von anderen zurzeit beliebten Vampir-Romanen unterscheidet.
Welche diskursstrategischen Funktionen des Code-Switching werden im Roman erfüllt?
Die Ergebnisse der Untersuchung erfüllen innerhalb des Code-Switching Modells im Roman folgende diskursstrategischen Funktionen: Expressive Funktion, Phatische bzw. metakommunikative Funktion, Poetische Funktion, Code-Switching als Identitätsmerkmal.
Details
- Titel
- Die Fremdheit in der deutschen Übersetzungsliteratur
- Untertitel
- Erläutert am Roman von Viktor Pelewin "Das fünfte Imperium. Ein Vampirroman"
- Hochschule
- Universität Siegen (Philosophische Fakultät)
- Note
- 2,0
- Autor
- Tatiana Istomina (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2011
- Seiten
- 46
- Katalognummer
- V992468
- ISBN (eBook)
- 9783346354921
- ISBN (Buch)
- 9783346354938
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Fremdheit Übersetzungsliteratur Pelewin
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 0,99
- Preis (Book)
- US$ 28,99
- Arbeit zitieren
- Tatiana Istomina (Autor:in), 2011, Die Fremdheit in der deutschen Übersetzungsliteratur, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/992468
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-