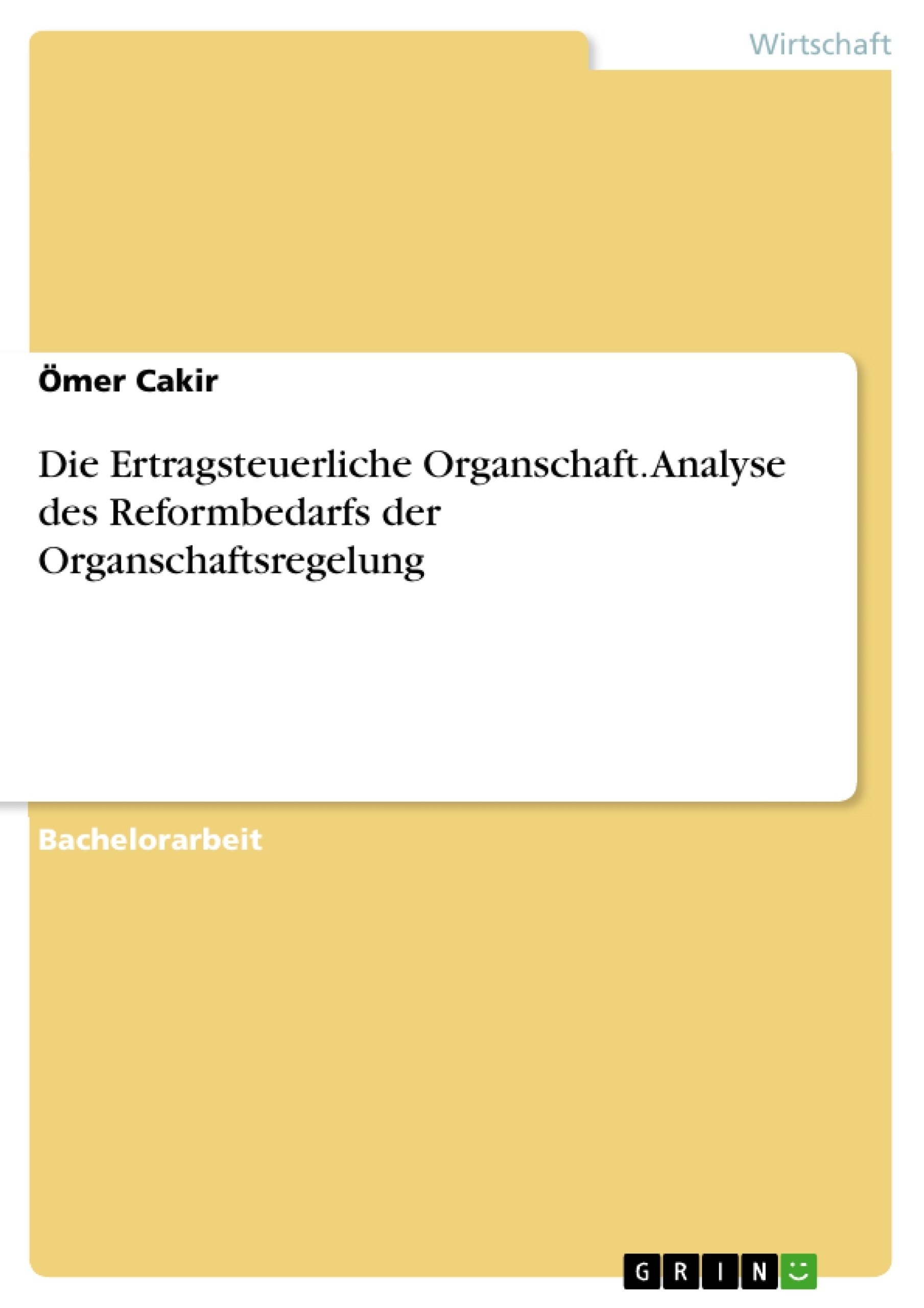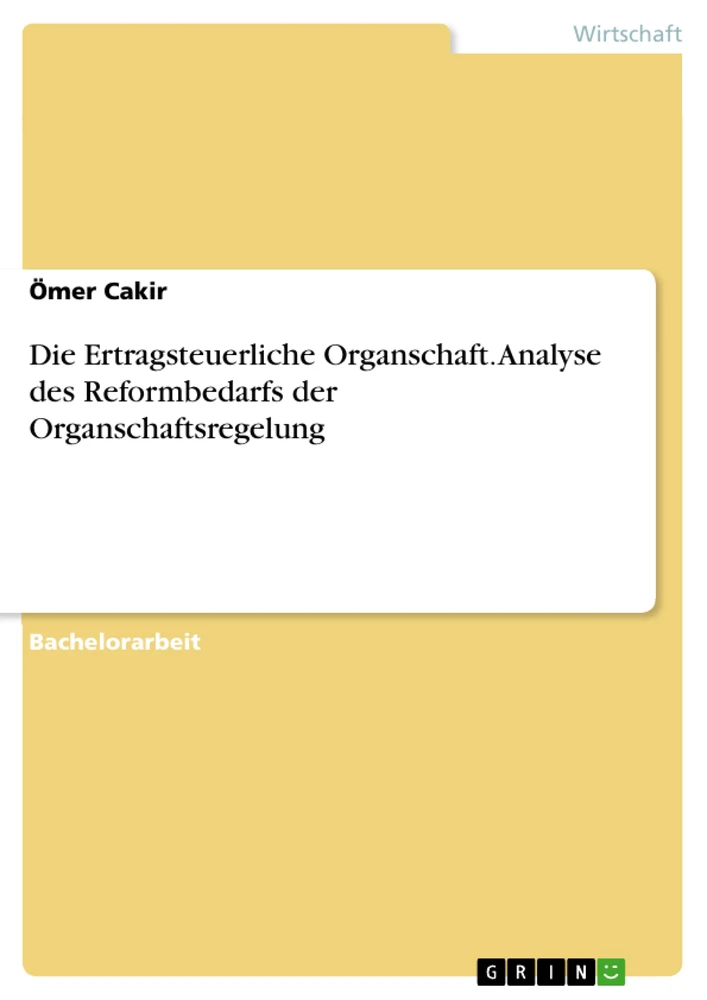
Die Ertragsteuerliche Organschaft. Analyse des Reformbedarfs der Organschaftsregelung
Bachelorarbeit, 2021
57 Seiten, Note: 2,0
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einführung
- 2 Gang der Arbeit
- 3 Anforderung an eine ertragsteuerliche Organschaft
- 3.1 Überblick
- 3.2 Organgesellschaft
- 3.3 Organträger
- 3.4 Gewinnabführungsvertrag
- 3.5 Finanzielle Eingliederung
- 3.6 Betriebsstättenzurechnung
- 4 Körperschaftssteuerliche Rechtsfolgen
- 4.1 Einkommensermittlung
- 4.1.1 Einkommensermittlung nach den allgemeinen Vorschriften
- 4.1.2 Besonderheiten bei der Einkommensermittlung
- 4.2 Mehr- bzw. Minderabführung und Ausgleichsposten
- 4.3 Ausgleichszahlungen
- 4.1 Einkommensermittlung
- 5 Gründe und Rechtsfolgen einer verunglückten Organschaft
- 6 Vor- und Nachteile der Organschaft
- 7 Gewerbesteuerliche Organschaft
- 7.1 Voraussetzungen
- 7.2 Rechtsfolgen
- 8 Mängel der Organschaft, Reformbemühungen und Reformbedarf
- 8.1 Überblick
- 8.2 Mögliche Unionswidrigkeiten der Organschaftsregelung
- 8.3 Gewinnabführungsvertrag
- 8.4 Mehr- und Minderabführung
- 9 Reformvorschläge
- 9.1 Reformvorschlag des Instituts Finanzen und Steuern e. V.
- 9.2 Reformvorschlag des Bundeslandes Hessen
- 9.3 Bewertung der beiden Reformvorschläge durch das BMF
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die ertragsteuerliche Organschaft. Ziel ist es, die Anforderungen an eine Organschaft, die körperschaftssteuerlichen Rechtsfolgen, sowie die Vor- und Nachteile zu beleuchten. Die Arbeit analysiert außerdem die Problematiken bestehender Regelungen und diskutiert aktuelle Reformvorschläge.
- Anforderungen an eine ertragsteuerliche Organschaft
- Körperschaftssteuerliche Rechtsfolgen der Organschaft
- Vor- und Nachteile der Organschaftsbesteuerung
- Mängel der Organschaftsregelung und Reformbedarf
- Bewertung aktueller Reformvorschläge
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einführung: Dieses Kapitel führt in das Thema der ertragsteuerlichen Organschaft ein und beschreibt den Aufbau der Arbeit. Es skizziert die Relevanz des Themas im Kontext des deutschen Steuerrechts und die Forschungsfragen, die im weiteren Verlauf der Arbeit behandelt werden.
2 Gang der Arbeit: Das Kapitel erläutert die Methodik und den methodischen Ablauf der Arbeit. Es beschreibt, welche Forschungsmethoden angewendet wurden und wie die Arbeit strukturiert ist, um dem Leser einen klaren Überblick über den Forschungsweg zu geben.
3 Anforderung an eine ertragsteuerliche Organschaft: Dieser Abschnitt definiert die zentralen Kriterien, die erfüllt sein müssen, damit eine ertragsteuerliche Organschaft anerkannt wird. Es werden die Begriffe Organgesellschaft und Organträger detailliert erklärt, und die Rolle des Gewinnabführungsvertrags sowie die Bedeutung der finanziellen Eingliederung und der Betriebsstättenzurechnung werden eingehend analysiert. Die verschiedenen Aspekte werden anhand konkreter Beispiele aus der Praxis verdeutlicht, um die Anwendung der Kriterien nachvollziehbar zu machen.
4 Körperschaftssteuerliche Rechtsfolgen: Dieses Kapitel befasst sich mit den steuerlichen Konsequenzen, die sich aus der Anerkennung einer Organschaft ergeben. Die Einkommensermittlung sowohl für den Organträger als auch für die Organgesellschaft wird detailliert beschrieben, wobei die Unterschiede zur normalen Einkommensermittlung hervorgehoben werden. Die Behandlung von Mehr- und Minderabführungen sowie die damit verbundenen Ausgleichszahlungen werden umfassend erläutert. Die komplexen Zusammenhänge werden durch Tabellen und Beispiele veranschaulicht.
5 Gründe und Rechtsfolgen einer verunglückten Organschaft: Hier werden die Ursachen und Auswirkungen einer nicht ordnungsgemäß funktionierenden Organschaft beleuchtet. Mögliche Gründe für das Scheitern einer Organschaft werden analysiert und die resultierenden steuerlichen und rechtlichen Folgen für die beteiligten Unternehmen werden dargelegt. Das Kapitel zeigt die Bedeutung einer sorgfältigen Gestaltung und Verwaltung der Organschaft auf.
6 Vor- und Nachteile der Organschaft: Dieses Kapitel bietet eine umfassende Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile einer Organschaftsbesteuerung. Es werden sowohl die positiven Aspekte, wie z.B. die Vereinfachung der Steuerverwaltung, als auch die potenziellen Nachteile, wie z.B. die Risiken im Falle einer verunglückten Organschaft, ausführlich diskutiert. Die Analyse hilft dem Leser bei der Abwägung, ob eine Organschaft in einem konkreten Fall sinnvoll ist.
7 Gewerbesteuerliche Organschaft: Das Kapitel erweitert den Fokus auf die gewerbesteuerlichen Aspekte einer Organschaft. Es beschreibt die spezifischen Voraussetzungen für eine gewerbesteuerliche Organschaft und die daraus resultierenden Rechtsfolgen. Der Zusammenhang zur ertragsteuerlichen Organschaft wird herausgearbeitet und die Besonderheiten des Gewerbesteuerrechts im Kontext der Organschaft werden erläutert.
8 Mängel der Organschaft, Reformbemühungen und Reformbedarf: Dieses Kapitel analysiert kritisch die bestehenden Regelungen zur Organschaft und identifiziert Schwachstellen und Mängel. Es werden mögliche unionsrechtliche Probleme erörtert und aktuelle Reformvorschläge aus der Praxis und von verschiedenen Institutionen präsentiert. Die Kapitel beleuchtet die Notwendigkeit von Anpassungen im bestehenden System und diskutiert die Herausforderungen bei der Umsetzung von Reformen.
Schlüsselwörter
Ertragsteuerliche Organschaft, Organgesellschaft, Organträger, Gewinnabführungsvertrag, Finanzielle Eingliederung, Betriebsstättenzurechnung, Körperschaftssteuer, Einkommensermittlung, Mehr- und Minderabführung, Ausgleichszahlungen, Gewerbesteuerliche Organschaft, Reformvorschläge, Unionsrecht.
Häufig gestellte Fragen zur Bachelorarbeit: Ertragsteuerliche Organschaft
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Die Bachelorarbeit befasst sich umfassend mit der ertragsteuerlichen Organschaft im deutschen Steuerrecht. Sie untersucht die Anforderungen an eine Organschaft, die körperschaftssteuerlichen Rechtsfolgen, sowie die Vor- und Nachteile. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Analyse bestehender Probleme und der Diskussion aktueller Reformvorschläge.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Anforderungen an eine ertragsteuerliche Organschaft (Organgesellschaft, Organträger, Gewinnabführungsvertrag, finanzielle Eingliederung, Betriebsstättenzurechnung); körperschaftssteuerliche Rechtsfolgen (Einkommensermittlung, Mehr- und Minderabführungen, Ausgleichszahlungen); Vor- und Nachteile der Organschaftsbesteuerung; Mängel der Organschaftsregelung und Reformbedarf; Bewertung aktueller Reformvorschläge (u.a. vom Institut Finanzen und Steuern e. V. und dem Bundesland Hessen).
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in neun Kapitel: Einführung, Gang der Arbeit, Anforderungen an eine ertragsteuerliche Organschaft, Körperschaftssteuerliche Rechtsfolgen, Gründe und Rechtsfolgen einer verunglückten Organschaft, Vor- und Nachteile der Organschaft, Gewerbesteuerliche Organschaft, Mängel der Organschaft, Reformbemühungen und Reformbedarf, Reformvorschläge. Jedes Kapitel bietet eine detaillierte Analyse des jeweiligen Themas.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit folgt einer klaren Struktur. Nach der Einleitung und der Beschreibung des methodischen Vorgehens werden die Anforderungen an eine Organschaft definiert. Es folgen die körperschaftssteuerlichen Folgen, eine Betrachtung der Problematik verunglückter Organschaften und eine Gegenüberstellung von Vor- und Nachteilen. Die gewerbesteuerlichen Aspekte werden ebenfalls behandelt, bevor die Arbeit kritisch die Mängel der bestehenden Regelung und aktuelle Reformvorschläge diskutiert.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant für das Verständnis der Arbeit?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Ertragsteuerliche Organschaft, Organgesellschaft, Organträger, Gewinnabführungsvertrag, Finanzielle Eingliederung, Betriebsstättenzurechnung, Körperschaftssteuer, Einkommensermittlung, Mehr- und Minderabführung, Ausgleichszahlungen, Gewerbesteuerliche Organschaft, Reformvorschläge, Unionsrecht.
Werden konkrete Beispiele und Fallstudien verwendet?
Die Arbeit verwendet konkrete Beispiele aus der Praxis, um die Anwendung der Kriterien für eine ertragsteuerliche Organschaft nachvollziehbar zu machen und die komplexen Zusammenhänge im Bereich der Einkommensermittlung und der Mehr-/Minderabführungen zu verdeutlichen.
Welche Forschungsmethoden wurden angewendet?
Das Kapitel "Gang der Arbeit" beschreibt detailliert die angewendeten Forschungsmethoden. Die genaue Methodik wird dort erläutert.
Welche Reformvorschläge werden diskutiert?
Die Arbeit diskutiert verschiedene Reformvorschläge, darunter die Vorschläge des Instituts Finanzen und Steuern e. V. und des Bundeslandes Hessen, sowie die Bewertung dieser Vorschläge durch das Bundesministerium der Finanzen (BMF).
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit zieht Schlussfolgerungen zu den Mängeln der bestehenden Regelung der ertragsteuerlichen Organschaft und bewertet die diskutierten Reformvorschläge hinsichtlich ihrer Eignung zur Verbesserung des bestehenden Systems. Die konkreten Schlussfolgerungen sind im letzten Kapitel zusammengefasst.
Details
- Titel
- Die Ertragsteuerliche Organschaft. Analyse des Reformbedarfs der Organschaftsregelung
- Hochschule
- Hochschule Heilbronn Technik Wirtschaft Informatik
- Note
- 2,0
- Autor
- Ömer Cakir (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2021
- Seiten
- 57
- Katalognummer
- V992985
- ISBN (eBook)
- 9783346367112
- ISBN (Buch)
- 9783346367129
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Organgesellschaft Organträger Steuer Ertragsteuer Organschaft Gewinnabführungsvertrag Finanzielle Eingliederung
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 19,99
- Preis (Book)
- US$ 28,99
- Arbeit zitieren
- Ömer Cakir (Autor:in), 2021, Die Ertragsteuerliche Organschaft. Analyse des Reformbedarfs der Organschaftsregelung, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/992985
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-