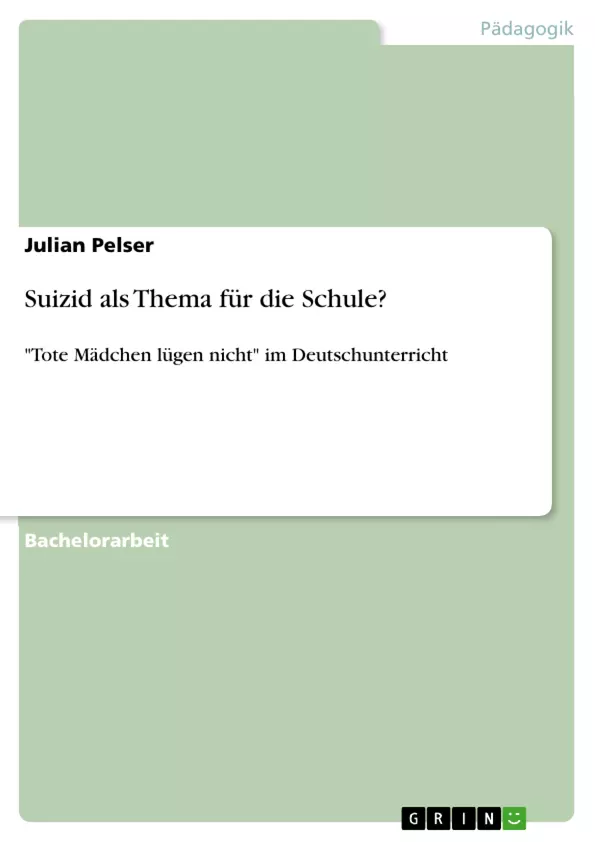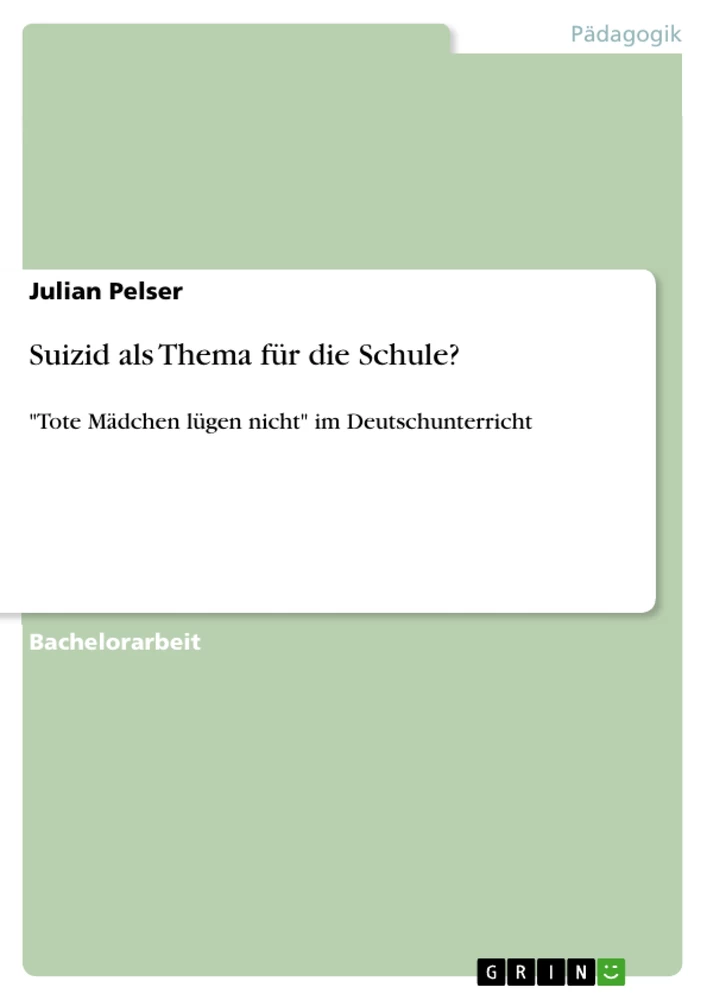
Suizid als Thema für die Schule?
Bachelorarbeit, 2018
47 Seiten, Note: 1,3
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Suizid und Suizidalität
- Eine Begriffsbestimmung
- Suizid bei Jugendlichen und Geschlechterunterschiede
- Suizidmethoden – ,harte' und ,weiche'
- Suizidversuch
- Suizidankündigung
- Medienwirkung und die Angst vor Nachahmung
- Suizid als Thema in der Schule?
- Richtlinien für die Auseinandersetzung
- Suizid als Thema im Deutschunterricht?
- Tote Mädchen lügen nicht – Ein Jugendroman
- Die Bedeutung der Gerüchte
- Angeführte Suizidgründe
- Vom Suizidgedanken zum Suizid
- Die Wertung des Suizids
- Die Warnsignale suizidaler Personen
- Das Scheitern Mr. Porters
- Tote Mädchen lügen nicht – Ein Jugendroman für den Deutschunterricht?
- Filme und Serien im Deutschunterricht
- Tote Mädchen lügen nicht – Eine Netflix-Serie
- Die Serie im Pressespiegel
- Mobbing und soziale Isolation als Suizidgrund
- Vertuschung der Suizidgründe
- Die Abwertung der Suizidgründe
- Warnsignale und Hilfegesuche
- Banalisierung und inflationärer Gebrauch des Suizidbegriffs
- Von der weichen zur harten Methode - Die Explizitheit des Suizids
- Die Serie im Unterricht
- Rückschlüsse für die Verwendung des Jugendromans
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Relevanz des Themas Suizid im Schulunterricht und diskutiert die Verwendung des Jugendromans „Tote Mädchen lügen nicht“ sowie der gleichnamigen Netflix-Serie im Deutschunterricht. Ziel ist es aufzuzeigen, dass Suizid, als ein im Leben von Schülern präsentes Thema, auch in der Schule thematisiert werden muss, ohne dabei eine suizidale Handlung auszulösen.
- Der Begriff „Suizidalität“ und seine verschiedenen Facetten
- Suizidraten bei Jugendlichen in Deutschland und Geschlechterunterschiede
- Medienwirkung und die Gefahr der Nachahmung
- Suizid als Thema im Deutschunterricht und seine Einbindung in den Lehrplan
- Analyse des Jugendromans „Tote Mädchen lügen nicht“ und der Netflix-Serie in Bezug auf Suiziddarstellung und Prävention
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik ein und skizziert die Zielsetzung der Arbeit. In Kapitel 2 wird der Begriff „Suizidalität“ erläutert und die verschiedenen Bezeichnungen für Suizid diskutiert. Es werden statistische Daten zu Suizidraten bei Jugendlichen in Deutschland vorgestellt und Geschlechterunterschiede im Suizidverhalten beleuchtet. Kapitel 3 thematisiert die Medienwirkung und die Gefahr der Nachahmung von Suizidhandlungen. In Kapitel 4 wird die Relevanz von Suizid als Thema im Schulunterricht erörtert und die Möglichkeiten einer unterrichtlichen Auseinandersetzung mit dem Thema, unter Berücksichtigung der curricularen Vorgaben, beleuchtet. Kapitel 5 untersucht den Jugendroman „Tote Mädchen lügen nicht“ und analysiert die Bedeutung der Gerüchte, die angedeuteten Suizidgründe und die Wertung des Suizids. Kapitel 6 diskutiert die Verwendbarkeit des Jugendromans im Deutschunterricht. Kapitel 7 befasst sich mit dem Einsatz von Filmen und Serien im Deutschunterricht, bevor Kapitel 8 die Netflix-Serie „Tote Mädchen lügen nicht“ näher betrachtet. In diesem Kapitel werden die mediale Resonanz, die Unterschiede zur Buchvorlage, die Darstellung von Mobbing und Vertuschung, sowie die Gefahr der Banalisierung des Suizids diskutiert. Schlussendlich werden in Kapitel 9 Rückschlüsse für die Verwendung des Jugendromans gezogen und die Prävention, auch des Buches vor der Serie, hinterfragt.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen dieser Arbeit sind Suizid, Suizidalität, Suizidprävention, Jugendroman, Netflix-Serie, Deutschunterricht, Medienwirkung, Mobbing, soziale Isolation, Banalisierung, und die Wertung des Suizids.
Häufig gestellte Fragen
Sollte das Thema Suizid in der Schule behandelt werden?
Ja, da Suizid in der Lebenswelt von Jugendlichen präsent ist. Eine sachliche Auseinandersetzung im Unterricht kann zur Prävention beitragen und Warnsignale entmystifizieren, ohne Suizidhandlungen auszulösen.
Was ist der Werther-Effekt und der Papageno-Effekt?
Der Werther-Effekt beschreibt die Gefahr von Nachahmungstaten durch mediale Berichterstattung. Der Papageno-Effekt bezeichnet hingegen die präventive Wirkung, wenn über Bewältigungsstrategien in Krisen berichtet wird.
Eignet sich „Tote Mädchen lügen nicht“ für den Deutschunterricht?
Der Roman bietet viele Anknüpfungspunkte für Themen wie Mobbing und soziale Isolation. Experten raten jedoch zur Vorsicht bei der Netflix-Serie, da diese den Suizid sehr explizit und teilweise verherrlichend darstellt.
Was sind Warnsignale für Suizidalität bei Jugendlichen?
Dazu gehören sozialer Rückzug, drastische Verhaltensänderungen, das Verschenken von geliebten Gegenständen, verbale Ankündigungen oder die Beschäftigung mit dem Tod in Aufsätzen oder Zeichnungen.
Wie können Lehrer das Thema Suizid sicher im Unterricht behandeln?
Indem sie klare Richtlinien befolgen: Keine Details zu Methoden nennen, Hilfsangebote (Telefonseelsorge) immer miterwähnen und das Thema in einen Kontext von Resilienz und Problemlösung einbetten.
Details
- Titel
- Suizid als Thema für die Schule?
- Untertitel
- "Tote Mädchen lügen nicht" im Deutschunterricht
- Hochschule
- Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover
- Note
- 1,3
- Autor
- Julian Pelser (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2018
- Seiten
- 47
- Katalognummer
- V998008
- ISBN (eBook)
- 9783346370358
- ISBN (Buch)
- 9783346370365
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Suizid Mobbing Deutschunterricht Netflix Serie Jugendliteratur Tote Mädchen lügen nicht Tote Mädchen lügen nicht Jay Asher
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 19,99
- Preis (Book)
- US$ 29,99
- Arbeit zitieren
- Julian Pelser (Autor:in), 2018, Suizid als Thema für die Schule?, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/998008
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-