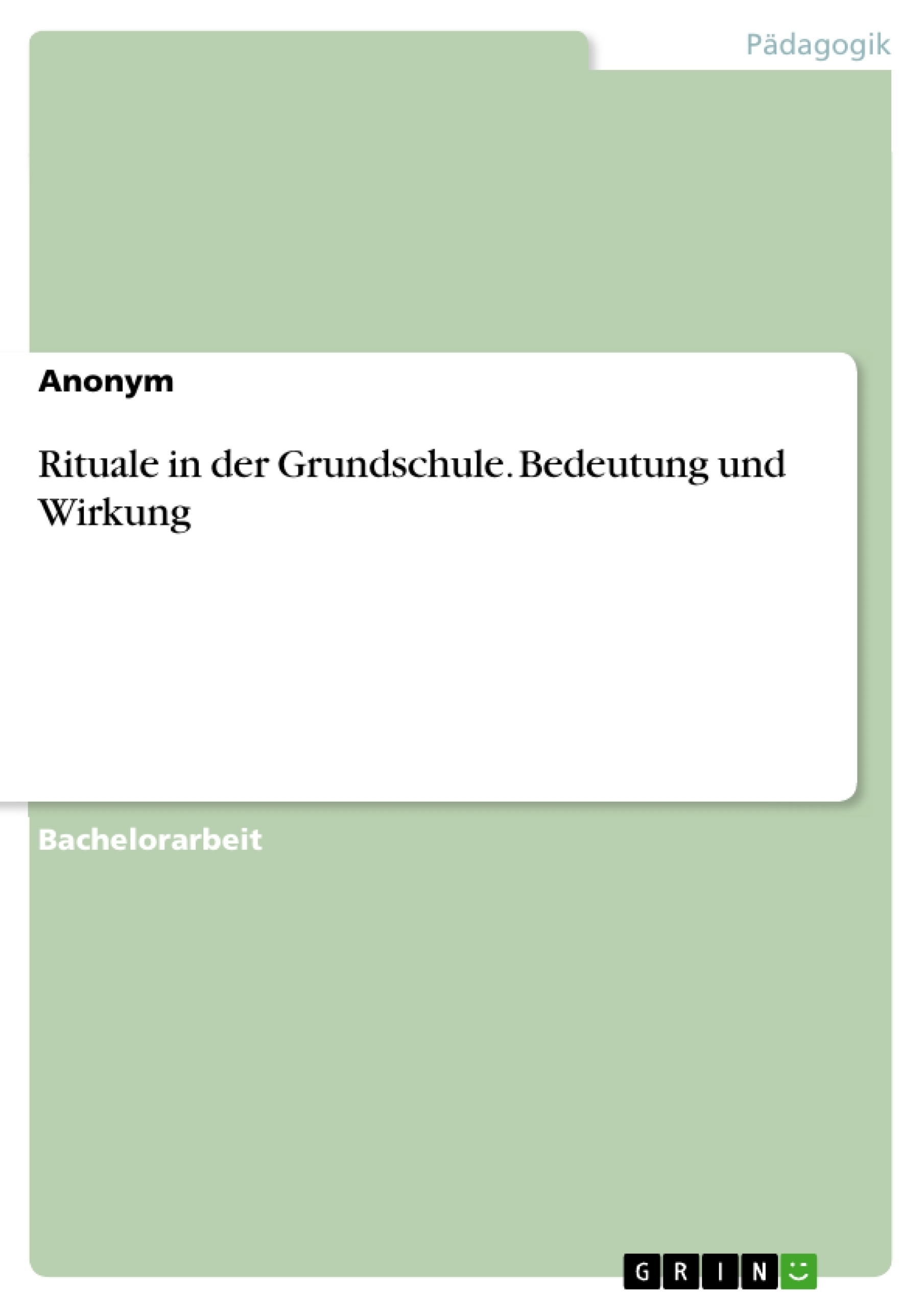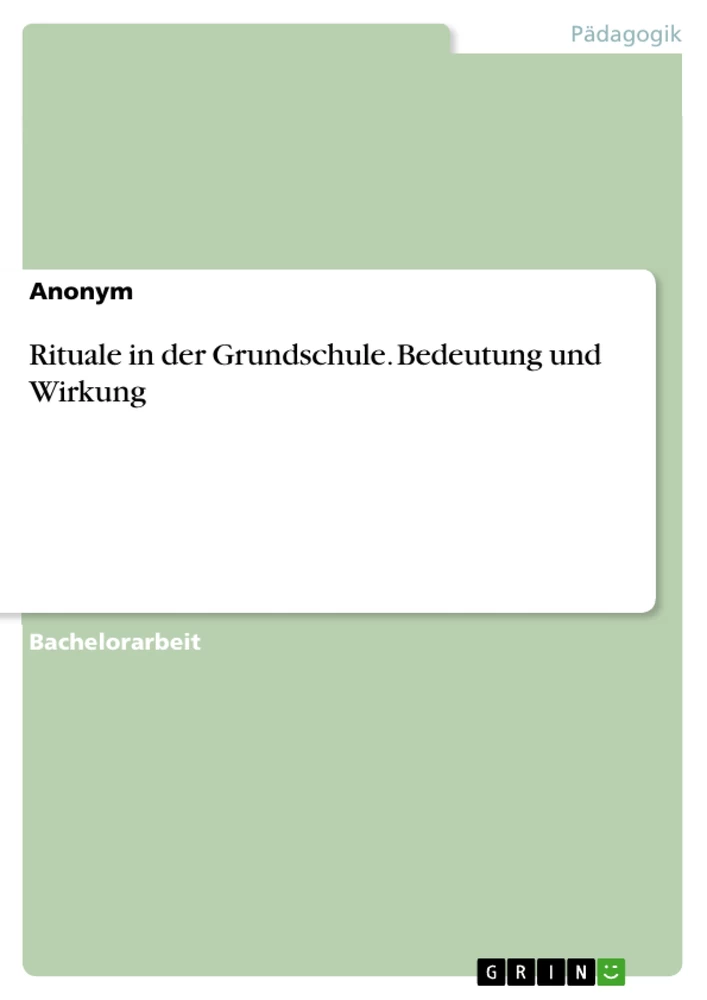
Rituale in der Grundschule. Bedeutung und Wirkung
Bachelorarbeit, 2013
23 Seiten, Note: 2,3
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- 1. EINLEITUNG
- 2. ALLGEMEINE BETRACHTUNGEN ZU RITUALEN IN DER GRUNDSCHULE- SCHULISCHE RITUALE (VERSUCH EINER BEGRIFFSKLÄRUNG)
- 2.1 FUNKTIONEN VON RITUALEN
- 2.2 WIRKUNGSMÖGLICHKEITEN VON SCHULISCHEN RITUALEN
- 3. DIE BESONDERHEITEN DER ERSTKLÄSSLER UND WARUM RITUALE BESONDERS IN DIESER KLASSENSTUFE EINE BESONDERE ROLLE SPIELEN
- 4. DIE WIRKUNG AUSGEWÄHLTER RITUALE
- 4.1 DAS FREIE ARBEITSHEFT
- 4.1.1 INTERVIEW MIT DER KLASSENLEHRERIN ZUM RITUAL DES FREIEN HEFTES
- 4.2 MONTAGMORGENKREIS MIT MUSIKBEGLEITUNG
- 4.3 STUNDENANFANGSRITUAL- RITUAL DES TAGESSTRUKTURPLANS
- 5. SCHLUSSBETRACHTUNG
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Bedeutung und Wirkung von Ritualen in einer ersten Klasse der Grundschule. Ziel ist es, die Funktionen von Ritualen zu klären und ihre sinnvolle Integration in den Schulalltag zu beleuchten. Dabei werden theoretische Überlegungen mit praktischen Beobachtungen aus einer Hospitation kombiniert.
- Die Funktionen von Ritualen in der Grundschule
- Die spezifische Bedeutung von Ritualen für Erstklässler
- Die Wirkung ausgewählter Rituale im Unterricht
- Die Vermittlung von Werten durch Rituale (z.B. Sicherheit, Verantwortung)
- Die Verbindung von theoretischen Erkenntnissen mit praktischen Beobachtungen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung betont die Bedeutung von Sicherheit und Vertrauensbasis für Erstklässler. Sie führt das Thema Rituale als vertrauensbildende Maßnahme ein, die Orientierung im Schulalltag bietet und ein positives Schulerlebnis fördert. Die Arbeit kündigt die Untersuchung der Bedeutung und Wirkung von Ritualen in einer ersten Klasse an, verbindet theoretische Analyse mit praktischen Beobachtungen aus einer Hospitation und integriertem Schulpraktikum. Der Fokus liegt auf der Darstellung der Funktionen von Ritualen und ihrer positiven Auswirkungen auf die Entwicklung der Kinder.
2. Allgemeine Betrachtungen zu Ritualen in der Grundschule- Schulische Rituale (Versuch einer Begriffsklärung): Dieses Kapitel beleuchtet die allgemeine Bedeutung und Funktion von Ritualen in der Grundschule. Es wird auf die Strukturgebung und Regulation des täglichen Zusammenlebens eingegangen, die durch Rituale geschaffen wird. Der Fokus liegt auf der Schaffung einer Balance zwischen Ordnung und individueller Freiheit. Die positive Wirkung von Ritualen auf das Wohlbefinden der Kinder und ihre Wahrnehmung der Schule als lebensbejahenden Ort wird hervorgehoben.
3. Die Besonderheiten der Erstklässler und warum Rituale besonders in dieser Klassenstufe eine besondere Rolle spielen: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die spezifischen Herausforderungen und Bedürfnisse von Erstklässlern. Es betont, wie die Neuheit der Schulumgebung, das Zusammensein mit vielen unbekannten Kindern und der Umgang mit Gruppensituationen zu Problemen führen können. Der Text argumentiert, warum Rituale in dieser Phase besonders wichtig sind, um Sicherheit, Orientierung und positive soziale Interaktionen zu gewährleisten. Die besondere Anfälligkeit von Erstklässlern für störende Verhaltensweisen und deren Rückzug wird als Argument für den Einsatz von Ritualen angeführt.
4. Die Wirkung ausgewählter Rituale: Dieses Kapitel analysiert die Wirkung spezifischer Rituale, wie z.B. das freie Arbeitsheft, den Montagmorgenkreis und das Stundenanfangsritual. Für jedes Ritual wird im Detail auf seine Durchführung und seine positive Wirkung auf die Kinder eingegangen. Die Kapitel untersuchen die praktische Anwendung und die dabei gemachten Beobachtungen. Die theoretischen Überlegungen werden mit den praktischen Erfahrungen aus der Hospitation verbunden.
Schlüsselwörter
Rituale, Grundschule, Erstklässler, Schulalltag, Sicherheit, Orientierung, Vertrauensbildung, pädagogische Mittel, Gruppengefühl, Entwicklung, Verantwortung, Selbstvertrauen.
Häufig gestellte Fragen zur Arbeit: Die Bedeutung von Ritualen in der ersten Klasse der Grundschule
Was ist der Hauptfokus dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Bedeutung und Wirkung von Ritualen in einer ersten Klasse der Grundschule. Sie beleuchtet die Funktionen von Ritualen, ihre sinnvolle Integration in den Schulalltag und verbindet theoretische Überlegungen mit praktischen Beobachtungen aus einer Hospitation.
Welche Ziele werden in dieser Arbeit verfolgt?
Die Zielsetzung ist die Klärung der Funktionen von Ritualen und die Darstellung ihrer positiven Auswirkungen auf die Entwicklung der Kinder. Es soll gezeigt werden, wie Rituale zur Schaffung einer vertrauensvollen Lernatmosphäre und zur Strukturierung des Schulalltags beitragen.
Welche Themen werden im Detail behandelt?
Die Arbeit behandelt die Funktionen von Ritualen in der Grundschule, die spezifische Bedeutung von Ritualen für Erstklässler, die Wirkung ausgewählter Rituale im Unterricht und die Vermittlung von Werten (Sicherheit, Verantwortung) durch Rituale. Die Verbindung von theoretischen Erkenntnissen mit praktischen Beobachtungen ist ein weiterer wichtiger Aspekt.
Welche Rituale werden im Speziellen untersucht?
Die Arbeit analysiert die Wirkung des freien Arbeitsheftes, des Montagmorgenkreises mit Musikbegleitung und des Stundenanfangsrituals (Ritual des Tagesstrukturplans).
Warum sind Rituale besonders wichtig für Erstklässler?
Für Erstklässler ist die neue Schulumgebung, der Umgang mit vielen unbekannten Kindern und Gruppensituationen eine Herausforderung. Rituale bieten Sicherheit, Orientierung und fördern positive soziale Interaktionen. Sie helfen, störende Verhaltensweisen zu reduzieren und ein positives Schulerlebnis zu gewährleisten.
Wie werden die theoretischen Überlegungen mit der Praxis verbunden?
Die Arbeit kombiniert theoretische Analysen mit praktischen Beobachtungen aus einer Hospitation und einem integrierten Schulpraktikum. Die Kapitel zur Wirkung ausgewählter Rituale verbinden die theoretischen Überlegungen mit den praktischen Erfahrungen aus der Hospitation.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Arbeit zeigt die positive Wirkung von Ritualen auf das Wohlbefinden der Kinder und ihre Wahrnehmung der Schule als lebensbejahenden Ort. Sie unterstreicht die Bedeutung von Ritualen für die Schaffung einer Balance zwischen Ordnung und individueller Freiheit und für die Entwicklung von Sicherheit, Orientierung und Selbstvertrauen bei Erstklässlern.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Rituale, Grundschule, Erstklässler, Schulalltag, Sicherheit, Orientierung, Vertrauensbildung, pädagogische Mittel, Gruppengefühl, Entwicklung, Verantwortung, Selbstvertrauen.
Welche Kapitel enthält die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, Kapitel zu allgemeinen Betrachtungen zu Ritualen in der Grundschule, die Besonderheiten der Erstklässler und die Wirkung ausgewählter Rituale, sowie eine Schlussbetrachtung. Jedes Kapitel enthält detaillierte Informationen zu den jeweiligen Themen.
Details
- Titel
- Rituale in der Grundschule. Bedeutung und Wirkung
- Hochschule
- Universität Hamburg
- Note
- 2,3
- Autor
- Anonym (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2013
- Seiten
- 23
- Katalognummer
- V1043368
- ISBN (eBook)
- 9783346471666
- ISBN (Buch)
- 9783346471673
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- rituale grundschule bedeutung wirkung
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 16,99
- Preis (Book)
- US$ 18,99
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2013, Rituale in der Grundschule. Bedeutung und Wirkung, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/1043368
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-