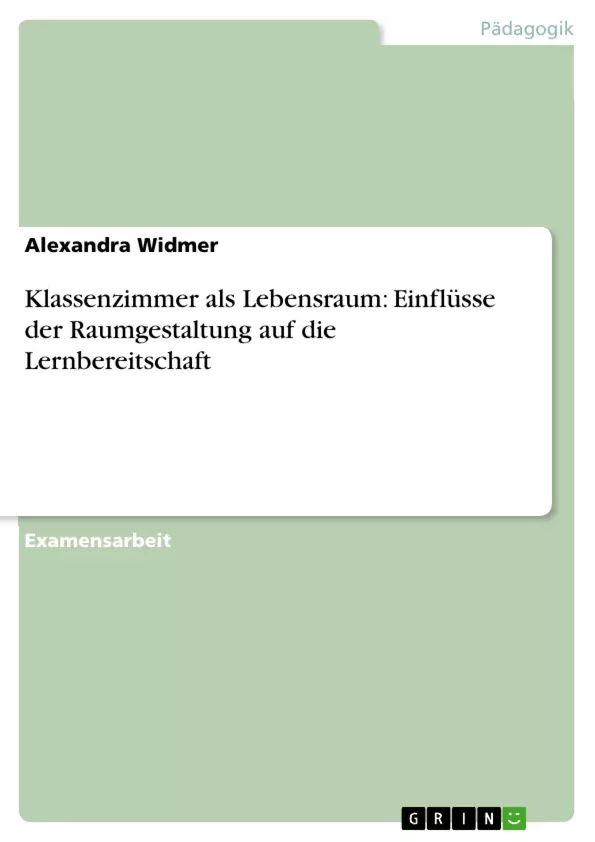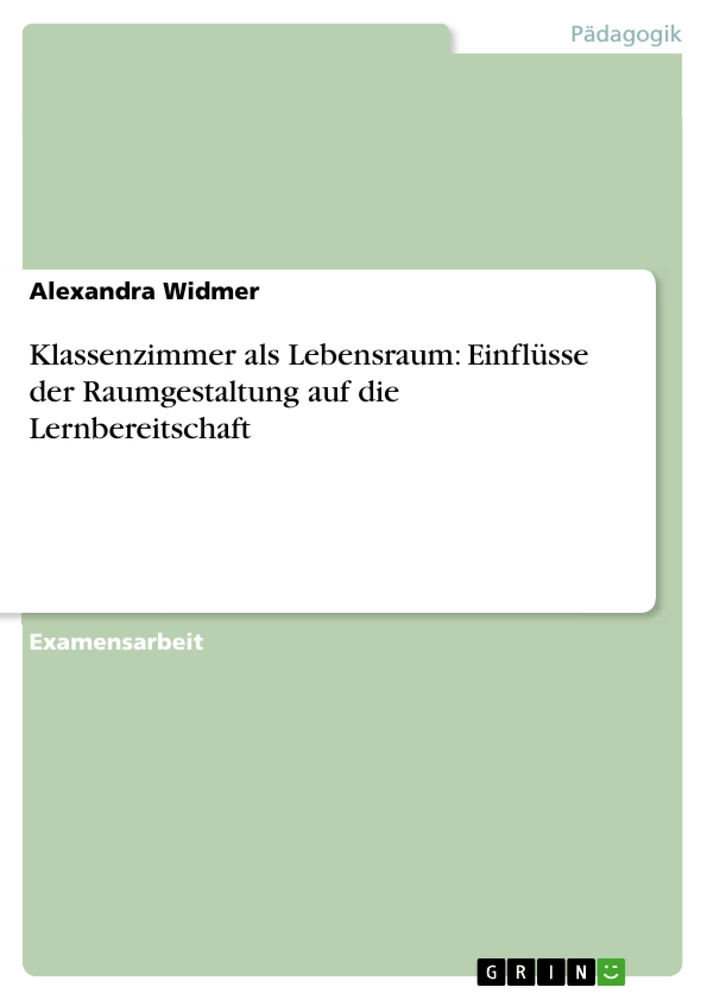
Klassenzimmer als Lebensraum: Einflüsse der Raumgestaltung auf die Lernbereitschaft
Examensarbeit, 2006
115 Seiten
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Einleitung
- Der (Lebens)raum
- Der Raum
- Der „gelebte“ Raum
- Kinder und ihr Lebensraum
- Veränderungen im Leben der Kinder
- Der Raum
- Der Klassenraum als Lernfaktor
- Das Klassenzimmer
- Das Klassenzimmer als Lernumgebung
- Die „Lernumgebung“
- Lernumgebung im Klassenzimmer
- Die Lernumgebung bei einigen ausgewählten Reformpädagogen
- Rudolf Steiner (1861 – 1925)
- Maria Montessori (1870 – 1952)
- Peter Petersen (1884 – 1952)
- Celestin Freinet (1896 – 1966)
- Der Raum als Lernfaktor
- Der pädagogische Hintergrund des Lernraumes
- Einflüsse des Klassenraums auf die Schülerinnen
- Das Verhalten
- Die Lernbereitschaft
- Klassenraumgestaltung
- Gestaltung von Grundschulklassenzimmern
- Wichtige Faktoren bei der grundsätzlichen Ausstattung
- Die Größe und die Form
- Die Farbgestaltung
- Das Licht / Die Fenster und die Beleuchtung
- Der Bodenbelag
- Die Tische und die Stühle
- Die Sitzordnung
- Das Raumklima
- Die Akustik
- Die ästhetische Gestaltung
- Die Pflanzen
- Wichtige Faktoren bei der grundsätzlichen Ausstattung
- Interessenvertretungen bei der Klassenraumgestaltung
- Gründe für die großen Unterschiede unter den Klassenzimmern
- Mitgestaltung der Kinder
- Gestaltung von Grundschulklassenzimmern
- Die empirische Studie „Mein Klassenzimmer“
- Vorbereitung der Studie
- Empirische Sozialforschung
- Methoden der empirischen Sozialforschung
- Reaktive Verfahren
- Der Fragebogen
- Die Erstellung des Fragebogens
- Drei idealtypische Phasen im Forschungsablauf
- Entstehungzusammenhang
- Verwendungszusammenhang
- Begründungszusammenhang
- Vorbereitung der Studie
- Auswertung der Studie „Mein Klassenzimmer“
- Mein Klassenzimmer
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Einfluss der Raumgestaltung von Grundschulklassenzimmern auf die Lernbereitschaft der Schüler. Ziel ist es, theoretische Erkenntnisse mit empirischen Daten aus einer Schülerbefragung zu verknüpfen, um ein optimales Klassenraumkonzept zu entwickeln, welches das Wohlbefinden und den Lernerfolg der Kinder fördert.
- Der (Lebens-)Raum als Einflussfaktor auf die Psyche und das Verhalten von Kindern
- Der Klassenraum als Lernumgebung: Gestaltungsmerkmale und deren Wirkung
- Vergleich verschiedener pädagogischer Ansätze zur Raumgestaltung
- Empirische Untersuchung der Schülerwünsche und -erfahrungen bezüglich ihrer Klassenzimmer
- Entwicklung eines optimierten Klassenraumkonzeptes basierend auf Theorie und Empirie
Zusammenfassung der Kapitel
Vorwort: Die Arbeit entstand aus dem persönlichen Interesse der Autorin an der Lernumgebung und Klassenraumgestaltung, basierend auf eigenen Erfahrungen in Schulen und Praktika. Ein beobachteter Widerspruch zwischen der Bedeutung der Raumgestaltung für das Lernen und deren Unterdrückung in manchen Schulen motivierte die Autorin zu dieser Untersuchung. Die Arbeit kombiniert theoretische Überlegungen mit einer empirischen Studie, die die Wünsche und Erfahrungen von Grundschulkindern zu ihren Klassenzimmern erfasst.
Einleitung: Die Einleitung unterstreicht die Bedeutung des Klassenzimmers als Lebensraum für Grundschulkinder, die dort einen Großteil ihres Tages verbringen. Sie kritisiert den oft bestehenden Widerspruch zwischen dem Anspruch moderner Pädagogik auf angenehme Lernatmosphäre und der oft unzureichenden Raumgestaltung. Die Autorin betont die Notwendigkeit, die Lernumgebung aktiv mitzugestalten und an die Bedürfnisse der Kinder anzupassen.
Der (Lebens)raum: Dieses Kapitel erörtert den Raum im Allgemeinen und dessen Einfluss auf das menschliche Wohlbefinden. Es werden verschiedene Perspektiven (erkenntnistheoretisch, verhaltenstheoretisch, psychotherapeutisch, psychosomatisch, sozialpsychologisch) vorgestellt, um die Bedeutung des Raumes für die kindliche Entwicklung zu belegen. Es wird betont, dass Räume nicht neutral sind und eine aktive Gestaltung erforderlich ist.
Der Klassenraum als Lernfaktor: Dieses Kapitel definiert den Klassenraum als primären Lern- und Aufenthaltsort von Grundschulklassen. Es werden die Anforderungen an einen kindgerechten Lernraum, die Bedeutung der Lernumgebung und -atmosphäre, sowie die Ansätze verschiedener Reformpädagogen (Steiner, Montessori, Petersen, Freinet) hinsichtlich der Raumgestaltung detailliert erläutert. Die Autorin hebt die Bedeutung des pädagogischen Hintergrundes der Raumgestaltung hervor.
Klassenraumgestaltung: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Gestaltung von Grundschulklassenzimmern. Es werden wichtige Faktoren wie Größe und Form, Farbgestaltung, Lichtverhältnisse, Bodenbelag, Möbel (Tische und Stühle), Sitzordnung, Raumklima, Akustik, ästhetische Gestaltung und die Rolle von Pflanzen ausführlich diskutiert. Die verschiedenen Interessen der an der Raumgestaltung beteiligten Akteure (Schulträger, Eltern, Lehrer, Schüler, Hausmeister, Reinigungskräfte, Schulleitung) werden beleuchtet. Der Einfluss der Mitgestaltung durch die Kinder auf das Wohlbefinden und das Verhalten wird hervorgehoben.
Die empirische Studie „Mein Klassenzimmer“: Dieses Kapitel beschreibt die Vorbereitung und Durchführung einer empirischen Studie mit 312 Grundschulkindern. Es erläutert die Methodik (Fragebogen) und die theoretischen Grundlagen der empirischen Sozialforschung. Der Fragebogen wird detailliert vorgestellt.
Schlüsselwörter
Klassenraumgestaltung, Lernumgebung, Lernbereitschaft, Grundschule, Reformpädagogik, Empirische Sozialforschung, Schülerbefragung, Raumklima, Farbpsychologie, Wohlbefinden, Mitgestaltung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Einfluss der Raumgestaltung von Grundschulklassenzimmern auf die Lernbereitschaft der Schüler
Was ist der Hauptfokus dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht den Einfluss der Raumgestaltung von Grundschulklassenzimmern auf die Lernbereitschaft der Schüler. Sie verbindet theoretische Erkenntnisse mit empirischen Daten einer Schülerbefragung, um ein optimales Klassenraumkonzept zu entwickeln, das Wohlbefinden und Lernerfolg fördert.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt den (Lebens-)Raum als Einflussfaktor auf Kinder, den Klassenraum als Lernumgebung, verschiedene pädagogische Ansätze zur Raumgestaltung (Steiner, Montessori, Petersen, Freinet), eine empirische Untersuchung der Schülerwünsche und -erfahrungen, und die Entwicklung eines optimierten Klassenraumkonzeptes.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit umfasst Kapitel zu: Vorwort, Einleitung, Der (Lebens)raum, Der Klassenraum als Lernfaktor, Klassenraumgestaltung, Die empirische Studie „Mein Klassenzimmer“, Auswertung der Studie „Mein Klassenzimmer“, Mein Klassenzimmer und Fazit. Jedes Kapitel wird detailliert im Inhaltsverzeichnis aufgeführt.
Wie ist die empirische Studie aufgebaut?
Die empirische Studie „Mein Klassenzimmer“ basiert auf einem Fragebogen, der an 312 Grundschulkinder verteilt wurde. Die Methodik stützt sich auf Prinzipien der empirischen Sozialforschung, inklusive reaktiver Verfahren. Die Studie umfasst die Phasen Entstehungzusammenhang, Verwendungszusammenhang und Begründungszusammenhang.
Welche Faktoren der Klassenraumgestaltung werden betrachtet?
Wichtige Faktoren der Klassenraumgestaltung sind Größe und Form des Raumes, Farbgestaltung, Lichtverhältnisse, Bodenbelag, Möbel (Tische und Stühle), Sitzordnung, Raumklima, Akustik, ästhetische Gestaltung und die Rolle von Pflanzen. Die Interessen verschiedener Akteure (Schulträger, Eltern, Lehrer, Schüler etc.) werden ebenfalls berücksichtigt.
Welche Reformpädagogen werden in der Arbeit erwähnt?
Die Arbeit bezieht sich auf die Ansätze von Rudolf Steiner, Maria Montessori, Peter Petersen und Celestin Freinet hinsichtlich der Raumgestaltung und deren Auswirkungen auf das Lernen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Klassenraumgestaltung, Lernumgebung, Lernbereitschaft, Grundschule, Reformpädagogik, Empirische Sozialforschung, Schülerbefragung, Raumklima, Farbpsychologie, Wohlbefinden, Mitgestaltung.
Welche Ziele verfolgt die Autorin mit dieser Arbeit?
Die Autorin verfolgt das Ziel, theoretische Erkenntnisse über den Einfluss der Raumgestaltung auf das Lernen mit empirischen Daten zu verbinden, um ein optimiertes Klassenraumkonzept zu entwickeln, das das Wohlbefinden und den Lernerfolg der Kinder verbessert.
Wie wird der Fragebogen in der Studie eingesetzt?
Der Fragebogen dient als Instrument zur Erfassung der Wünsche und Erfahrungen der Grundschulkinder bezüglich ihrer Klassenzimmer. Seine Erstellung und die damit verbundenen methodischen Überlegungen werden detailliert beschrieben.
Welche Schlussfolgerungen werden in der Arbeit gezogen?
Das Fazit der Arbeit fasst die Ergebnisse der theoretischen Analyse und der empirischen Studie zusammen und gibt Empfehlungen für eine optimale Klassenraumgestaltung, die das Wohlbefinden und die Lernbereitschaft der Kinder fördert. Die konkreten Schlussfolgerungen sind im Kapitel "Fazit" enthalten.
Details
- Titel
- Klassenzimmer als Lebensraum: Einflüsse der Raumgestaltung auf die Lernbereitschaft
- Hochschule
- Pädagogische Hochschule Freiburg im Breisgau
- Autor
- Lehrerin Alexandra Widmer (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2006
- Seiten
- 115
- Katalognummer
- V129225
- ISBN (Buch)
- 9783640431700
- ISBN (eBook)
- 9783640431861
- Dateigröße
- 8394 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Klassenzimmer Lebensraum Einflüsse Raumgestaltung Lernbereitschaft
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 38,99
- Preis (Book)
- US$ 49,99
- Arbeit zitieren
- Lehrerin Alexandra Widmer (Autor:in), 2006, Klassenzimmer als Lebensraum: Einflüsse der Raumgestaltung auf die Lernbereitschaft, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/129225
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-