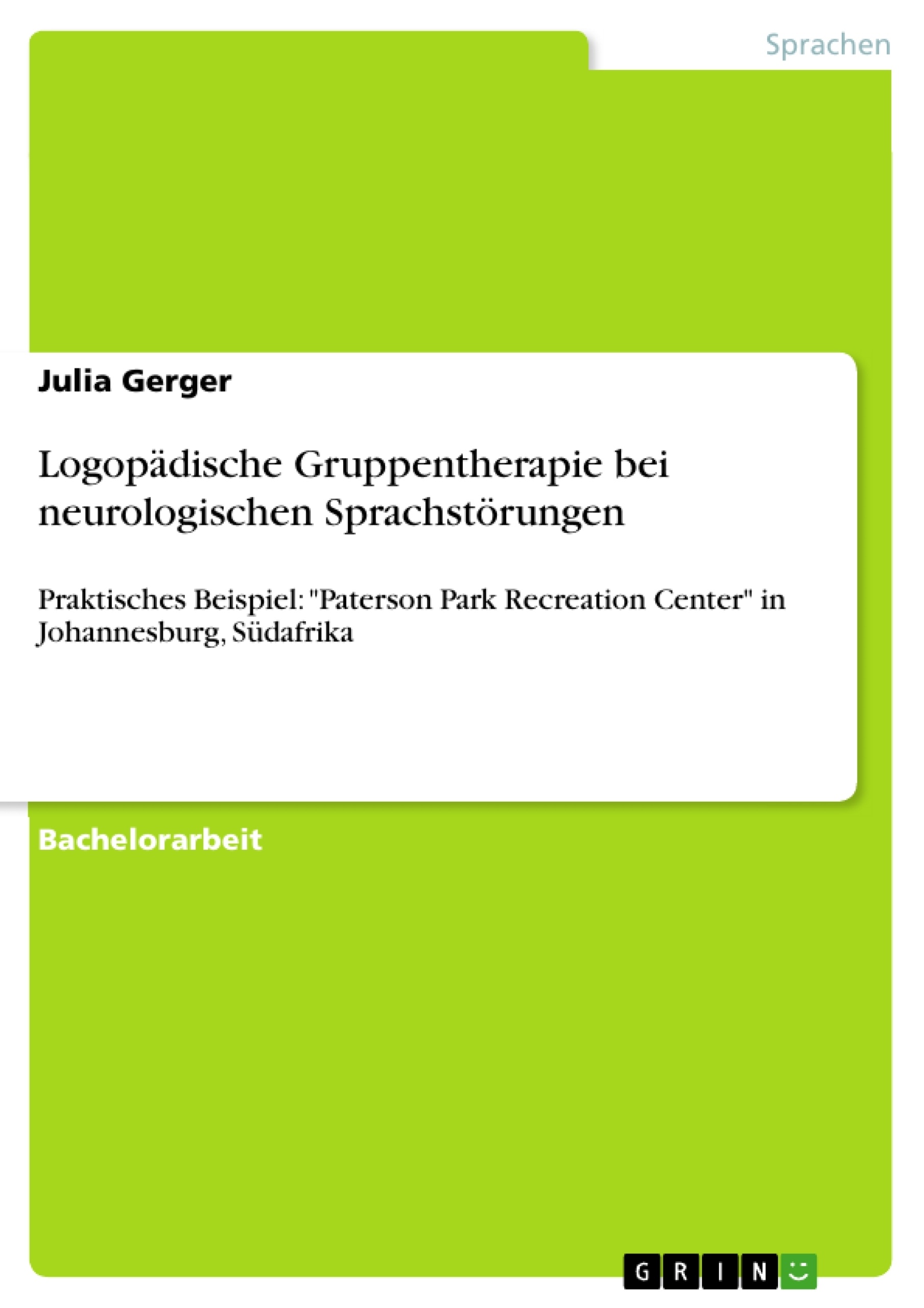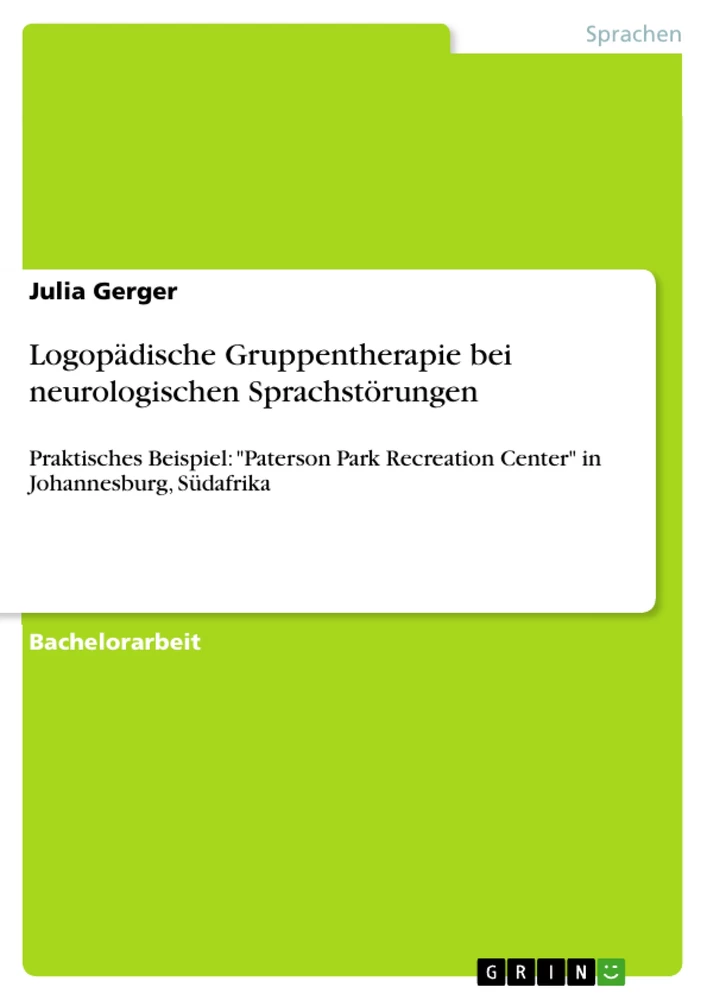
Logopädische Gruppentherapie bei neurologischen Sprachstörungen
Bachelorarbeit, 2010
57 Seiten, Note: Sehr gut
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Forschungsfrage und Hypothesen
3 Erörterung des bisherigen Forschungsstandes
3.1 Die Gruppe
3.1.1 Die Kleingruppe (Primärgruppe)
3.1.2 Gruppendynamik
3.1.3 Kommunikation und Gruppendynamik
3.1.4 Lernen in der Gruppe
3.1.5 Psychosozialer Einfluss einer Gruppe
3.1.6 Evaluierung von Gruppen
3.2 Gruppentherapie bei neurologischer Sprachstörung
3.2.1 WHO Richtlinien
3.2.2 Ziele der Gruppentherapie
3.2.3 Methoden
3.2.4 Strukturmerkmale
3.2.5 Der psychosoziale Aspekt
3.2.6 Abgrenzung von psychotherapeutischen Gruppen sowie von Selbsthilfegruppen
3.2.7 Einzeltherapie vs. Gruppentherapie
3.2.8 Schwierigkeiten der Evaluierbarkeit
3.2.9 Zusammensetzung der Gruppe
4 Darlegen der gewählten Methodik
4.1 Struktur und Setting
4.2 Durchführung
4.3 Material
4.3.1 Video
4.3.2 Code of ethics
4.4 Die Gruppe
4.4.1 Die Teilnehmer - Einheit am 2.März 2010
4.4.2 Die Teilnehmer - Einheit am 16. März 2010
4.4.3 Die Teilnehmer - Einheit am 23. März 2010
4.5 Interview mit Jenny Watermeyer, PhD
5 Ergebnisse der empirischen Studie
5.1 Einheit am 2. März 2010
5.1.1 1.Übung:
5.1.2 Methodisches Verhalten der Therapeutin (Th.):
5.1.3 Kommunikation und Lernen in der Gruppe:
5.1.4 2.Übung:
5.1.5 Methodisches Verhalten der Therapeutin (Th.):
5.1.6 Kommunikation und Lernen in der Gruppe:
5.2 Einheit am 16. März 2010
5.2.1 1.Übung:
5.2.2 Methodisches Verhalten der Therapeutin 2 (Th. 2):
5.2.3 Kommunikation und Lernen in der Gruppe:
5.2.4 2.Übung:
5.2.5 Methodisches Verhalten der Therapeutin (Th.):
5.2.6 Kommunikation und Lernen in der Gruppe:
5.3 Einheit am 23. März 2010
5.3.1 Übung:
5.3.2 Methodisches Verhalten der Therapeutin (Th.):
5.3.3 Kommunikation und Lernen in der Gruppe:
5.4 Zusammenfassung des Interviews mit Jenny Watermeyer, PhD
6 Interpretation und Schlussfolgerungen
7 Literaturliste
8 Anhang
8.1 Consent form
8.2 Interview mit Jenny Watermeyer, PhD am 23. März 2010
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Vorteile von logopädischer Gruppentherapie?
Gruppentherapie fördert den psychosozialen Austausch, ermöglicht das Lernen von Gleichgesinnten und steigert den kommunikativen Output in alltagsnahen Situationen.
Wie unterscheiden sich Einzel- und Gruppentherapie bei Sprachstörungen?
Während die Einzeltherapie auf spezifische Defizite fokussiert, bietet die Gruppe ein Feld für Interaktion, soziale Unterstützung und die Anwendung von Strategien unter Realbedingungen.
Warum wurde für die Studie eine Gruppe in Südafrika gewählt?
Da logopädische Gruppentherapie im europäischen Raum weniger verbreitet ist, bot die Forschung in Johannesburg (Südafrika) wertvolle empirische Daten.
Welche Rolle spielt die Gruppendynamik beim Lernen?
Eine positive Gruppendynamik reduziert die Sprechangst und motiviert Patienten, trotz ihrer neurologischen Sprachstörungen aktiv an der Kommunikation teilzunehmen.
Gibt es WHO-Richtlinien für die logopädische Gruppentherapie?
Ja, die Arbeit bezieht sich auf WHO-Richtlinien, die soziale Teilhabe und Lebensqualität als zentrale Therapieziele bei neurologischen Erkrankungen definieren.
Details
- Titel
- Logopädische Gruppentherapie bei neurologischen Sprachstörungen
- Untertitel
- Praktisches Beispiel: "Paterson Park Recreation Center" in Johannesburg, Südafrika
- Hochschule
- FH Joanneum Graz (Logopädie)
- Note
- Sehr gut
- Autor
- Julia Gerger (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2010
- Seiten
- 57
- Katalognummer
- V153342
- ISBN (eBook)
- 9783640655670
- ISBN (Buch)
- 9783640656332
- Dateigröße
- 756 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Logopädie Aphasie Gruppentherapie
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 20,99
- Preis (Book)
- US$ 29,99
- Arbeit zitieren
- Julia Gerger (Autor:in), 2010, Logopädische Gruppentherapie bei neurologischen Sprachstörungen, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/153342
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-