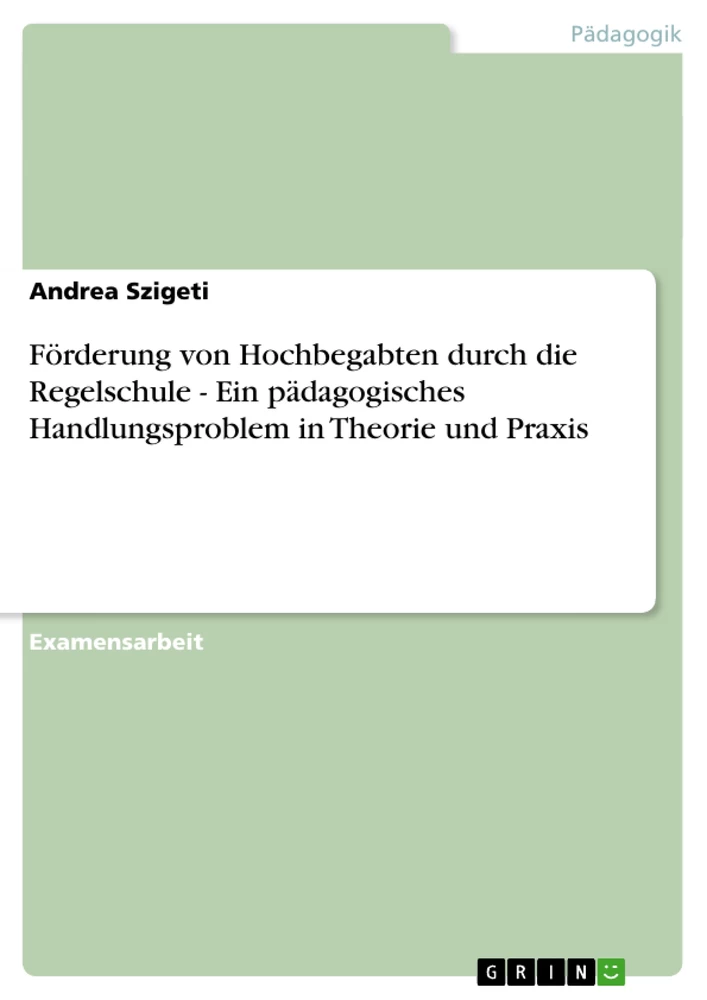
Förderung von Hochbegabten durch die Regelschule - Ein pädagogisches Handlungsproblem in Theorie und Praxis
Examensarbeit, 2006
151 Seiten, Note: 1,0
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zum Begriff Hochbegabung
- Begabung
- Intelligenz
- Kreativität
- Talent
- Definitionsklassen von Hochbegabung
- Die 6 Definitionsklassen von Hochbegabung nach Lucito als Ordnungsschema
- Ex-post-facto-Definition
- Termans IQ-Definition
- Prozentsatzdefinition
- Soziale Definition
- Kreativitätsdefinition
- Definition nach Lucito
- Definition des Marland Reports
- Kritisch-konstruktive Zwischenbetrachtung
- Die 6 Definitionsklassen von Hochbegabung nach Lucito als Ordnungsschema
- Modelle von Hochbegabung
- Das Drei-Ringe-Modell der Hochbegabung (Renzulli)
- Komponentenmodell der Talententwicklung (Wieczerkowski & Wagner)
- Das Triadische Interdependenzmodell der Hochbegabung (Mönks)
- Das mehrdimensionale Begabungskonzept (Urban)
- Das Modell zur Beziehung von Begabung und Leistung (Gagné)
- Das Münchner Multifaktorielle Begabungsmodell (Heller & Hany)
- Kritisch-konstruktive Zwischenbetrachtung
- Identifizierung von Hochbegabung
- Die Notwendigkeit der Identifizierung
- Zeitpunkt der Identifizierung
- Qualität der Identifizierung
- Identifizierungsverfahren
- Formelle Verfahren
- Schulnoten
- Wettbewerbe
- Intelligenztests
- Informelle Verfahren
- Lehrernominierung
- Elternnominierung
- Peernominierung
- Selbstnominierung
- Checklisten
- Formelle Verfahren
- Underachiever
- Kritisch-konstruktive Zwischenbetrachtung
- Sozial- und persönlichkeitspsychologische Aspekte der Hochbegabung
- Familienstruktur hochbegabter Kinder
- Geschlechtsgruppenzugehörigkeit
- Persönlichkeitsmerkmale
- Selbstkonzept
- Kontrollüberzeugung
- Kritisch-konstruktive Zwischenbetrachtung
- Typische Probleme Hochbegabter im schulischen Umfeld
- Unterforderung / Langeweile
- Leistungsverweigerung
- Minderleistungen bei intellektueller Hochbegabung
- Ungenügendes Erlernen von Lern- und Arbeitstechniken
- Soziale Isolation
- Unangemessener Umgang mit Misserfolgen
- Kritisch-konstruktive Zwischenbetrachtung
- Notwendigkeit einer (integrativen) Förderung hochbegabter Schüler
- Förderung als pädagogische Aufgabe
- Förderung als rechtlicher Anspruch
- Förderung als Reduktor von Unterrichtsstörungen
- Förderung als wirtschaftliche Triebfeder
- Förderung als Verwirklichung der Chancengleichheit im Bildungswesen
- Die Bedeutung der Grundschule für die kindliche Entwicklung
- Kritisch-konstruktive Zwischenbetrachtung
- Fördermaßnahmen in der Schule
- Akzeleration
- Frühere Einschulung
- Überspringen von Klassen
- Flexible Schuleingangsphase
- Enrichment
- Innere Differenzierung
- Stationenlernen
- Wochenplanarbeit
- Freie Arbeit
- Projektarbeit
- Stillarbeitsphasen
- Helfersysteme
- Äußere Differenzierung
- Arbeitsgemeinschaften
- Wettbewerbe
- Pull-Out-Programme
- Clustergruppierungen
- Innere Differenzierung
- Kritisch-konstruktive Zwischenbetrachtung
- Akzeleration
- Forderungen an Schule und Unterricht
- Begabungsfreundliches Umfeld
- Berücksichtigung der besonderen Leistungsfähigkeit
- Berücksichtigung der Interessenvielfalt
- Berücksichtigung der Ganzheitlichkeit und Ausgleich von Asynchronien
- Berücksichtigung sozialer Bedürfnisse
- Berücksichtigung von Vor- und Mehrwissen
- Förderung der Kreativität
- Aufbau einer Fragekultur
- Motivation als Schlüsselfaktor
- Kreativer Umgang mit Medien
- Flexible Unterrichtsgestaltung
- Leistungsbewertung
- Bereitstellen von Gelegenheiten für hochbegabte Kinder zum Treffen Gleichbefähigter und Kinder mit ähnlichen Interessen
- Rolle des Lehrers – Verbesserter Informationsstand dieser über die Bedürfnisse und Besonderheiten hochbegabter Kinder
- Kooperation
- Kollegium
- Eltern
- Kritisch-konstruktive Zwischenbetrachtung
- Begabungsfreundliches Umfeld
- Beratungsmöglichkeiten
- Beratungsstelle BRAIN
- Vereine
- Deutsche Gesellschaft für das hochbegabte Kind e. V.
- Mensa in Deutschland e. V.
- Hochbegabtenförderung e. V.
- Praktische Umsetzung anhand von zwei Bildungseinrichtungen
- Engelbert-Humperdinck-Schule (EHS), Frankfurt /Main
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Förderung hochbegabter Schüler*innen im Kontext der Regelschule. Ziel ist es, das pädagogische Handlungsproblem der Hochbegabtenförderung in Theorie und Praxis zu beleuchten und geeignete Fördermaßnahmen zu diskutieren.
- Definition und Modelle von Hochbegabung
- Identifizierung hochbegabter Schüler*innen
- Sozial- und Persönlichkeitsmerkmale hochbegabter Schüler*innen
- Herausforderungen und Probleme hochbegabter Schüler*innen in der Regelschule
- Möglichkeiten und Maßnahmen zur integrativen Förderung hochbegabter Schüler*innen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Hochbegabtenförderung an Regelschulen ein und skizziert die zentralen Fragestellungen der Arbeit. Sie begründet die Relevanz des Themas und beschreibt den Aufbau der Arbeit.
Zum Begriff Hochbegabung: Dieses Kapitel befasst sich mit der Definition des Begriffs „Hochbegabung“. Es werden verschiedene Definitionen und Modelle diskutiert, von der IQ-Definition bis hin zu multifaktoriellen Ansätzen, die neben der Intelligenz auch Kreativität und Talent berücksichtigen. Die Kapitel analysiert die Stärken und Schwächen der einzelnen Definitionsansätze und führt zu einer kritischen Auseinandersetzung mit dem Begriff Hochbegabung.
Definitionsklassen von Hochbegabung: Dieser Abschnitt vertieft die Diskussion um die Definition von Hochbegabung, indem er verschiedene Definitionsklassen nach Lucito und den Marland Report detailliert darstellt und kritisch bewertet. Die unterschiedlichen Perspektiven (z.B. IQ-basiert, sozial, kreativ) werden gegenübergestellt und ihre Vor- und Nachteile im Hinblick auf die praktische Identifizierung und Förderung von Hochbegabten erörtert. Die kritische Zwischenbetrachtung integriert die zuvor diskutierten Aspekte und bereitet den Weg zur Betrachtung von Modellen der Hochbegabung.
Modelle von Hochbegabung: Dieses Kapitel präsentiert verschiedene Modelle der Hochbegabung, darunter das Drei-Ringe-Modell von Renzulli, das Komponentenmodell von Wieczerkowski & Wagner und weitere. Die jeweiligen Modelle werden detailliert beschrieben und in ihren Kernaspekten verglichen. Der Fokus liegt auf der Darstellung der unterschiedlichen Komponenten und ihrer Wechselwirkungen, um ein umfassendes Verständnis von Hochbegabung zu ermöglichen. Die kritische Zwischenbetrachtung fasst die wichtigsten Erkenntnisse der Modellbetrachtungen zusammen und leitet zum nächsten Kapitel über die Identifizierung von Hochbegabung über.
Identifizierung von Hochbegabung: Das Kapitel behandelt die Identifizierung von Hochbegabung. Es untersucht die Notwendigkeit, den Zeitpunkt und die Qualität der Identifizierung. Es werden formelle Verfahren wie Intelligenztests und informelle Verfahren wie Lehrernominierungen detailliert erläutert und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile diskutiert. Der Umgang mit Underachievern wird ebenfalls thematisiert. Die kritische Zwischenbetrachtung bewertet die Effektivität und die ethischen Implikationen verschiedener Identifizierungsmethoden.
Sozial- und persönlichkeitspsychologische Aspekte der Hochbegabung: Dieses Kapitel erörtert die sozialen und persönlichkeitspsychologischen Aspekte von Hochbegabung. Es werden Familienstrukturen, Geschlechtsunterschiede und Persönlichkeitsmerkmale hochbegabter Kinder untersucht. Die Themen Selbstkonzept und Kontrollüberzeugung werden im Detail behandelt, und die Zusammenhänge zwischen Hochbegabung und sozial-emotionaler Entwicklung werden beleuchtet. Die kritische Zwischenbetrachtung integriert die Ergebnisse und stellt die Bedeutung der Berücksichtigung dieser Aspekte für eine erfolgreiche Förderung heraus.
Typische Probleme Hochbegabter im schulischen Umfeld: Dieses Kapitel beschreibt typische Probleme hochbegabter Schüler*innen in der Schule, wie Unterforderung, Leistungsverweigerung, soziale Isolation und den unangemessenen Umgang mit Misserfolgen. Es analysiert die Ursachen dieser Probleme und deren Auswirkungen auf die Entwicklung der Kinder. Die kritische Zwischenbetrachtung unterstreicht die Notwendigkeit von adäquaten Fördermaßnahmen.
Notwendigkeit einer (integrativen) Förderung hochbegabter Schüler: Das Kapitel argumentiert für die Notwendigkeit einer integrativen Förderung hochbegabter Schüler*innen. Es werden pädagogische, rechtliche, wirtschaftliche und gesellschaftliche Gründe für die Förderung dargelegt. Die Bedeutung der Grundschule für die Entwicklung von Kindern wird betont. Die kritische Zwischenbetrachtung fasst die wichtigsten Argumente zusammen und leitet zum Kapitel über Fördermaßnahmen über.
Fördermaßnahmen in der Schule: Dieses Kapitel beschreibt verschiedene Fördermaßnahmen für hochbegabte Schüler*innen in der Schule, darunter Akzeleration und Enrichment. Es wird auf verschiedene Differenzierungsansätze eingegangen, wie innere und äußere Differenzierung, und konkrete Beispiele wie Projektarbeit, Wochenplanarbeit und Pull-out-Programme werden erläutert. Die kritische Zwischenbetrachtung bewertet die Effektivität der verschiedenen Maßnahmen.
Forderungen an Schule und Unterricht: Dieses Kapitel formuliert Anforderungen an ein begabungsgerechtes schulische Umfeld und Unterricht. Es werden konkrete Maßnahmen zur Förderung der Kreativität, zur Entwicklung einer Fragekultur und zur Motivation der Schüler*innen vorgeschlagen. Die Bedeutung der Kooperation zwischen Lehrkräften und Eltern wird hervorgehoben. Die kritische Zwischenbetrachtung fasst die zentralen Forderungen zusammen.
Beratungsmöglichkeiten: Dieses Kapitel stellt verschiedene Beratungsmöglichkeiten für hochbegabte Schüler*innen und ihre Familien vor, darunter Beratungsstellen und Vereine. Die jeweiligen Angebote werden detailliert beschrieben.
Schlüsselwörter
Hochbegabung, Förderung, Regelschule, Identifizierung, Modelle, Differenzierung, Enrichment, Akzeleration, Unterforderung, soziale Integration, pädagogische Maßnahmen, Beratung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hochbegabtenförderung an Regelschulen
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet einen umfassenden Überblick über die Hochbegabtenförderung an Regelschulen. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel, und Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf der Definition und den Modellen von Hochbegabung, der Identifizierung hochbegabter Schüler*innen, den damit verbundenen sozial- und persönlichkeitsbezogenen Aspekten, den Herausforderungen im schulischen Umfeld, sowie geeigneten Fördermaßnahmen und Beratungsangeboten.
Wie wird Hochbegabung definiert?
Das Dokument diskutiert verschiedene Definitionen von Hochbegabung, von IQ-basierten Ansätzen bis hin zu multifaktoriellen Modellen, die neben der Intelligenz auch Kreativität und Talent berücksichtigen. Es werden die Stärken und Schwächen der einzelnen Definitionsansätze kritisch beleuchtet, inklusive der 6 Definitionsklassen nach Lucito und dem Marland Report.
Welche Modelle von Hochbegabung werden vorgestellt?
Das Dokument stellt verschiedene Modelle von Hochbegabung vor, darunter das Drei-Ringe-Modell von Renzulli, das Komponentenmodell von Wieczerkowski & Wagner, das Triadische Interdependenzmodell von Mönks, das mehrdimensionale Begabungskonzept von Urban, das Modell zur Beziehung von Begabung und Leistung von Gagné und das Münchner Multifaktorielle Begabungsmodell von Heller & Hany. Die Modelle werden detailliert beschrieben und verglichen.
Wie werden hochbegabte Schüler*innen identifiziert?
Die Identifizierung von Hochbegabung wird anhand formaler Verfahren (Intelligenztests, Schulnoten, Wettbewerbe) und informeller Verfahren (Lehrernominierung, Elternnominierung, Peernominierung, Selbstnominierung, Checklisten) erläutert. Die Notwendigkeit, der Zeitpunkt und die Qualität der Identifizierung sowie der Umgang mit Underachievern werden diskutiert.
Welche sozial- und persönlichkeitsbezogenen Aspekte werden berücksichtigt?
Das Dokument untersucht Familienstrukturen, Geschlechtsunterschiede und Persönlichkeitsmerkmale hochbegabter Kinder. Es beleuchtet das Selbstkonzept, die Kontrollüberzeugung und den Zusammenhang zwischen Hochbegabung und sozial-emotionaler Entwicklung.
Welche Probleme können hochbegabte Schüler*innen in der Schule haben?
Typische Probleme hochbegabter Schüler*innen in der Schule werden beschrieben, wie Unterforderung, Leistungsverweigerung, Minderleistungen trotz hoher Intelligenz, ungenügendes Erlernen von Lern- und Arbeitstechniken, soziale Isolation und unangemessener Umgang mit Misserfolgen.
Warum ist eine integrative Förderung notwendig?
Die Notwendigkeit einer integrativen Förderung wird anhand pädagogischer, rechtlicher, wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Argumente dargelegt. Die Bedeutung der Grundschule für die kindliche Entwicklung wird hervorgehoben.
Welche Fördermaßnahmen werden empfohlen?
Das Dokument beschreibt verschiedene Fördermaßnahmen, darunter Akzeleration (frühere Einschulung, Überspringen von Klassen, flexible Schuleingangsphase) und Enrichment (innere und äußere Differenzierung, Projektarbeit, Wochenplanarbeit, Pull-out-Programme, Clustergruppierungen).
Welche Forderungen werden an Schule und Unterricht gestellt?
Es werden Anforderungen an ein begabungsgerechtes schulischen Umfeld und Unterricht formuliert. Konkrete Maßnahmen zur Förderung der Kreativität, zum Aufbau einer Fragekultur, zur Motivation der Schüler*innen und zur Kooperation zwischen Lehrkräften und Eltern werden vorgeschlagen.
Welche Beratungsmöglichkeiten gibt es?
Das Dokument nennt verschiedene Beratungsmöglichkeiten, wie die Beratungsstelle BRAIN und verschiedene Vereine (Deutsche Gesellschaft für das hochbegabte Kind e. V., Mensa in Deutschland e. V., Hochbegabtenförderung e. V.).
Details
- Titel
- Förderung von Hochbegabten durch die Regelschule - Ein pädagogisches Handlungsproblem in Theorie und Praxis
- Hochschule
- Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main
- Note
- 1,0
- Autor
- Andrea Szigeti (Autor:in)
- Erscheinungsjahr
- 2006
- Seiten
- 151
- Katalognummer
- V57694
- ISBN (eBook)
- 9783638520607
- Dateigröße
- 1841 KB
- Sprache
- Deutsch
- Schlagworte
- Förderung Hochbegabten Regelschule Handlungsproblem Theorie Praxis
- Produktsicherheit
- GRIN Publishing GmbH
- Preis (Ebook)
- US$ 41,99
- Arbeit zitieren
- Andrea Szigeti (Autor:in), 2006, Förderung von Hochbegabten durch die Regelschule - Ein pädagogisches Handlungsproblem in Theorie und Praxis, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/57694
- Autor werden
- Ihre Optionen
- Vertriebskanäle
- Premium Services
- Autorenprofil
- Textarten und Formate
- Services für Verlage, Hochschulen, Unternehmen

- © GRIN Publishing GmbH.
- Alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten untersagt.
- info@grin.com
- AGB
- Open Publishing
Der GRIN Verlag hat sich seit 1998 auf die Veröffentlichung akademischer eBooks und Bücher spezialisiert. Der GRIN Verlag steht damit als erstes Unternehmen für User Generated Quality Content. Die Verlagsseiten GRIN.com, Hausarbeiten.de und Diplomarbeiten24 bieten für Hochschullehrer, Absolventen und Studenten die ideale Plattform, wissenschaftliche Texte wie Hausarbeiten, Referate, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen und wissenschaftliche Aufsätze einem breiten Publikum zu präsentieren.
Kostenfreie Veröffentlichung: Hausarbeit, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit, Interpretation oder Referat jetzt veröffentlichen!
- GRIN Verlag GmbH
-
- Nymphenburger Str. 86
- 80636
- Munich, Deutschland
- +49 89-550559-0
- +49 89-550559-10
- info@grin.com
-









